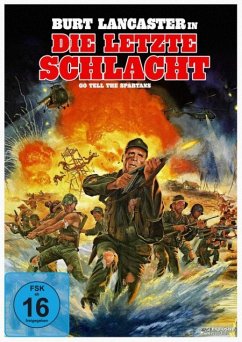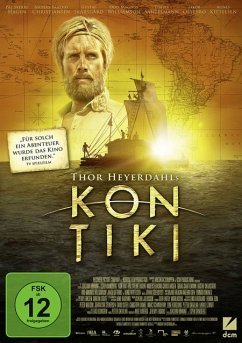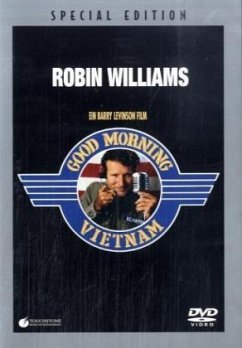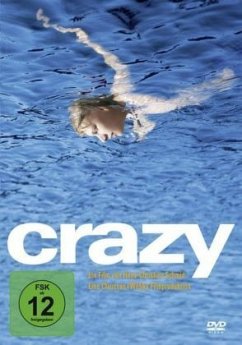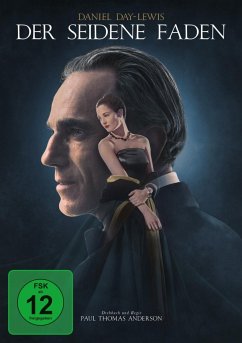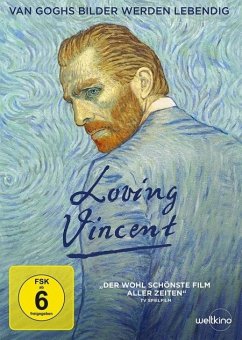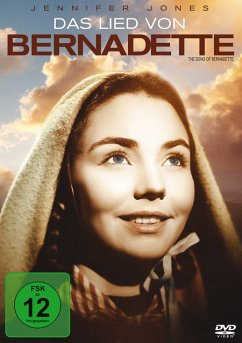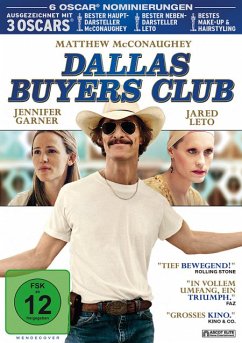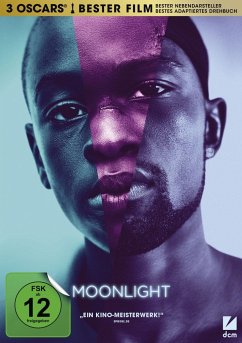Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (DVD)

PAYBACK Punkte
7 °P sammeln!
THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI ist ein schwarzhumoriges Drama von Regisseur Martin McDonagh. Nachdem Monate vergangen sind, ohne dass der Mörder ihrer Tochter ermittelt wurde, unternimmt Mildred Hayes (Frances McDormand) eine Aufsehen erregende Aktion. Sie bemalt drei Plakatwände an der Stadteinfahrt mit provozierenden Sprüchen, die an den städtischen Polizeichef, den ehrenwerten William Willoughby (Woody Harrelson), adressiert sind, um ihn zu zwingen, sich um den Fall zu kümmern. Als sich der stellvertretende Officer Dixon (Sam Rockwell), ein Muttersöhnchen mit Hang zur Gewalt, einmischt, verschärft sich der Konflikt zwischen Mildred und den Ordnungshütern des verschlafenen Städtchens nur noch weiter.