Das Jahr 2020. Den Polizisten der Zukunft ist das tragen von Schusswaffen verboten. Ihnen steht lediglich eine neue Waffe, die Stinger, zur Verfügung um für Recht und Ordnung zu sorgen. Der exzentrische Star-Detektiv James Tucker weigert sich beharrlich das Schusswaffenverbot zu befolgen und wird wegen diverser Verstöße schließlich vom Dienst suspendiert. Als ein bestialischer Frauenmörder sein Unwesen treibt, bleibt Tuckers Vorgesetztem Gage nichts übrig als den starrsinnigen Tucker wieder in Dienst zu stellen um den Killer das Handwerk zu legen...
Bonusmaterial
Filminformationen, Diashow
Was die Welt zusammenhält: Große Dokumentarfilme in München
Es war der 13. November 1991, der die Wahrheit ans Licht brachte. Zum ersten Mal sah die Welt, was in Ost-Timor seit sechzehn Jahren, seit dem Einmarsch der indonesischen Armee geschah. Auf dem Friedhof der Stadt Dili wurden bei einem Begräbnis eines Jungen, der von der Armee zuvor in einer Kirche ermordet worden war, zweihundertsiebzig Menschen erschossen. Sie rannten in wilder Panik um ihr Leben, vom Friedhof in die Stadt, während ihre Peiniger ihnen nachsetzten. Ganz ruhig und kühl schossen sie einen nach dem anderen nieder. Es war wie auf der Jagd. Auf einen jungen Mann hatten es die Mörder seit langem abgesehen: auf Kamal Bamadjah, einen Zwanzigjährigen neuseeländisch-malaysischer Herkunft, der sich für die Befreiung Ost-Timors engagierte. Der Mord an ihm läßt sich heute genau rekonstruieren. Man kennt die Täter und die Umstände der Tat. Doch wer würde sie jemalsa vor Gericht stellen. Drei Jahre nach dem Massaker, das nur eines von vielen, aber das erste von Journalisten und in Fernsehbildern bezeugte war, wurde der kommandierende General, der den Schießbefahl gegeben hatte, tatsächlich angeklagt - von Helen Todd, der Mutter von Kamal Bamadjah, vor einem amerikanischen Gericht in Boston. Die Klägerin konnte sich auf eine Rechtsgrundlage stützen, der zufolge Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor jedem amerikanischen Gericht angeklagt werden können. Und der Angeklagte befand sich kurz vor Prozeßbeginn sogar auf amerikanischem Boden, den er freilich, kaum daß er vorgeladen wurde, eiligst verließ. Er hatte nach seinem Kommando in Ost-Timor ein bißchen in Harvard studiert. Helen Todd wurde Schmerzensgeld und Schadensersatz in Höhe von zweiundzwanzig Millionen Dollar zugesprochen, die der General wohl niemals bezahlen wird. Doch darum, sagt Helen Todd, ging es ihr auch gar nicht: "Aber ich konnte endlich gegen die Militärs aussagen, die meinen Sohn ermordet haben. Ich konnte einen Prozeß anstrengen."
"Punitive Damage" nennt die amerikanische Justiz eine solche - in diesem Fall symbolische Strafe -, und diesen Titel trägt auch der Dokumentarfilm der Neuseeländerin Annie Goldson. Auf dem Münchner Filmfest erhielt sie dafür den Media Net Award in Silber, und auch beim renommierten Filmfestival von Sidney bekam sie einen zweiten Preis für ihren Film, dem es in mühelos-meisterhafter Weise gelingt, eine Geschichte, deren Hauptprotagonist nicht mehr am Leben und deren Fortgang zumeist schriftlich dokumentiert ist, zu bebildern. Sie ließ die Plädoyers aus dem Prozeß nachsprechen, was erstaunlicherweise alles andere als ermüdend wirkt. Dies hat die Filmemacherin, wie sie selbst erkennt, auch Helen Todd zu verdanken. "Wann haben Sie jemals eine Frau in mittleren Jahren gesehen, die derart stark ist und durch ihr aufrichtiges Engagement das Mitgefühl und die Sympathie der Zuschauer gewinnt? Das ist es, was ich an meinem Film besonders mag", sagt Annie Goldson.
Derlei Frauengestalten waren beim Wettbewerb des Media Net Award in München beileibe kein Einzelfall. In der Gestalt von Juliane Köpcke waren sie ebenso präsent wie mit der israelischen Autorin und Regisseurin Nurit Kedar, die mit ihrem Film "Borders" den erstmals vergebenen Preis des Discovery Channel errang. Sie führt ein Land vor Augen, das nur aus Grenzen zu bestehen scheint, die Menschen auseinanderreißen, deren Zusammengehörigkeitsgefühl dafür sorgt, daß das Unrecht dieser Grenzen nicht vergeht. Ohne Partei zu ergreifen, hat sich Nurit Kedar mit ihrem Filmteam unter Lebensgefahr auf beide Seiten der Grenzen begeben und Menschen getroffen, die mit der Trennung nicht leben können. In keinem Bild wird dies deutlicher als in jenem, das eine drusische Braut zeigt, die über die Grenze nach Syrien zu ihrem künftigen Ehemann will. Sie muß Israel und ihre Familie für immer verlassen. Den Tag jedoch, an dem sie Hochzeit feiern will, verbringt sie nicht bei ihrem Gatten, sondern hinter Stacheldraht. Über die Grenze darf sie erst vier Monate später. Der Symbolgehalt des Bildes von der Braut in Weiß, die die Grenze überschreitet, war einigen wohl nicht geheuer.
Daß Juliane Köpcke als einzige 1970 einen Flugzeugabsturz in den peruanischen Anden überlebt hat, wo Werner Herzog gerade seinen Film "Aguirre" drehte, und davon wie von den zehn Tagen, die sie im Dschungel bis zu ihrer Rettung zu überstehen hatte, heute in dem Dokumentarfilm, den Herzog mit ihr gedreht hat, mit ebenso staunenswerter Distanz wie Disziplin berichtet, mag wiederum jenen unheimlich sein, die nicht verstehen wollen, wie ein Mensch ein solches Unglück überstehen kann, bei dem die eigene Mutter ums Leben kam. Wer nicht dunkler Abgründe oder innerer Verhärtung verdächtigt werden will, wie es der "Stern" im Fall des damals siebzehnjährigen Mädchens tat, muß jene "Betroffenheit" zeigen, die für die Medien erst das Elend beweist. Nach innen gekehrte Trauer wirkt im Schweinwerferlicht nicht. Und sie läßt sich für die Presse ziemlich schlecht vermarkten.
Wie die anderen aufsehenerregenden Dokumentarfilme, die in München zu sehen waren, nimmt sich der Erstling des jungen französischen Autors Olivier Ballande "Justice" grundlegender Verstöße gegen die Menschenrechte an. Er schildert in schockierenden Bildern, auf welch menschenverachtende Weise ein Justizsystem mit Kindern umgeht. Ballande bezeugt, wie sich die herrschende an der kommende Generation vergeht oder, wie es in der Laudatio für den ebenfalls preisgekrönten Film hieß, eine weitere Generation um ihre Zukunft betrogen wird. Ballandes Film handelt von einem Land namens Madagaskar, das freilich, wie auch Annie Goldson zeigt, überall auf der Landkarte zu finden ist.
Der große - und erste deutsche Gewinner - des Media Net Award, "Bismuna" von Uli Kick, zeigt derweil, wie ein wild entschlossener Pädagoge in Nicaragua Probleme der hiesigen Gesellschaft löst, indem er Jugendlichen, die unsere Justiz aufgegeben hat, eine letzte Chance bietet. Seinem Untertitel "Ein Abenteuerfilm" wird Kicks Stück in jeder Szene gerecht. Auf derart pfiffige Weise wie er hat sich wohl noch niemand eines solchen Themas angenommen. Genau das wiederum, die Übermacht der sozialen wie politischen Fragestellungen, hat wohl verhindert, daß Christian Rischert für seinen Film in München einen Preis bekam. Dabei ragt "La Scala und die Magie des Goldes" nicht allein wegen seines Sujets heraus. Zum ersten Mal überhaupt durfte ein Filmteam hinter die Kulissen und die Vorbereitungen zur Premiere von Wagners "Götterdämmerung" begleiten. Man ahnt, welche Kunstfertigkeit es erfordert, inmitten des nervösen Gewimmels, nicht nur nicht im Weg zu stehen, sondern auch noch Bilder und Gespräche einzufangen, die so klar wirken, als hätte man alle Zeit der Welt gehabt, sie auszuleuchten. So vielgestaltig wie das Leben an der Oper, wie das Werk, das zur Aufführung kommt, ist dieser Film, dessen Szenen in jubelnden Farben leuchten. Rischert kommt dem Dirigenten Riccardo Muti im Orchestergraben ebenso nah wie dem blinden Telefonisten in dessen kleiner Kammer oder der jungen Sängerin aus der Ukraine, die ihr Solisten-Glück noch gar nicht faßt. Nach sinnlichen neunzig Minuten, deren Schnitt (Gaby Kull-Neujahr) drei Monate in Anspruch nahm, hat man das Gefühl, einen Abend in der Scala verbracht zu haben, und wünscht sich zugleich nichts sehnlicher, als baldmöglichst ein Ticket nach Mailand zu lösen. Dieser Film ist eine Oper. Und hoffentlich nicht, wie Christian Rischert nach der Premiere sagte, die Letzte dieses Autors.
Denn was bliebe, wenn das anspruchsvolle Fernsehen, Kanäle, die sich als Kulturprogramm verstehen, auf Filme wie diesen zu verzichten hätte; auf einen Film, der am Ende von der "Wahrheit der Oper" spricht, derzufolge es diese Welt im Fortschreiten des Chaos schon recht weit gebracht habe, und, wie Wagner es sich dachte, aus dem Unheil in Unschuld erst wiederauferstehen könnte, nachdem sie vergangen ist.
Am Ende von Annie Goldsons Film steht ein Zitat des mit zwanzig Jahren zu Tode gekommenen Kamal Bamadjah. Das Überleben eines Volkes, des Volkes von Ost-Timor, schrieb er in seinem letzten Brief, hänge nicht nur "von seinem bewunderungswürdigen Selbstbehauptungswillen", sondern von der "Menschlichkeit in der Welt" ab.
MICHAEL HANFELD
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main





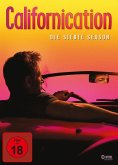





 FSK: Freigegeben ab 18 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 18 Jahren gemäß §14 JuSchG