Technische Angaben:
Bildformat: 16:9 (2.35:1)
Sprachen/Tonformat: Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch (Dolby Digital 5.1)
Untertitel: Englisch, Spanisch, Deutsch u. a.
Ländercode: 2
Nick Powell (Justin Chatwin) ist ein attraktiver junger Schriftsteller mit glänzenden Zukunftsaussichten. Eines Nachts wird er Opfer eines brutalen Überfalls und stirbt - doch so scheint es nur. Tatsächlich ist er gefangen in einer geisterhaften Zwischen-welt, wo niemand ihn sehen oder hören kann. Niemand außer Annie, die einzige Person, die ihn vielleicht retten kann. Die beiden müssen schnell das Rätsel um Nicks Ermordung lösen, ehe es zu spät ist und er nie wieder ins Leben zurückkehren kann.
Bildformat: 16:9 (2.35:1)
Sprachen/Tonformat: Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch (Dolby Digital 5.1)
Untertitel: Englisch, Spanisch, Deutsch u. a.
Ländercode: 2
Nick Powell (Justin Chatwin) ist ein attraktiver junger Schriftsteller mit glänzenden Zukunftsaussichten. Eines Nachts wird er Opfer eines brutalen Überfalls und stirbt - doch so scheint es nur. Tatsächlich ist er gefangen in einer geisterhaften Zwischen-welt, wo niemand ihn sehen oder hören kann. Niemand außer Annie, die einzige Person, die ihn vielleicht retten kann. Die beiden müssen schnell das Rätsel um Nicks Ermordung lösen, ehe es zu spät ist und er nie wieder ins Leben zurückkehren kann.
Bonusmaterial
DVD-Ausstattung / Bonusmaterial: - Audiokommentar von Regisseur David S. Goyer und Drehbuchautorin Christine Roum - Zusätzliche Szenen mit optionalem Audiokommentar von Regisseur David S. Goyer und Drehbuchautorin Christine Roum - Musikvideo von 30 Seconds To Mars: 'The Kill' - Musikvideo von Sparta: 'Taking Back Control'
Von Vätern und Söhnen: Wie das Potsdamer Filmfest im Salon den regionalen Notstand erklärt
Die Therapie sozialer Verhaltensstörungen geht heute eigenartige Wege. 1998 wurde ein knappes Dutzend wegen Autodiebstahl und Gewalttaten bestrafter junger Männer aus Potsdam mit ihrem Bewährungshelfer auf die Reise nach Rumänien geschickt. Die Fenster eines Wohnhauses zu streichen war die Aufgabe, die Erweiterung des Horizonts das Ziel. Die meisten hatten noch nie eine andere Gegend als das Havelland gesehen, wo sie aus "Spaß und Langeweile" (so der Titel von Thomas Bresinskys dokumentarischem Bericht über das pädagogische Unternehmen) früh schon viel Unfug anstellten.
Aussprachen mit dem Bewährungshelfer, der sich mit Leidenschaft gegen die Brandung des rechtsradikalen Gedankengutes wirft, sind das wiederkehrende Motiv der aufschlußreichen Dokumentation, die auf dem jüngsten Filmfest in Potsdam ein großes Publikum anzog. "Warum hast du einem Roma-Kind den Spruch ,Ich bin ein Kanake' beigebracht?" Schon wieder ein Vorkommnis, und die Arbeitsmoral läßt bereits nach einer Woche beträchtlich nach. Es fehlt den Burschen nicht allein der Respekt vor den Fremden, sondern auch ein ethisches Rückgrat. Der Münchner Regiestudent fördert mit viel Geduld und dem Einverständnis der Beteiligten die brandenburgische, um nicht zu sagen ostdeutsche, in vielem aber gesamtdeutsche Misere einer orientierungslosen und daher nach starken Leitbildern suchenden Jugend zutage.
Mit dem Bekenntnis zu Hitler auf den Lippen, eintätowiertem Hakenkreuz und einem nachgebildeten "Eisernen Kreuz" am Halsband gehören sie einer Clique an, der die Eltern machtlos hinterherschauen. Doch gerade in den Familien, wo im Alkoholdunst mancher Spruch geklopft wurde, nahmen sie den aggressiven Tonfall schon früh auf. Wie soll eine verordnete Auslandsreise daran etwas ändern, wie ein Plan das schmale Erziehungswerk fortsetzen?
Der sozialen Therapiearbeit hat sich Potsdams Filmfestival, das im vergangenen Jahr zu einem Filmfest herabgestuft wurde, schon durch die Beschränkung auf den - freilich großzügig ausgelegten - "Regionaleffekt" verschrieben. 1993 unter dem anspruchsvollen Titel "Europäischer Salon für Liebhaber des jungen Films" gegründet, entzog man dem von Anfang an indolenten Potsdamer Publikum, das noch zu keiner Zeit Cineasten hervorbrachte, zuerst die vornehme Bezeichnung und jetzt auch das von Ost nach West gespannte Programm. Filmische Ausflüge in die europäische Landschaft habe es vorerst nicht mehr verdient, es solle erst einmal in den Spiegel seiner verruchten Seele schauen, beschlossen die Veranstalter und ließen dieses Jahr zwei anspruchsvolle Wettbewerbsprogramme, von mehreren Nebenreihen ergänzt, vom Berliner Ventura-Verleih zusammenstellen.
Die Filmfiguren lassen sich allerdings nicht auf den örtlichen Fußballplatz sperren, und auch ohne Bewährungshelfer unternehmen sie weite Reisen. Eine Art Fortsetzung von Bresinskys dokumentarischer Bildfolge der ratlos vor allen Aufgaben versagenden Söhne schuf Lars Kraume mit seinem Kriminalfilm "Dunckel": Drei Brüder überfallen eine Bank, aber es gelingt ihnen nicht einmal, mit der Beute ins nahe Polen zu fliehen, so fatal eng sind sie an die Familien und den ähnlich strukturierten Clan des Auftraggebers gebunden. Kraume nimmt der Haltung die Krimi-Spannung, um sie - oft gelingt es - durch psychologische Aufmerksamkeit zu ersetzen.
Konkrete Gründe, über sich und ihre Väter zu sprechen, haben manche dem Realsozialismus entkommene Regisseure. "Wir Kommunistenkinder" nennt Inge Wolfram ihre Videoarbeit, die sich mit Zorn und Trauer dem eigenen Vater und anderen Männern des Führungszirkels der alten KPD, den überlebenden Ehefrauen und den längst desillusionierten Kindern zuwendet. Die Intrigen im Moskauer Emigranten-Hotel "Lux", die Folterung der Opfer, die Erschießungen, Verbannungen und die geringe Einsicht mancher Söhne (wie im Fall Eberlein), das Festhalten am Glauben, als nichts mehr zu glauben war, und nun wohl gar ein Weitermachen, das sich von der Bürde des Stalinismus frei wähnt, fordern den Zorn der Autorin, die auf solche Art von Weltveränderung nicht hoffen will, spürbar heraus. Doch nicht nur Leidenschaft hat Inge Wolframs Öffnung der Familienakten geprägt, sondern auch die seltene Fähigkeit, Gespräche und Schriftnachlässe mit leichter Hand zu visualisieren. Der innere Dialog mit dem längst verstorbenen Vater, Zeugengespräche, Montage von Dokumenten bilden eine gelungene Einheit.
Noch weniger Filmmaterial hatte Hannes Schönemann in Händen, als er sich von der Last einer Jugendliebe im Zeichen von Sozialismus und Staatssicherheit befreien wollte: "Julias Mann". Nicht daß er den Verführungen selbst erlegen wäre, durch seine ersten neorealistischen Arbeiten wurde er zur Unperson bei der Defa und schließlich zum zum Freikauf ausgeschriebenen Häftling, aber auf die Liebe einer dänischen Doppelagentin, deren Verbindung mit der Stasi er ahnte, ließ er sich mit Leib und Seele ein. 1985 in Hamburg angekommen, bedrängte ihn diese dem Selbstmord zutreibende Biographie erneut. Selten hat ein Filmemacher sich selbst derart schonungslos ins Bild gesetzt. Der Zuschauer wird noch einmal in die Wahnwelt des Kalten Krieges hineingezogen, deren Opfer im Straßengraben der Geschichte zurückblieben. Der ausschöpfende Monolog kommt einem Schuldbekenntnis gleich, während die Reisen zu den Tat- und Erinnerungsorten kühle Distanz nahelegen.
Werden die vielfach gebrochenen ostdeutschen Biographien einmal die aufregenderen Filmgeschichten liefern? Sollten die im Osten groß gewordenen Regisseure künftig das größere Konfliktbewußtsein an den Tag legen, weil sie ein Ohr für das Grollen im Untergrund haben und - so entschieden sie Utopien fürchten müssen - doch nach einem Licht Ausschau halten? Manches spricht dafür, vieles aber derzeit dagegen, daß das Publikum im Kino mehr als seinen Spaß sucht. Leichtigkeit ist gefragt, gab die Jury den Dokumentaristen zu verstehen, hielt Abstand zu den Reibeflächen, die Bresinsky, Wolfram und Schönemann hinstellten, und schenkte ihre Huld Bettina Haasens lebenssprühendem Debüt "Zwischen zwei Welten".
Auch sie ist auf die Reise gegangen, aber nicht zu therapeutischen Zwecken oder um die Vergangenheit auszuforschen, sondern um die ungewöhnliche Freundschaft mit einem Nomaden im Busch von Niger zu pflegen, den sie dann auch, dank guter Orts- und Sprachkenntnis und nach vielen aufschlußreichen Schwierigkeiten, findet. So frisch und munter auf dem Pfad der Fremdenliebe wünscht sich das aufgeklärte Publikum den jungen Zeitgenossen. Man schaut gern einmal in eine andere Region, wenn man deren Sorgen nicht zu teilen braucht. Möglicherweise geht auch von Frauen, im Film wie im Leben, mehr Schwung aus. Den mit 5000 Mark dotierten Preis durfte sich Bettina Haasen mit Juliette Cazanave, die dem Leben von fünf Französinnen in Berlin auf der Spur war ("Ailleurs j'y suis"), teilen. So genießt man die fröhlichen Seiten der Globalisierung.
Aber daheim ist es, wie bemerkt, nicht immer so lustig. In Andreas Kleinerts, von Jürgen Jürges in dichte und auffällig dunkle Schwarzweißbilder gesetzter Geschichte "Wege in die Nacht" fallen zwei entscheidende Schüsse. Mit dem ersten trifft der Protagonist, ein arbeitslos gewordener Betriebsdirektor im Osten Berlins, eine junge Frau, die in der väterlichen Leitfigur plötzlich einen Verräter ausgemacht zu haben meint, der zweite sein eigenes Herz, das der Wirklichkeit nicht mehr gewachsen ist. Gerade weil der Mann kein Opportunist war, kann er sich nicht flink wenden. Mit dem Mädchen und einem Burschen hat er einen nächtlichen Streiftrupp gebildet, der dem ausländerfeindlichen Spuk in Berlins Verkehrsmitteln ein Ende bereiten will. Aber auch Fäuste müssen als soziale Therapieform versagen. Im Angesicht des gesprengten Kraftwerks räumt er sich selbst aus einem Weg, der ihm keiner zu sein scheint. Der Spielfilm bestätigt die Befunde der genannten dokumentarischen Arbeiten, indem er aus ihnen ein vom Wahn durchtränktes, aber formal beherrschtes Gleichnis schafft. So bildeten viele Aufführungen dieses scheinbar eingeengten Regionalprogramms (zu dem dank des in Berlin ansässigen Produzenten auch Aleksander Sokurows "Woloch" gehörte) eine dichte Motivkette. Zusammen mit "Nachtgestalten" von Andreas Dresen erhielt "Wege in die Nacht" den mit 10 000 Mark dotierten Preis der Stadt Potsdam.
HANS-JÖRG ROTHER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

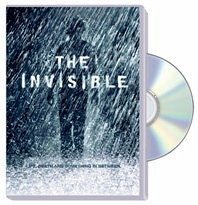
 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG