In der Gegend von Arles und Auvers-sur-Oise, wohin sich Vincent van Gogh (Willem Dafoe) zurückgezogen hat, um dem Druck des Lebens in Paris zu entkommen, wird er von den einen freundlich und von den anderen brutal behandelt. Die Inhaberin des örtlichen Restaurants hat Mitleid mit ihm und schenkt ihm ein Notizbuch für seine Zeichnungen. Andere haben Angst vor seinen dunklen und unberechenbaren Stimmungsschwankungen. Auch sein enger Freund und Künstler Paul Gaugin findet ihn zu erdrückend und verlässt ihn. Allein sein Bruder und Kunsthändler Theo unterstützt ihn unerschütterlich, auch wenn es ihm nicht gelingt, auch nur eines von Vincents Werken zu verkaufen.

Julian Schnabel hat die Passion Vincent van Goghs verfilmt: "An der Schwelle zur Ewigkeit"
Wer Argumente gegen Programm- und Arthouse-Kinos sucht, wird diesen Film studieren müssen, mit zusammengebissenen Zähnen und vielen neuen Falten im Hirn. Der bekannte amerikanische Großkunstsammlervillenfoyerveredler und Filmregisseur Julian Schnabel hat das Leben des noch viel weltberühmteren Tüpfchenträumers Vincent van Gogh verfilmt. Der Held trägt das Gesicht von Willem Dafoe. Es geht schlimm zu in "Van Gogh - An der Schwelle zur Ewigkeit": Das Genie fällt in zwei Sprachen über eine Frau vom Land her, weil Genies sich schwer zügeln können, das ganze Dorf empört sich über dieses verrutschte Schäferstündchen, und eine hergelaufene Lehrerin demütigt den Visionär, weil sie nicht begreifen will, warum man die Natur so knotig pinselt wie er.
Die folgenreichsten Begegnungen mit Frauen, die der rührende Psychopath erleben muss, zeigen das Geschlechtergegenüber also als verklemmt und verständnislos - dumm genug, aber andererseits: Wenn die Rollen vertauscht wären und Herr Schnabel einen analogen Stuss über Frida Kahlo und "die Männer" erzählt hätte, wäre der Film auch nicht besser.
Dieser Film will geliebt werden, das macht sein Misslingen fast tragisch und seine Plattheiten ärgerlich: Die Gegend von Arles in der Sonne, die Gegend von Arles auch mal im Regen, eine enge Kneipe, eine noch engere Kammer, ein trostloses Irrenhaus mit Wasserfolter, alles wird mit den denkfaulsten Bildkürzeln flachgefilmt. Man erlebt so ein eklatantes Komplementärübel zum sechshundertsten "Transformers"- oder "The Fast and the Furious"-Blockbuster, insofern beide Sorten Simpelbedienung zwei Seiten der Münze "Reiz-Reaktions-Rummel-Kino" bilden. Denn zum Jahrmarktswesen, als dessen zeitgenössische Erben die Lichtspielhäuser dem Streaming derzeit einen harten Abwehrkampf liefern, gehört neben der Achterbahn in 3D eben auch die prätentiöse Wahrsagerin mit ausländischem Akzent, die von Inspiration faselt.
Dass diese Imago in Schnabels Gestalt ihre Kundschaft scheinbar individueller bedient, als die Massen-Spektakelware das tut, bedeutet nicht, dass sie mehr mit Kunst zu tun hätte als jene, sondern nur, dass es auch einen Kommerz namens Kunstgewerbe gibt, nicht nur einen namens Überwältigung. Oscar Isaac ist Paul Gauguin, Mads Mikkelsen ist ein Priester, der ein wenig reserviertes Mitleid spendiert: Die öde Starparade könnte von keinem Computerprogramm herzloser berechnet worden sein.
Durchgängig herrscht zudringlicher Wehmutsterror anstelle eines Begriffs von Vergangenheit, obwohl es doch angeblich darum geht, verlorene Achtsamkeit wiederzufinden: Zeitlose Hände nesteln an einer Postkartenmotivjacke, und schau nur, da sind auch schon die Schuhe vom Ausstellungsposter! Klavier, Klavier, Spazier, Spazier, dann schmeißt sich van Gogh zu Boden und besudelt sich mit Dreck. Dazu leidet er mit aufgerissenen Augen an der Furcht, der Einzige zu sein, der die Ewigkeit sieht, wenn er in die Landschaft stiert. Jesus Christus persönlich wird mit den Worten zitiert, man solle sich vom Sichtbaren ab- und dem Unsichtbaren zuwenden. Schön, aber warum dann nicht gleich ein Hörbuch statt Kino? Blumen. Dämmerung. Zeitsprünge. Am Ende liegt der Schmerzensmann als edler Kadaver zwischen seinen Werken, und irgendein Schnittpraktikant steuert den horrenden Einfall bei: Meister Schnabel, machen wir die Projektionswand doch kurz gelb und lassen Gauguin davon schwärmen, wie wahnsinnig gelb das Gelb bei van Gogh immer ist.
Am schlimmsten zappeln die Sequenzen, die den Wahnsinn des Begnadeten bebildern sollen: Da rammt sture Montage mehrere Takes ineinander, damit noch die Schläfrigsten verstehen, dass van Goghs Bewusstsein in Klecksen gequantelt ist, die gern übereinanderschmieren und ineinanderfließen. Das heillose Gestümper wirkt umso deprimierender, als Julian Schnabel mit dem unverkrampft originellen Film "Schmetterling und Taucherglocke" (2007) überzeugend dargetan hat, dass ihm bei der bilderzählerischen Gestaltung außergewöhnlicher Bewusstseins-, Körper- und Gemütszustände durchaus Fesselndes und Anregendes erreichbar sind. Der darin von Mathieu Amalric gespielte Mann mit Locked-in-Syndrom, an dem schier alles gelähmt ist außer Vorstellungsvermögen und Erinnerung, funktioniert in der Innen- wie der Außenperspektive als starker Filter für so gut wie alles, was Kunst über Menschen herausfinden kann; "Van Gogh - An der Schwelle zur Ewigkeit" saugt dagegen bloß aus einem halbgebildeten Müllhaufen voller Gerüchte über die sogenannte Hochkultur einen Eimer voll Schmalz, der den Impressionismus als eine Art kuscheligen Trotz gegen die Härte und Schnelligkeit modernen Weltempfindens versinnbildlichen soll, und schüttet dieses harmvolle Zeug dann ungefiltert und unsortiert ins empfängliche Kollektivnervensystem von Gremien, die entscheiden wollen, ob ein Film eher "besonders wertvoll" ist oder unterhaltsam.
Die harte Lehre der unschönen Erfahrung lautet wohl: Am elendesten ist europäisches Kino immer dann, wenn Amerikaner es herstellen (gilt allerdings auch umgekehrt, here's looking at you, Til Schweiger). Nicht mal die Farbwerte, die Schnabel auffährt, versöhnen mit dem ungünstigen Gesamteindruck, denn ihre Pseudoinnerlichkeit rührt höchstens zwei Szenen lang, bis man erkennt: Marineblau ist Himmelblau ist heute Blau und morgen Blau und übermorgen wieder - jede Nuance säuft ab in der Eintönigkeit des ständigen Signals "ominöse Pracht mit Anfällen von Verfinsterung".
Hätte Schnabel mehr Mut gehabt, als ein zwischengeschaltetes, billig-eiliges Schnellmaltutorial verlangt, könnte man sich gerade von ihm durchaus mit Freude und Dankbarkeit einen Film anschauen, der nichts täte, als zwei Stunden um einen Granatapfel zu kreisen, der auf einem schlecht gewischten Küchentisch liegt. Der morose Weihepopanz aber, den seine gewollt ungenauen Einstellungen im Van-Gogh-Drama andauernd aufrichten, ist zuletzt, von allen narrationsökonomischen Fragen abgesehen, auch einfach potthässlich.
Als Schnabel seinen Kollegen Jean Michel-Basquiat 1996 in einem Spielfilm wiederauferstehen ließ, war dem teils liebevollen, teils makabren Mummenschanz wenigstens hin und wieder etwas wie Witz beigemengt, in Gestalt des pingelig seltsamen David Bowie vor allem, der darin einen Andy Warhol gab, der Andy Warhol bestimmt besser gefallen hätte als Andy Warhol selbst.
Auch der "Taucherglocken"-Film hat eine Art Humor, zum Beispiel dank Max von Sydow, der beim Rasiertwerden bärbeißig rumbrummt. Vielleicht war Mikkelsen als Erzeuger eines ähnlichen Kontrapunkts zur Tränenmelodie des Restes im Van-Gogh-Ding vorgesehen, aber auch er kommt gegen Sprüche nicht an wie den, Leiden sei größer als Lachen, den Dafoe (der seine schlechte Sache übrigens sehr gut macht) ausagiert, als hätte Schnabel nie davon gehört, dass gegen das Lachen immer nur die Lächerlichen schimpfen. Na gut: Vielleicht war's kunstgeschichtlich nötig, dass ein Film mal alle sentimentalen Ästhetikfehlauffassungen der Neuzeit in knapp zwei quälenden Stunden zusammenfasst. Den Bildern, die van Gogh hinterließ, geschieht damit ja nichts Böses; sie bleiben von allen Übergriffen nachgeborener Distanzlosigkeit unberührt.
DIETMAR DATH
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

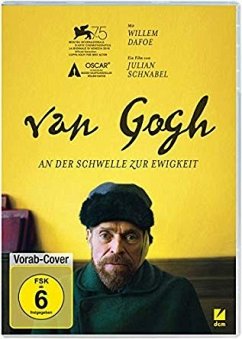






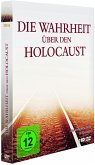




 FSK: Freigegeben ab 6 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 6 Jahren gemäß §14 JuSchG