Produktdetails
- Anzahl: 1 DVD
- Hersteller: Farbfilm Verleih / Lighthouse Home Entertainment
- Erscheinungstermin: 23. August 2013
-
![]() FSK: ohne Alterseinschränkung gemäß §14 JuSchG
FSK: ohne Alterseinschränkung gemäß §14 JuSchG - Regionalcode: 2
- EAN: 4250128442381
- Artikelnr.: 66504451
- Herstellerkennzeichnung
- farbfilm verleih GmbH
- Boxhagener Str. 106
- 10245 Berlin
- info@farbfilm-verleih.de

Nie gab es mehr Dokumentarfilme im Kino als im letzten Jahr. In ihrer Form sind sie offener, vielfältiger geworden. Von welcher Welt erzählen uns diese Filme?
Was trinkt ein Mann, der sich den ganzen Tag mit abscheulichen Verbrechen beschäftigt, zum Abendessen? Diese Frage ist auf den ersten Blick nicht eigentlich von Belang für den Film "Blick in den Abgrund" von Barbara Eder, in dem profiler aus verschiedenen Teilen der Welt porträtiert werden. Das sind Menschen, die in Delikten nach Mustern suchen, nach psychologischen oder anderen Auffälligkeiten, die oft entscheidende Rückschlüsse bei der Suche nach Tätern ergeben. Den deutschen Vertreter Stephan Harbort sehen wir in einem intensiven Gespräch mit einem Sexualmörder, wir sehen ihn aber auch abends beim Bier, in seiner privaten Umgebung; kurz erheischt die Filmemacherin sogar einen Blick in das Kinderzimmer, wo gerade jemand zu Bett gebracht wird.
Das sind markante Details angesichts der Tatsache, dass es sich beim "Blick in den Abgrund" um einen Dokumentarfilm handelt, also um eine Erzählung oder einen Bericht, die von der faktischen Wirklichkeit und nicht von einer erfundenen ausgeht. Dokumentarfilme haben an der Wirklichkeit in der Regel auch eine Grenze: Nicht alles kann in ihnen vorkommen, nicht alles ist für Kamera und Mikrofon erreichbar. Es gibt Persönlichkeitsrechte, und es gibt private Räume, die üblicherweise für das dokumentarische Arbeiten verschlossen sind.
Vor diesem Hintergrund fällt auf, dass die österreichische Regisseurin Barbara Eder für ihren Film eine ausgesprochen "synthetische" Form gewählt hat, nahe an den Mustern des fiktionalen Erzählens. Und das wiederum macht "Blick in den Abgrund", der im Januar in Deutschland in die Kinos kommt, zu einem besonders interessanten Beispiel für den auffälligen Boom des dokumentarischen Films. Er schlug sich im abgelaufenen Jahr auch numerisch nieder: von den je nach Zählung und Stadt bis zu mehr als 500 angelaufenen Filmen waren gut 20 Prozent keine Spielfilme, sondern eben Dokumente aus den verschiedensten Bereichen der wirklichen oder äußeren Wirklichkeit. Die Unterscheidung, die sich hier andeutet, verweist übrigens auch auf eine interessante Leerstelle: Die Naturwissenschaften, die sich mit inneren und innersten (und äußersten) Wirklichkeiten beschäftigen, sind jedenfalls in den Formaten des abendfüllenden Dokumentarfilms überraschend bildlos geblieben; die virtuellen Wirklichkeiten, mit denen hier Darstellungsmechanismen zu teilen wären, ergeben potentielle Schnittstellen gerade dort, wo etwas für die Bildproduktion nicht oder schwer erreichbar ist.
Das Fernsehen mit seinen zahllosen "Reality"-Shows hat zweifellos dazu beigetragen, einen vagen Begriff des Dokumentarischen zu bekräftigen. Doch zeigt sich - wenig überraschend -, dass die Stärken des Kinos darin liegen, wie es sich auf Wirklichkeiten einlässt, die nach spezifischen Formen verlangen. Das Jahr 2013 begann bezeichnenderweise mit einem kleinen Hit im dokumentarischen Feld: David Sievekings "Vergiss mein nicht", in dem der junge Filmemacher von der Demenz seiner Mutter Gretel und der außergewöhnlichen Ehe seiner Eltern erzählt, sahen mehr als 100 000 Besucher. In diesem Film kam eine Menge von dem zusammen, was Spielfilme meist nur erreichen, wenn sie ihrerseits auf Improvisation, Unmittelbarkeit, Intimität zielen: ein freimütiger Ich-Erzähler, der uns in seine familiären Umstände einweiht; eine charismatische Hauptdarstellerin, die der Welt (und damit auch dem Blick des Kinos) zunehmend entgleitet, ohne dass ihre Schönheit dadurch verschwinden würde; und Aspekte einer Chronik, die sich direkt auf die (Erfolgs-)Geschichte der Bundesrepublik als eines freiheitlichen Gemeinwesens beziehen lassen. Zwischendurch ist auch die wehmütig stimmende Fotografie eines der Großväter von David Sieveking zu sehen. Der Vater von Gretel kam aus dem Zweiten Weltkrieg nicht zurück, ein junges, vergeudetes Leben, das hier aber noch einmal für einen Moment in der ganzen Aura des fotografischen Bildes erstrahlt, mit jener Potenz also, auf der alles Dokumentieren beruht.
Wenn man dann auch nur kursorisch die Liste der im vergangenen Jahr gestarteten Dokumentarfilme durchgeht, dann wird man sehen, wie weit das Spektrum der Strategien und Techniken reicht: die kleinen, wasserdichten Digitalkameras, mit denen Verena Paravel und Lucien Castaing-Taylor auf ein Fischerboot vor Neuengland gingen, wo sie mit "Leviathan" ein höchst artifizielles Elementargedicht drehten; die "direct cinema"-Methodik, mit der Ilian Metiev in "Sofia's Last Ambulance" von dem Team eines bulgarischen Rettungswagens erzählte, in einem Film, der in Deutschland just zu dem Zeitpunkt herauskam, als in Sofia die Proteste begannen; die Hasenpuppen, in die der große Peter Liechti in "Vaters Garten" seine Eltern verwandelte, um sie umso deutlicher von sich selber sprechen zu lassen; die reenactments, mit denen Joshua Oppenheimer in "The Act of Killing" eine Reihe von straflos ausgegangenen Mördern aus den indonesischen Massakern der sechziger Jahre zu einer Konfrontation mit ihrer Schuld verführte; oder die scheinbar belanglosen Bilder von einer Pariser U-Bahn-Station, zu denen Vincent Dieutre in "Jaurès" mit sonorer Stimme eine große schwule Liebesgeschichte erzählte und sie auf eine Politik der vielfachen Exklusion hin öffnete.
Nicht viele dieser Filme erreichen auch nur annähernd 10 000 Zuschauer. Das mag nach einem zu vernachlässigenden Segment des Kinobetriebs aussehen, muss aber vor dem Hintergrund einer stark veränderten Situation gesehen werden. Denn der digitale Umbruch erlaubt punktuellere Auswertungen. Zumindest in den größeren Städten gibt es Kinos, die sehr spezifische Öffentlichkeiten konstituieren, und schließlich ist gerade auch für Dokumentarfilme ein Kinostart die Voraussetzung für ein "Leben" danach, auf VOD-Portalen wie realeyz etwa. Sofern deutsches Fördergeld im Spiel ist, ist ein Kinostart auch obligat, woraus wiederum im Problemfall ein Zirkelschluss werden kann: Dann wird der dichte Terminkalender mit bis zu fünfzehn neuen Spiel- und Dokumentarfilmen pro Woche als Argument gegen eine differenzierte und kleinteilige Förderung genommen. Dabei entspricht einzig diese den Gegebenheiten einer Form, die per se auf Komplexität zielt - und auf eine Wahrnehmung, für die wiederum der exklusive Raum einer Kinoprojektion zumindest als initiierendes Moment unabdingbar ist.
Am Beispiel von Mario Schneiders "MansFeld" lässt sich sehr gut ersehen, wie eines in das andere greift. Der Regisseur erzählt von ein paar Kindern in einer ehemaligen Bergbauregion am Ostabhang des Harzes. In einem erstaunlichen Ritual zu Pfingsten kommt das alles zusammen - in einem höchst seltsamen Brauch mit schnalzenden Peitschen, von dem Schneider auch noch tolles, altes Filmmaterial aufgespürt hat. Dass Menschen sich in unseren Tagen und mitten in Deutschland noch zu solch "heidnischen" Festen zusammenfinden und es ganz normal finden, wenn ihresgleichen sich ekstatisch im Schlamm wälzt (man spricht auch von einem "Drecksaufest"), das allein würde "MansFeld" schon sehr interessant machen. In Verbindung mit den drei Jungen und deren ganz normaler Lebenswelt aber wird daraus eine große Synthese, in der sich nebenbei auch eine dokumentarische Tradition der ehemaligen DDR (von den Kindern von Golzow über die Neustadt-Generationen bei Thomas Heise) produktiv fortsetzt. Nach dem Filmstart von "MansFeld" ist nun auch noch eine DVD erschienen, auf der die früheren Arbeiten von Schneider enthalten sind, so dass hier plötzlich eine Region, ein Autor und ein zeithistorischer Zusammenhang auszunehmen sind.
Ein Ausblick auf das neue Kinojahr bestätigt, dass sich der Trend ungebrochen fortsetzt: in dem rumänischen "Crulic" (Start am 16. Januar) dienen Animationssequenzen dazu, die skandalösen Umstände des Todes eines jungen Mannes in einem polnischen Gefängnis zu rekonstruieren; in Stefan Ruzowitzkys "Das radikal Böse" (Start ebenfalls am 16. Januar) wirft ein Spielfilmregisseur einen neuen Blick auf die "ganz normalen Männer", die im Zweiten Weltkrieg an der Ostfront an der Ermordung von Juden teilnahmen; Manon Khalils "Der Imker" (30. Januar) könnte sowohl an den Erfolg des türkischen Spielfilms "Honig" wie auch an den des umweltpolitischen Dokumentarfilms "More Than Honey" anschließen. Und Barbara Eders "Blick in den Abgrund" (23. Januar) enthält schließlich noch einen wichtigen Aspekt, der darauf verweist, dass die Unterscheidung zwischen Spiel- und Dokumentarfilmen letztendlich immer eine pragmatische ist. Wir sehen hier nämlich auch ein paar pensionierte amerikanische Profiler, die sich "Das Schweigen der Lämmer" ansehen.
Die Wirklichkeit, das zeigt sich hier überdeutlich, orientiert sich maßgeblich an Fiktionen. Wir sehen das Leben und die Welt immer schon nach dem Muster von Bildern, die sich uns eingeprägt haben, und die Dokumentarfilme haben ihre Berechtigung und ihren Sinn nicht zuletzt darin, uns auf die Fragwürdigkeit der Unterscheidung zu verweisen, auf der sie beruhen.
BERT REBHANDL
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main




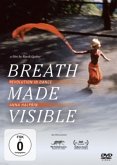

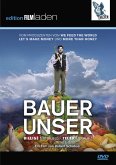


 FSK: ohne Alterseinschränkung gemäß §14 JuSchG
FSK: ohne Alterseinschränkung gemäß §14 JuSchG