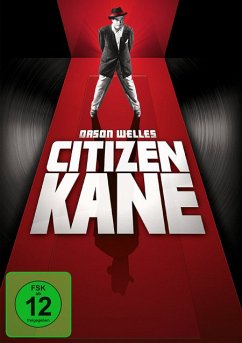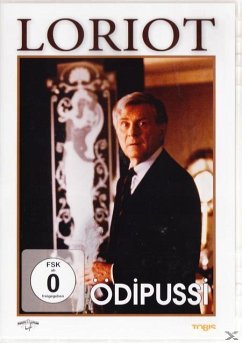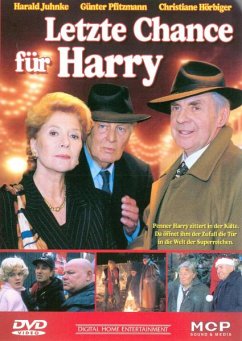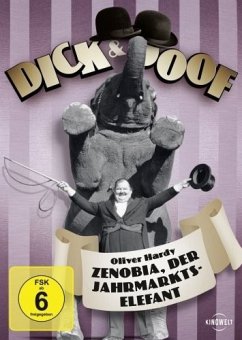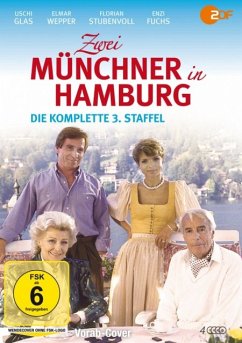Nicht lieferbar

Wenn der Vater mit dem Sohne
Nicht lieferbar
Der Musikclown Teddy Lemke (Heinz Rühmann) kümmert sich aufopfernd und liebevoll um seinen kleinen Sohn Ulli. Ulli kann Teddy dazu überreden, in einer gemeinsamen Clown-nummer bei einem Zirkus aufzutreten. Sie haben großen Erfolg, bis sie die Nachricht erreicht, dass Ullis Mutter mit ihrem neuen Ehemann aus Amerika angereist ist, um ihren Sohn zurückzuholen. Eine abenteuerliche Flucht beginnt...