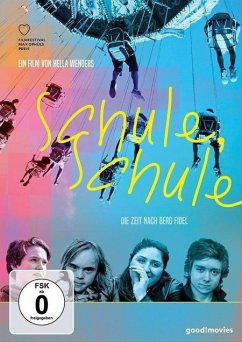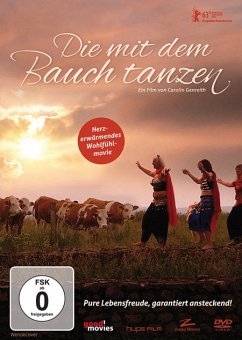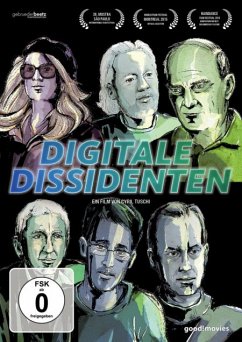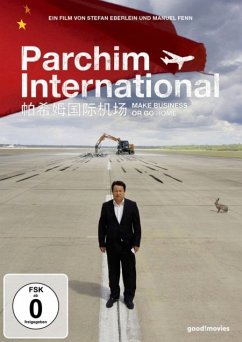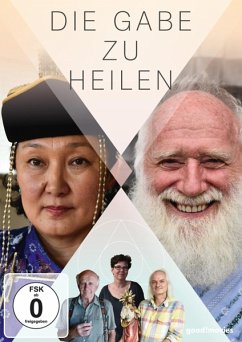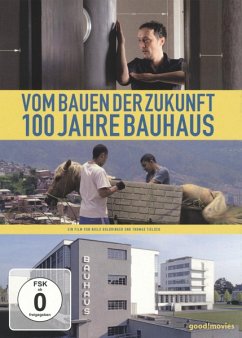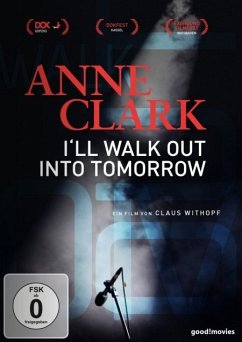Wer hat Angst vor Sibylle Berg?
Versandkostenfrei!
Versandfertig in ca. 2 Wochen
10,99 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
5 °P sammeln!
Sibylle Berg provoziert, irgendwie. Ihre Lebensgeschichte vom DDR-Flüchtling zur Bestsellerautorin klingt fast so, als hätte sie sie selbst erfunden. Früher suchte Sibylle Berg das Glück, heute sucht sie ein Haus. Im Portrait der großen ironischen Dramatikerin erfahren wir, wie die männliche Form von "Schriftsteller" lautet, warum diese auf Fotos meist ihren Kopf stützen, welche nützlichen Dinge (z.B. Eistauchen) man in der DDR lernen konnte, wie Pilze die Gehirne von Politikern steuern - und dass sich hinter jeder scheuen Schriftstellerin ein scheuer Mensch verbirgt.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.