Vor ihrem Siegeszug als Wonder Woman wurde die Amazonenprinzessin Diana zu einer unüberwindlichen Kriegerin ausgebildet. Sie wuchs in einem abgelegenen Inselparadies auf - erst von einem notgelandeten amerikanischen Piloten erfährt sie von den fürchterlichen Konflikten im Rest der Welt. Daraufhin verlässt sie ihre Heimat, weil sie überzeugt ist, dass sie der bedrohlichen Situation Herr werden kann. In dem Krieg, der alle Kriege beenden soll, kämpft Diana an der Seite der Menschen, entdeckt allmählich ihr volles Potenzial ... und ihre wahre Bestimmung.
Bonusmaterial
Extras: Die Vision der Regisseurin: Diana in der Gegenwart
"Wonder Woman 1984" sollte ein Kinohit werden, jetzt treibt der Film das Stream-Geschäft voran und stellt die Frage: Ist seine popfeministische Ästhetik überholt?
Kleine Mädchen aus Lebensgefahr retten kann jeder. Aber sie dabei gleich vor den Bauch des größtmöglichen Kuscheltiers setzen? Das kann nur Wonder Woman. Der neueste Film, durch den sie purzelt, spielt im Jahr 1984 - Aerobic, Pornoschnauzbärte, hochgekrempelte Sakkoärmel und Drecksmusik von Frankie Goes To Hollywood ("Welcome to the Pleasure Dome") beherrschen den Westen.
Mit falschen Ölquellen ("Dallas", "Denver-Clan", man erinnert sich) macht das Böse hier Geld - "Ich bin kein Betrüger, ich bin eine Fernsehpersönlichkeit!", quakt Pedro Pascal als Maxwell Lord, ergaunert sich einen magischen Stein, verwandelt sich in eine lebende Donald-Trump-Vorschau, verspricht seinem Kind: "Du wirst so stolz darauf sein, dass du mein Sohn bist!", lässt sich zum Weißen Haus fahren, zettelt einen Atomkrieg an und mobilisiert Massen, indem er ihre Träume wahr macht - sofern sie bereit sind, andere unter sich zu treten (in Anlehnung an die Redensart von den "sozial Schwachen" könnte man Lords Zielgruppe "sozial schwachsinnig" nennen).
Aufhalten kann diesen Trashteufel nur Gal Gadot alias Diana Prince, vulgo Wonder Woman. Sie tut's, indem sie seinen Fans ins Gewissen flötet - mehr Respekt vor der Wahrheit, Leute! Guter Witz: Ausgerechnet eine Superheldin verurteilt Eskapismus und plädiert für Frustrationstoleranz und "Entsagung" (Goethe). Auch das Studio, das den Film produziert hat, muss dieser Lehre folgen, nämlich einen Wunsch aufgeben: Man wollte den Film in alle Multiplexe schütten; stattdessen wurde und wird er gestreamt (F.A.Z. vom 28. Dezember 2020), in den Vereinigten Staaten auf HBO Max, in Deutschland von Donnerstag an bei "Sky Ticket" oder via Sky Q.
Bevor die überraschend mitreißend servierte Verzichtspredigt das Publikum erbauen kann, muss die Heldin allerdings selbst mit ihren Wünschen ringen: Ihr verstorbener Liebster soll wiederkommen, der Pilot Steve Trevor. Das klappt sogar, erst im falschen Schauspieler (nämlich dem wundervollen Kristoffer Polaha, im Abspann korrekt als "gutaussehender Mann" identifiziert), dann im diesmal sehr lustigen Chris Pine. Mit dem fliegt Diana durch Feuerwerk und über von unten buntgekitzelte Wolken - für so was wurde Computertricktechnik erfunden, andere Effekte des Films funzeln auf digitalen Endgeräten eher matt. Das Sehenswerteste an "Wonder Woman 1984" ist aber ohnehin Kristen Wiig, wie sie eine Kühlschranktür abreißt, dann zum Raubtier wird und alles kurz und klein kratzt, was sie zwickt. Frau Wiig spielt "Cheetah"; die ist für Wonder Woman das, was für Superman der stinkige Lex Luthor und für Batman der bekloppte Joker verkörpern: die Verneinung als solche. Patty Jenkins, Regisseurin wie schon bei "Wonder Woman" (2017), hat Wiig erlaubt, feurig vorzuführen, dass große Feindschaften Momente ebenso großer Liebe in sich tragen: Anfangs will die Katze einfach nur wie Diana sein, "stark, sexy, cool, besonders", aber sie übersieht dabei, dass es bei emanzipiertem Glamour nicht um solche Äußerlichkeiten geht, sondern um Grazie aus Seelengröße.
Ist das Popfeminismus? Zu der Zeit, in der dieser Film spielt, hießen amerikanische Spielfilmheldinnen "Silkwood" (Meryl Streep gegen die Atomindustrie, 1983) oder "Norma Rae" (Sally Field als Textilarbeiterin und Gewerkschafterin, 1979), Wonder Woman hat mit dem, was man seinerzeit "fortschrittlich" nannte, nicht viel am Schuh, nur Gal Gadot in der Hauptrolle überzeugt gleichstellungsperspektivisch - schon zum vierten Mal. Im Rollendebüt, "Batman vs. Superman" (2016), musste sie sich noch durch Muskelberge männlicher Kollegen ins Freie wühlen, ihr zweiter Auftritt war der Treffer von Jenkins, der dritte ein nur mit zusammengekniffenen Augen wahrnehmbarer Lichtblick im Debakel "Justice League" (2017). Letzteren faden Supersalat hatte der Regisseur Zack Snyder zunächst dem Grundriss nach aufgestellt, musste ihn aber wegen einer Familientragödie Joss Whedon überlassen. Dieser hatte sich dafür als Kapitän der Marvel-Schlachtschiffe "Avengers" (2012) und "Avengers: Age of Ultron" (2015) qualifiziert und galt als einer der führenden Stilingenieure des Genres, außerdem aber seit seiner Fernsehserie "Buffy, The Vampire Slayer" (1997 bis 2003) auch als eine der deutlichsten Stimmen des Feminismus, Antirassismus und überhaupt humanistischen Gerechtigkeitssinns in der Filmbranche. Menschlich scheint das nicht gedeckt zu sein: Der schwarze "Justice League"-Darsteller Ray Fisher, die "Buffy"-Veteranin Charisma Carpenter und zuletzt eine wachsende Anzahl anderer haben glaubhaft berichtet, dass der unbestritten herausragende Autor und Filmemacher Whedon als Boss ein hässlicher Machtsack sei, der mit Menschen umspringt, als wären sie zu seiner Belustigung da. Lernen sollte man hier wohl, dass der Feminismus nicht den Männern, der Antirassismus nicht den Weißen und überhaupt die fürsorgliche Betreuung von allerlei Minderheitenrechten nicht unsereins redegewandten Meinungsperformern gehört. Institutionen müssen her, die Schikanen durch Ermächtigung der andernfalls bloß mildtätig (und manchmal eben mies) Betreuten vorbeugen. Whedons künstlerische Leistungen tilgt sein Verhalten nicht, aber das reputationspolitische Sorgerecht für seine ästhetischen Kinder hat er verspielt; es steht jetzt allein denen zu, die er dafür leiden ließ, dass sie ihm dabei halfen, utopisch-idealistische Kunst zu machen.
Idealismus ist für Kunst stets dünne Luft, wie Nostalgie für sie stickige ist; es soll aber Menschen geben, die sich absichtlich in Atemnot begeben, weil das berauscht. "Wonder Woman 1984" jongliert mit Nostalgie und Idealen zugleich, bebildert den Einfall: "Früher war nicht alles besser, aber heute wäre alles besser, wenn wir früher wacher gewesen wären." Die interessantesten Versuche in solchen Tonfällen findet man derzeit bekanntlich eher im Serienformat als im Spielfilm, weil mehr Erzählzeit die (nicht immer genutzte) Chance zu mehr Tiefe bietet; man denke an "Stranger Things", das deutsche "Dark" oder die wohl klügste kulturindustrielle Archivübung der letzten fünfundzwanzig Jahre, "Halt and Catch Fire".
Das Superheldenkinogenre steht nicht für solche Subtilitäten, sondern wie kein anderes massenmediales Zerstreuungsangebot für einen popkulturellen Weltwachstumsmarkt, der bis Anfang 2020 unter Expansionsdampf wuchs. "Wonder Woman 1984", eine Produktion der Vorpandemiezeit, kommt verschleppt auf die Welt; vieles an ihren Voraussetzungen ist von gestern, zum Beispiel Hans Zimmers übergewichtige Musik und die unterkoordinierten Massenszenen. Die Grundidee ("Ist Trump nicht eigentlich ein Achtziger-Phänomen?") und das an ihr ausprobierte Vermögen des Genres, Ungleichzeitigkeiten aufeinander loszulassen wie Gladiatoren, retten den Film aber vor der Belanglosigkeit, und fürs Herz gibt's Flauschwerte - wenn Gal Gadot weint, quietscht die Erde, und dass Lynda Carter, die Original-Wonder-Woman-Schauspielerin aus Opas Fernsehen, kurz ins Geschehen zwinkern darf, vermittelt eine sehr wichtige Moral der Medienkompetenz: Solange wir als Menschen genügend Erzählplattformen haben, geht unser Vermögen, uns zu besinnen, zu korrigieren und zu läutern, nicht kaputt.
Zwar muss also die Heldin im Film ihren Liebsten 1984 aufgeben, aber das Archiv weiß, dass sie ihn im Comic schon zwei Jahre später wiederkriegt und sogar heiraten darf. Danach bricht indes das Universum zusammen; aber davon ein andermal mehr.
DIETMAR DATH
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

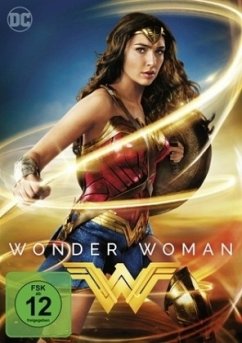







 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG