
Eine schlummernde Frau, der Kopf ganz nah im Halbprofil. Ein lästiger Klingelton, zerwühlte Haare, ein vom Schlaf zerknittertes Gesicht, das nach dem Telefonat noch zerknitterter aussehen wird. Es gehört Marion Cotillard, und so ungeschminkt und unglamourös hat man sie selten gesehen. Aber Glamour ist auch keine Eigenschaft jener Welt, welche die Filme der belgischen Brüder Jean-Pierre und Luc Dardenne seit fast zwei Jahrzehnten erkunden. In Seraing in der Provinz Lüttich, wo die beiden herkommen, sind die Leute froh, wenn sie überhaupt Arbeit haben, und sobald sie ihren Job verlieren, ist der soziale Absturz nahezu irreversibel.
Marion Cotillard spielt Sandra. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in einem kleinen Haus, sie ächzen unter den monatlichen Raten. Sandra war wegen Depressionen eine Weile arbeitsunfähig. In ihrer Firma, in der Solarzellen hergestellt werden, hat man während ihrer Abwesenheit festgestellt, dass es auch ohne Sandra und mit ein paar Überstunden für die anderen geht. So wurden die sechzehn Mitarbeiter vor eine Wahl gestellt, deren Alternative schon das gewünschte Ergebnis vorwegnahm: eine einmalige Prämie von tausend Euro für jeden oder Sandras Weiterbeschäftigung.
Das Ergebnis der Wahl erfährt Sandra in der ersten Szene per Telefon, sie ist am Boden zerstört und von ihrem Mann und zwei Kollegen nur mühsam davon zu überzeugen, dass es sich um eine Wiederholung der Abstimmung und die Umstimmung der Kollegen zu kämpfen lohnt. Auf diese Weise bekommt der Film seinen Titel und der Plot seine Struktur: "Zwei Tage, eine Nacht". Ein Wettlauf gegen die Zeit, eine fortwährende Anstrengung, das Schamgefühl zu überwinden und die Rolle der Bittstellerin einzunehmen, bis am Montagmorgen die Entscheidung fällt. So zieht Sandra von Haus zu Haus.
Und während sie einen herumdrucksenden Heimwerker neben seiner schmallippigen Ehefrau erlebt, einen Sohn, der seinen Vater schlägt, einen Mann, der nebenher noch schwarzarbeitet, während sich eine Kollegin verleugnen lässt und ein Kollege vor Scham in Tränen ausbricht - während dieser für beide Seiten peinigenden Tour entfalten sich vor uns genau abschattierte Ansichten einer sozialen Lebenswelt samt Freizeitgewohnheiten, Inneneinrichtungen und Gemütslagen. Und wenn, laut Godard, jede Kameraeinstellung eine Frage der Moral ist, dann steht hier die Kamera der Protagonistin zur Seite, ohne einseitig ihre Partei zu ergreifen. So werden aus Einblicken zugleich Einsichten, aus der Genauigkeit des Blicks lässt sich nüchterne Anteilnahme herauslesen, aber kein Urteil und keine "Lösung".
Genau deshalb hat auch die implizite Frage, welche der Film an uns alle richtet, nicht diesen ausgeleierten ideologisch verzerrten Klang: Was könnte das heute noch sein, Solidarität unter abhängig Beschäftigten? Gemeinsame Interessen statt sturen Beharrens auf partikulare Forderungen? Man muss keine Antwort haben, um die Dringlichkeit der Frage zu begreifen. (pek)
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main


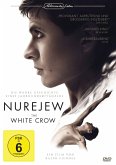

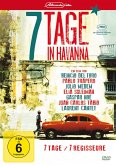

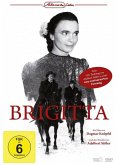


 FSK: Freigegeben ab 6 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 6 Jahren gemäß §14 JuSchG