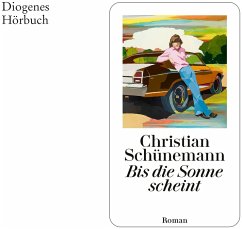Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke / Alle Toten fliegen hoch Bd.3 (MP3-Download)
Live. Ungekürzte Lesung. 720 Min.
Sprecher: Meyerhoff, Joachim
Sofort per Download lieferbar
23,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
12 °P sammeln!
Anrührend, tieftraurig und zum Brüllen komisch Zu seiner eigenen Überraschung wird Joachim Meyerhoff auf der Schauspielschule in München angenommen und zieht in die großbürgerliche Villa seiner Großeltern ein. Tagsüber wird er an der Schauspielschule in seine Einzelteile zerlegt, abends ertränkt er seine Verwirrung auf opulenten Möbeln in diversen Alkoholika. Aus dem Kontrast zwischen großelterlichem Irrsinn und ausbildungsbedingtem Ich-Zerfall entstehen Situationen, die den Erzähler oft überfordern und seinen Zuhörern Lach- und Rührungstränen in die Augen treiben. Leidenschaft...
Anrührend, tieftraurig und zum Brüllen komisch Zu seiner eigenen Überraschung wird Joachim Meyerhoff auf der Schauspielschule in München angenommen und zieht in die großbürgerliche Villa seiner Großeltern ein. Tagsüber wird er an der Schauspielschule in seine Einzelteile zerlegt, abends ertränkt er seine Verwirrung auf opulenten Möbeln in diversen Alkoholika. Aus dem Kontrast zwischen großelterlichem Irrsinn und ausbildungsbedingtem Ich-Zerfall entstehen Situationen, die den Erzähler oft überfordern und seinen Zuhörern Lach- und Rührungstränen in die Augen treiben. Leidenschaftlich live gelesen vom Autor (9 CDs, Laufzeit: 11h 15)
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.