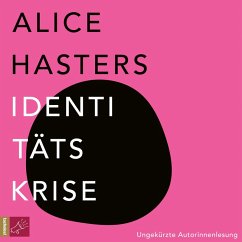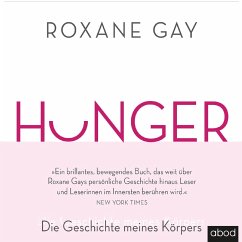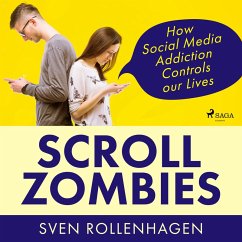Alles und nichts sagen (MP3-Download)
Vom Zustand der Debatte in der Digitalmoderne Ungekürzte Lesung. 287 Min.
Sprecher: Menasse, Eva
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
8,49 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
4 °P sammeln!
Zieht sich eine liberale Gesellschaft gerade den Boden weg, auf dem sie fest stehen sollte? Ein Essay darüber, was die digitale Massenkommunikation zwischenmenschlich anrichtet.
Nichts hat das Zusammenleben so umfassend verändert wie die Digitalisierung - wir denken, fühlen und streiten anders, seit wir dauervernetzt und überinformiert sind. Demokratiepolitisch bedeutsam wird dies bei der vielbeschworenen Debattenkultur. Denn die Umgangsformen der sogenannten Sozialen Medien haben längst auf die anderen Arenen übergegriffen, Politik und Journalismus spielen schon nach den neue...
Zieht sich eine liberale Gesellschaft gerade den Boden weg, auf dem sie fest stehen sollte? Ein Essay darüber, was die digitale Massenkommunikation zwischenmenschlich anrichtet.
Nichts hat das Zusammenleben so umfassend verändert wie die Digitalisierung - wir denken, fühlen und streiten anders, seit wir dauervernetzt und überinformiert sind. Demokratiepolitisch bedeutsam wird dies bei der vielbeschworenen Debattenkultur. Denn die Umgangsformen der sogenannten Sozialen Medien haben längst auf die anderen Arenen übergegriffen, Politik und Journalismus spielen schon nach den neuen, erbarmungsloseren Regeln. In ihrem Hörbuch kreist Eva Menasse um die Fragen, die sie seit vielen Jahren beschäftigen: vor allem um einen offenbar hoch ansteckenden Irrationalismus und eine ätzende Skepsis, vor denen niemand gefeit ist.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.