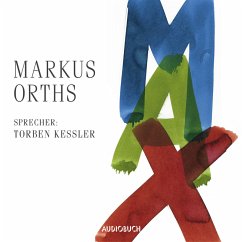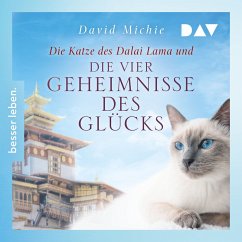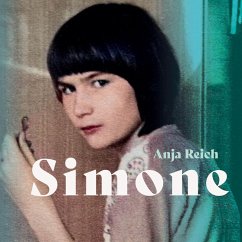Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 426 Min.
Sprecher: Präkels, Manja

PAYBACK Punkte
6 °P sammeln!
Mimi und Oliver sind Nachbarskinder in einer kleinen Stadt an der Havel. Sie spielen Fußball miteinander, leisten den Pionierschwur und berauschen sich auf Familienfesten heimlich mit den Schnapskirschen der Eltern. Mit dem Mauerfall zerbricht auch ihre Freundschaft. Mimi sieht sich als der letzte Pionier – Timur ohne Trupp. Oliver wird unter dem Kampfnamen Hitler zu einem der Anführer marodierender Jugendbanden. In Windeseile bringen seine Leute Straßen und Plätze unter ihre Kontrolle. Dann eskaliert die Situation vollends …
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.




 buecher-magazin.de"Wir hatten gegeneinander gekämpft, ohne uns dabei je direkt gegenübergestanden zu haben. Und als wir uns - Jahre später - trafen, Veteranen nunmehr, Kriegsbeobachter, bekam ich keine Beleidigung, keine Demütigung, keinen Schlag auf den Kopf, nicht seinen Hass - nur seine Nummer. Für den Fall, dass ich etwas Haschisch bräuchte." So führt Manja Präkels Ich-Erzählerin Mimi den Jungen ein, den irgendwann alle Hitler nannten. Den Nachbarsjungen, mit dem sie sich heimlich mit Schnapskirschen besoff. Das Paradies, in dem Mimi aufwächst, ist vielfach gebrochen: Während ihre Mutter die Freundschaft zur Sowjetunion beschwört, schimpfen die Werktätigen auf die "Russenschweine" und "scheiß Neger". Die "Klassenkloppe" in der Schule endet für manche im Krankenhaus. Mimi ist 16, als die Mauer fällt. Die Jugendlichen drehen frei. Ressentiments entladen sich in Hetzjagden auf Ausländer, Punks, Gruftis, Hippies und Homosexuelle. Hitler avanciert zum Anführer der örtlichen Neonazis. Mimi und ihre Freunde tanzen, trinken und fliehen. Einer von ihnen wird totgetreten. Manja Präkels lässt uns die Angst auf allen Seiten spüren. Sie erzählt pointiert, auch wenn ihre Sprache mitunter formelhaft wirkt. Dieses Buch ist mitreißend und schmerzhaft aktuell.
buecher-magazin.de"Wir hatten gegeneinander gekämpft, ohne uns dabei je direkt gegenübergestanden zu haben. Und als wir uns - Jahre später - trafen, Veteranen nunmehr, Kriegsbeobachter, bekam ich keine Beleidigung, keine Demütigung, keinen Schlag auf den Kopf, nicht seinen Hass - nur seine Nummer. Für den Fall, dass ich etwas Haschisch bräuchte." So führt Manja Präkels Ich-Erzählerin Mimi den Jungen ein, den irgendwann alle Hitler nannten. Den Nachbarsjungen, mit dem sie sich heimlich mit Schnapskirschen besoff. Das Paradies, in dem Mimi aufwächst, ist vielfach gebrochen: Während ihre Mutter die Freundschaft zur Sowjetunion beschwört, schimpfen die Werktätigen auf die "Russenschweine" und "scheiß Neger". Die "Klassenkloppe" in der Schule endet für manche im Krankenhaus. Mimi ist 16, als die Mauer fällt. Die Jugendlichen drehen frei. Ressentiments entladen sich in Hetzjagden auf Ausländer, Punks, Gruftis, Hippies und Homosexuelle. Hitler avanciert zum Anführer der örtlichen Neonazis. Mimi und ihre Freunde tanzen, trinken und fliehen. Einer von ihnen wird totgetreten. Manja Präkels lässt uns die Angst auf allen Seiten spüren. Sie erzählt pointiert, auch wenn ihre Sprache mitunter formelhaft wirkt. Dieses Buch ist mitreißend und schmerzhaft aktuell.