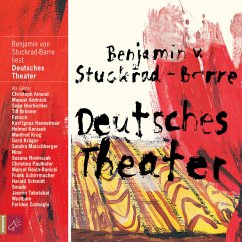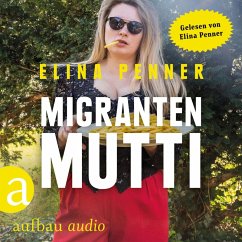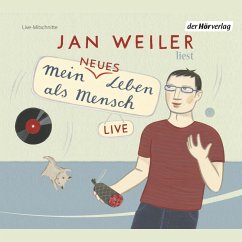Auch Deutsche unter den Opfern (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 147 Min.
Sprecher: Stuckrad-Barre, Benjamin von; Ulmen, Christian
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
12,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
6 °P sammeln!
Wahlkampf, Streik, Demonstrationen, Konsum, Fußball, Kino, Musik, Religion, Medizin, Mode,
Stadtleben, Überlandfahrten. Politik, Kultur, Gesellschaft.
Mit seinem Verfahren der teilnehmenden Beobachtung findet Stuckrad-Barre Momente der
Wahrheit inmitten von Vorgängen, die genau diese verschleiern sollen. Und so entsteht aus
vielen Einzelbeobachtungen ein deutscher Klappaltar, aus vielen Texten eine Großerzählung,
archäologisch blicken wir auf unsere Gegenwart: Das sind die Fragen, Personen und Orte, die
uns bewegen - das sind die Bedingungen, unter denen wir...
Wahlkampf, Streik, Demonstrationen, Konsum, Fußball, Kino, Musik, Religion, Medizin, Mode,
Stadtleben, Überlandfahrten. Politik, Kultur, Gesellschaft.
Mit seinem Verfahren der teilnehmenden Beobachtung findet Stuckrad-Barre Momente der
Wahrheit inmitten von Vorgängen, die genau diese verschleiern sollen. Und so entsteht aus
vielen Einzelbeobachtungen ein deutscher Klappaltar, aus vielen Texten eine Großerzählung,
archäologisch blicken wir auf unsere Gegenwart: Das sind die Fragen, Personen und Orte, die
uns bewegen - das sind die Bedingungen, unter denen wir leben.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.