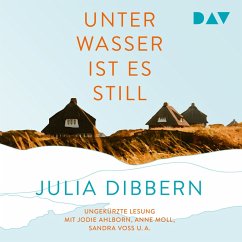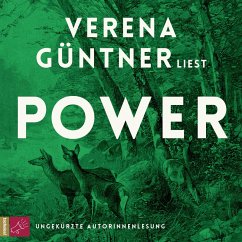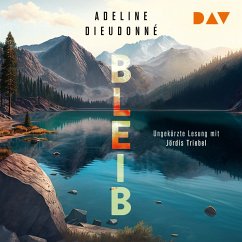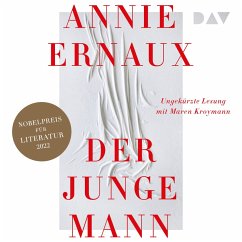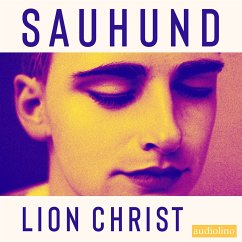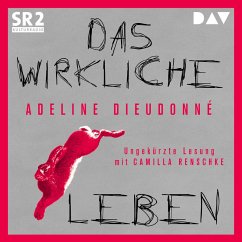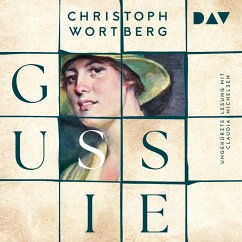Julia Phillips
Hörbuch-Download MP3
Cascadia (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 458 Min.
Sprecher: Ferydoni, Pegah / Übersetzer: Pociao,; Hollanda, Roberto de

PAYBACK Punkte
8 °P sammeln!





Auf einer Insel im Nordwesten der USA lebt Sam mit ihrer Schwester Elena und der schwerkranken Mutter in ärmlichen Verhältnissen. Sam arbeitet auf der Fähre, die die wohlhabenden Urlauberinnen und Urlauber zu ihren Feriendomizilen bringt, während Elena im Golfclub kellnert. Sie beide träumen von einem besseren Leben, davon, woanders neu anzufangen. Dann, eines Nachts, erblickt Sam einen Bären, der durch die dunklen Gewässer vor der Küste schwimmt. Noch kann sie nicht ahnen, dass das wilde Tier die Welt der beiden Schwestern völlig aus den Angeln heben und ihren lang gehegten Traum in ...
Auf einer Insel im Nordwesten der USA lebt Sam mit ihrer Schwester Elena und der schwerkranken Mutter in ärmlichen Verhältnissen. Sam arbeitet auf der Fähre, die die wohlhabenden Urlauberinnen und Urlauber zu ihren Feriendomizilen bringt, während Elena im Golfclub kellnert. Sie beide träumen von einem besseren Leben, davon, woanders neu anzufangen. Dann, eines Nachts, erblickt Sam einen Bären, der durch die dunklen Gewässer vor der Küste schwimmt. Noch kann sie nicht ahnen, dass das wilde Tier die Welt der beiden Schwestern völlig aus den Angeln heben und ihren lang gehegten Traum in Gefahr bringen wird.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Julia Phillips, geboren 1988, lebt mit ihrer Familie in Brooklyn, New York. Ihr gefeiertes Debüt Das Verschwinden der Erde (2021) war ein SPIEGEL-Bestseller. Die Autorin schreibt u.a. für die New York Times, The Atlantic und The Paris Review und unterrichtet am Randolph College.
Produktdetails
- Verlag: Der Audio Verlag
- Erscheinungstermin: 22. Juli 2024
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783742432810
- Artikelnr.: 71165174
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Den Begriff Slow Burn für eine sukzessive zunehmende Spannung kennt Rezensent Bernhard Heckler eher von Netflix, aber für den neuen Roman von Julia Philipps passt diese Beschreibung auch sehr gut: Die Schwestern Sam und Elena werden von der Pflege der Mutter auf einer isolierten Insel zusammengehalten, ein Grizzlybär drängt sich in das Familienleben. Eine der Schwestern hat Angst vor ihm, die andere findet ihn faszinierend, erfahren wir, die Mutter stirbt und eigentlich wären die Schwestern nun nicht länger gezwungen, auf dieser Insel festzusitzen. Dass es dazu aber nicht kommt, so viel verrät Heckler, sorgt für die lichterlohen Flammen im Slow Burn. Ihn erinnert die Geschichte an die düsteren Grimm-Märchen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Ein nachbrennender Roman mit furioser Schlusspointe. Cascadia ist ein Grimm-Märchen der harten Sorte." Bernhard Heckler, Süddeutsche Zeitung, 03.09.2024 "Familiendrama mit Bestie: 'Cascadia' wirft eine ganze Reihe von Fragen auf. Fragen von Verantwortung für das eigene Leben und für das Leben anderer, von gesellschaftlicher Teilhabe und persönlicher Schuld, Fragen von emotionaler Zugehörigkeit auf vielen Ebenen des Daseins, während sich auf der erzählerischen Oberfläche ein packendes Familiendrama abspielt." Katharina Granzin, Frankfurter Rundschau, 23.07.2024 "Julia Phillips versteht es, in einer leisen, poetisch eindringlichen Sprache eine Geschichte zu erzählen, die tragische Wendungen beinhaltet. Dabei liefert sie aufwühlende Einblicke
Mehr anzeigen
in eine Welt heikler und komplizierter Lebensverhältnisse. Ein spannender Roman über die Vielschichtigkeit und Schwierigkeit menschlicher Beziehungen, ein überaus bewegendes Buch." Norbert Striemann, Radio Mülheim, 21.07.2024 "Julia Phillips baut ihren neuen Roman auf Motiven eines Grimmschen Märchens auf, um auf dieser trügerischen Folie ein vielschichtiges Familien- und Sozialdrama zu erzählen, atmosphärisch und eindrücklich. Grandios!" BücherMagazin, 6/2024 "Ein stimmungsvoller Roman über Familie, Zusammenhalt und die Wildnis in uns." Tanja Reuschling, Flow, 15.10.2024 "Man kann diesen Roman als Parabel auf den Einbruch einer natürlichen Urgewalt wie die Coronapandemie lesen, als familiäre Beziehungsgeschichte und unterschiedliche Lebensentwürfe, als Mystery-Story oder einfach als Märchen. Ein bewegender und atmosphärisch dichter Roman." Karin Waldner-Petutschnig, Kleine Zeitung (A), 17.08.2024 "Julia Phillips legt mit der Sachlichkeit der unbeteiligten Beobachterin offen, wie eine symbiotische Schwesternbeziehung auseinanderdriftet. Schnell werden Brüche im System sichtbar und am Ende ist 'Cascadia' auch die Geschichte eine Befreiung." Ruth Bender, Leipziger Volkszeitung, 13.10.2024 "Julia Phillips verwebt meisterhaft harte soziale Realität mit Märchen und Magie: Ein spannender Roman." Angela Wittmann, Brigitte, 09.10.2024 "Sozialkritik, Naturstudie, schwesterliches Beziehungsdrama oder doch Horrorstory? Ist der Bär gar eine Metapher? Einen simplen Aha-Moment gibt es nicht. Das Ende kommt jedenfalls ziemlich überraschend." Barbara Beer, Kurier (A), 21.07.2024 "Ein Roman über die Faszination und den Schrecken der Wildnis." Focus, 13.09.2024 "Angelehnt an das Märchen 'Schneeweißchen und Rosenrot' werden prekäre Arbeit und teure Sozialleistungen in den USA kritisiert. Aktuell!" Thomas Schürmann, HÖRZU & Gong, 26.07.2024 "Eine berührende Schwesterngeschichte und eine Erzählung über die gesellschaftliche und politische Situation in den USA, die durch einen Bären mysteriös und unerklärlich bleibt. Das macht den Reiz des Buches aus." Martin Gaiser, Radio freeFM (Ulm) »Freunde reden Tacheles«, 09.08.2024 "Ein wunderschöner Roman mit einem unerwarteten, atemberaubenden Ende, das einem den Boden unter den Füßen wegreißt." Detlef Knut, Buchtips.net, 30.09.2024 "Die mit dem 'National Book Award' (US) ausgezeichnete Autorin fesselt mit 'Cascadia', ihrem klugen und verführerischen zweiten Roman nach Das 'Verschwinden der Erde'." Publishers Weekly
Schließen
Gebundenes Buch
Die Schwestern Samantha und Elena leben auf einer Insel im Nordwesten der USA in ärmlichen Verhältnissen. Die Mutter der jungen Frauen ist todkrank, das Geld knapp, die Schulden wachsen, und einzig der Gedanke daran, nach dem Tod der Mutter durch den Verkauf des Hauses nebst riesigem …
Mehr
Die Schwestern Samantha und Elena leben auf einer Insel im Nordwesten der USA in ärmlichen Verhältnissen. Die Mutter der jungen Frauen ist todkrank, das Geld knapp, die Schulden wachsen, und einzig der Gedanke daran, nach dem Tod der Mutter durch den Verkauf des Hauses nebst riesigem Grundstück genug Geld zu haben, um weggehen und woanders neu anfangen zu können, gibt Sam und Elena Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Als ein Bär auf der Insel auftaucht, ahnen beide nicht, welchen Einfluss das wilde Tier auf ihr Leben haben wird.
„Das Glück würde ihr ständiger Begleiter sein und alles andere von ihnen abfallen, aber Sam würde diesen Zustand niemals unbeschadet erreichen, wenn sie nicht auf der Stelle anfing, sich die Gelassenheit ihrer Schwester anzueignen. Sie hatten einen Plan. Sie würden von hier wegziehen. Nur das zählte. Alles andere, das Schreckliche und das Wunderbare, ließ sich ertragen.“ (Seite 78)
Die zwei Schwestern hätten nicht unterschiedlicher sein können, denn obwohl nur ein wenig mehr als ein Jahr zwischen ihnen lag, kristallisierte sich ganz klar heraus, welche erwachsen und welche von ihnen in der Reife zurückgeblieben war. Die Last und Bürde der einen, war der Kopf in den Wolken der anderen. Anfangs war mir das gar nicht bewusst, aber je weiter die Erzählung vorangeschritten ist, desto mehr fühlte ich mich mit einer der Schwestern solidarisch und tat mich schwer mit Handlungen der anderen. Ich war selbst erschrocken, welche Emotionen in mir hochkochten, verstand nicht immer, wie es sein konnte, dass ich so empfand.
Diese Geschichte lässt mich tief berührt zurück. Ich habe nicht erwartet, welche Wendung sie nehmen würde, war überrascht von den Ereignissen und erstaunt, wie sich alles entwickelt hat. Was da ans Licht kam, traf nicht nur mich, die folgenden Geschehnisse wirbelten alles durcheinander, erklärten im Nachhinein einige Unklarheiten und beantworten Fragen, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gab. Unausweichlich steuerten wir alle auf einen Abgrund zu, mein Magen schlug Purzelbäume und ich hielt den Atem an, war versucht, vorzublättern, um vorbereitet zu sein auf das, was da noch kam. Die Auflösung war emotional, anders als gedacht und ich schloss das Buch mit dem Gefühl, eine märchenhafte Reise beendet zu haben. Tragisch und wunderbar.
Weniger
Antworten 5 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 5 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Die sanften Farben des Buchcovers passen gut zur ruhigen Erzählweise der Geschichte. Doch dahinter verbirgt sich mehr, als man auf den ersten Blick vermuten würde.
Die Schwestern Sam und Elena wohnen mit ihrer kranken Mutter in einem kleinen Haus auf einer Insel im Nordwesten der USA. …
Mehr
Die sanften Farben des Buchcovers passen gut zur ruhigen Erzählweise der Geschichte. Doch dahinter verbirgt sich mehr, als man auf den ersten Blick vermuten würde.
Die Schwestern Sam und Elena wohnen mit ihrer kranken Mutter in einem kleinen Haus auf einer Insel im Nordwesten der USA. Sie leben in ärmlichen Verhältnissen und müssen in schlecht bezahlten Jobs arbeiten, um die vielen Arztrechnungen ihrer Mutter und die Hypothek für das Haus bezahlen zu können.
Es ist ein hartes Leben und Sam träumt davon wegzugehen und ein besseres Leben zu führen. Sie liebt ihre große Schwester Elena, die sich immer um sie und die Familie gekümmert hat, und schaut bewundernd zu ihr auf. Die Schwestern sind sehr unterschiedliche Charaktere, was im Laufe des Buches immer deutlicher wird.
Die Geschichte wird lediglich aus einer Perspektive erzählt. Mir hätte es gut gefallen, auch Elenas Sichtweise kennenzulernen, da sie manchmal recht blass und unnahbar blieb. Aber vielleicht war es auch gerade das, was die Autorin mit dieser Entscheidung erreichen wollte.
Es ist mir schwergefallen für Sam Verständnis und Sympathie aufzubringen. Sie verhält sich impulsiv und irrational, während sie die meiste Zeit in ihrer eigenen Gedankenwelt verbringt und keine Verantwortung übernehmen will.
Ich wusste nicht, was ich von der Figur des Bären in der Geschichte erwartet hatte, aber die Autorin hat mich definitiv (vor allem mit dem Ende) überrascht. Die Begegnungen mit dem wilden Tier wirkten surreal und leicht verstörend. Bis zum Schluss hat mich das Buch etwas ratlos zurückgelassen. Es wird ruhig erzählt, doch die Geschehnisse entwickeln einen Sog, der mich mitgerissen und neugierig gemacht hat.
Insgesamt eine interessante, aber auch sonderbare Geschichte. Die Charaktere blieben unnahbar und wirkten oft unsympathisch. Die Beschreibungen des Alltags und der Umgebung haben mir gut gefallen. Die Entwicklungen mit dem Bären und das Ende haben mich ein wenig irritiert zurückgelassen. Irgendwie wurde ich bis zur letzten Seite das Gefühl nicht los, dass sich unter der Oberfläche mehr verbarg, zu dem ich aber leider keinen richtigen Zugang finden konnte.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
eBook, ePUB
Sam und Elena sind in einer schwierigen finanziellen Situation. Sie haben viele Schulden und müssen zusätzlich ihre kranke Mutter pflegen. Die beiden haben sich darauf geeinigt, dass sie von dem Ort weg wollen, sobald ihre Mutter verstorben ist, da sie sich hier kein lebenswertes Leben …
Mehr
Sam und Elena sind in einer schwierigen finanziellen Situation. Sie haben viele Schulden und müssen zusätzlich ihre kranke Mutter pflegen. Die beiden haben sich darauf geeinigt, dass sie von dem Ort weg wollen, sobald ihre Mutter verstorben ist, da sie sich hier kein lebenswertes Leben führen können. Doch ein einziger Bär kann alles verändern.
Ich muss sagen, dass ich keinen der Charaktere wirklich mochte. Ich konnte keine wirkliche Bindung zu ihnen aufbauen, da ich ihr Verhalten meist nicht nachvollziehen konnte.
Das Buch behandelt verschiedene bedrückende Themen, wie Einsamkeit, Verlust und Hoffnungslosigkeit. Sam fühlt sich von Elena hintergangen und fühlt sich allein. Elena empfindet, dass man sie als selbstverständlich ansieht und hat durch den Bären das Gefühl richtig zu leben. Die Zerrissenheit der beiden Charaktere hat mir gut gefallen.
Ich muss sagen, dass der Bär für mich zu oft vorgekommen ist. Ich verstehe seine Rolle und das er für Elena ein Hoffnungsschimmer gewesen ist, jedoch hätte man einige Momente entfernen können.
Das Buch beinhaltet Anspielungen auf Schneeweißchen und Rosenrot, was ich interessant finde, da dieses Märchen nicht so häufig adaptiert wird.
Der Schreibstil ist nicht schlecht und man kann das Buch angenehm lesen, jedoch hatte ich Probleme, an der Geschichte dran zu bleiben, da es keine wirkliche Spannung gibt. Erst im letzten Drittel kam bei mir Spannung auf.
Das Cover finde ich schön und es passt gut zur Geschichte und zu der Stimmung, die in dieser herrscht.
Ich kann das Buch denen empfehlen, die sich nicht von abstrusen Geschichten abschrecken lassen, die nicht immer sehr realitätsgetreu sind. Auch wenn man Bücher mag, die gelungen Emotionen übermitteln können, könnte man das Buch mögen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Toll!
Dieses Buch entführt den Leser in eine raue, aber zugleich wunderschöne Landschaft, die die perfekte Kulisse für die tiefgründige Geschichte von Sam und Elena bietet. Die beiden Schwestern, die im Mittelpunkt der Erzählung stehen, sind außergewöhnlich gut …
Mehr
Toll!
Dieses Buch entführt den Leser in eine raue, aber zugleich wunderschöne Landschaft, die die perfekte Kulisse für die tiefgründige Geschichte von Sam und Elena bietet. Die beiden Schwestern, die im Mittelpunkt der Erzählung stehen, sind außergewöhnlich gut beschrieben. Man spürt förmlich die enge Bindung zwischen ihnen, die von Liebe, aber auch von stillen Konflikten geprägt ist. Die Autorin schafft es meisterhaft, ihre Träume, Ängste und Hoffnungen in eindrucksvollen Bildern einzufangen.
Besonders hervorzuheben ist der angenehm fließende Schreibstil der Autorin, der es leicht macht, in die Geschichte einzutauchen und sich mit den Charakteren zu identifizieren. Ohne große Worte wird die Dramatik des Alltags der beiden Schwestern greifbar gemacht. Der unvorhergesehene Wendepunkt, symbolisiert durch den Bären, bringt eine Spannung in die Geschichte, die den Leser bis zur letzten Seite fesselt.
Insgesamt ist dies ein tiefgründiger, atmosphärischer Roman, der die Themen Familie, Träume und die harte Realität des Lebens auf eine sehr einfühlsame Weise behandelt. Eine absolute Leseempfehlung!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Cascadia – Julia Phillips
Zwei Schwestern auf einer Insel im Nordwesten der USA, die sich seit Jahren aufopferungsvoll um ihre schwerkranke Mutter kümmern. Sam und Elena halten sich mit schlecht bezahlten Jobs im Touristiksektor über Wasser, doch das Geld reicht hinten und vorne …
Mehr
Cascadia – Julia Phillips
Zwei Schwestern auf einer Insel im Nordwesten der USA, die sich seit Jahren aufopferungsvoll um ihre schwerkranke Mutter kümmern. Sam und Elena halten sich mit schlecht bezahlten Jobs im Touristiksektor über Wasser, doch das Geld reicht hinten und vorne nicht. Nur der Traum von einem besseren Leben bringt die beiden durch die Tage, Wochen,…. Eines Tages taucht ein Bär auf der Insel auf und droht alles durcheinander zu bringen.
Jede der Schwestern hat eine ganz eigene Sicht auf das wilde Tier. Während Sam den Bären zunehmend als Bedrohung wahrnimmt, scheint Elena ganz andere Dinge in ihn hineinzuprojizieren. Und so reißt das Auftauchen des Tieres die jungen Frauen aus ihrem Alltagstrott und zwingt sie, einen neuen Blick auf ihr Leben und ihre Träume zu werfen.
Eine fesselnde Geschichte, die ihre Symbolkraft erst gegen Ende des Romans entfaltet. Gerade den Mittelteil fand ich teilweise ein wenig zäh, mit sehr vielen Bärenbegegnungen und hin und her zwischen den Schwestern. Erst ganz zum Schluss werden einige Dinge klarer und trotz allem fand ich das Ende rund und passend, allerdings auch sehr zum Nachdenken anregend.
Sprachlich kommt dieser Roman eher unauffällig, aber angenehm daher. Ich habe die Lektüre sehr genossen.
Eine tiefgründige, symbolträchtige Geschichte, auf die man sich einlassen muss. 4 Sterne.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Ein ganz ruhiger Roman über 2 Schwestern, die zusammen mit ihrer schwerkranken Mutter leben. Sie leben sehr einfach und haben Schwierigkeiten finanziell über die Runden zu kommen. In ihrem Job haben sie mit nörgelnden Touristen zu tun, die sie eigentlich gar nicht wahrnehmen.
Als …
Mehr
Ein ganz ruhiger Roman über 2 Schwestern, die zusammen mit ihrer schwerkranken Mutter leben. Sie leben sehr einfach und haben Schwierigkeiten finanziell über die Runden zu kommen. In ihrem Job haben sie mit nörgelnden Touristen zu tun, die sie eigentlich gar nicht wahrnehmen.
Als der Bär vor ihrer Tür steht sind beide erstmal ganz schön durcheinander. Während Elena von dem wilden Tier fasziniert ist, hat Sam große Angst. Hier wird dann auch recht klar wie unterschiedlich die Schwestern sind. Was dieses Ereignis mit den beiden macht lesen wir in diesem Roman.
Julia Phillips schreibt sehr atmosphärisch und ruhig. Das Setting ist toll und das Leben auf der Insel wurde gut beschrieben. Hier gibt es sehr viel Interpretationsspielraum. Ich denke jeder wird hier für sich seine Schlüsse ziehen können. Es lies sich gut lesen, war aber kein Highlight für mich.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Perfekt für Lesekreise
Ein außergewöhnlicher Roman über zwei in Armut lebende Schwestern, der vom Märchen "Schneeweißchen und Rosenrot" inspiriert ist. Es ist sicherlich kein Roman für Leser:innen, die in ihren Büchern alles ausführlich …
Mehr
Perfekt für Lesekreise
Ein außergewöhnlicher Roman über zwei in Armut lebende Schwestern, der vom Märchen "Schneeweißchen und Rosenrot" inspiriert ist. Es ist sicherlich kein Roman für Leser:innen, die in ihren Büchern alles ausführlich erklärt und auserzählt haben möchten. Vielmehr gibt der Roman viel Raum für eigene Interpretationen und Deutungen, sodass ich ihn insbesondere für das gemeinsame Lesen und Diskutieren in Lesekreisen empfehle.
Ich habe den Roman sehr gerne gelesen. Es ist ausgesprochen atmosphärisch erzählt, sprachlich überzeugend und hatte eine gewisse Sogwirkung auf mich. Denn ich wollte unbedingt wissen, wie diese außergewöhnliche Geschichte rund um die Schwestern und den Bären zu Ende geht.
An der ein oder anderen Stelle hätte der Roman etwas kürzer gehalten werden können, aber das tut meinem positiven Leseerlebnis keinen Abbruch.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Cover:
Das Cover wirkt durch die rosa Töne sehr verspielt und es nimmt dem Ganzen ein wenig an Natürlichkeit. Wenn auch schlicht, so macht die Farbgebung es hier etwas weicher und ich persönlich hätte nur aufgrund des Covers, nicht wirklich hingegriffen, aber auch das ist ja …
Mehr
Cover:
Das Cover wirkt durch die rosa Töne sehr verspielt und es nimmt dem Ganzen ein wenig an Natürlichkeit. Wenn auch schlicht, so macht die Farbgebung es hier etwas weicher und ich persönlich hätte nur aufgrund des Covers, nicht wirklich hingegriffen, aber auch das ist ja Ansichtssache. Für mich geht es unter und wäre rein optisch und farblich nicht meine direkte Wahl.
Meinung:
Eine Mischung aus Tagträumerei und Märchen über eine Geschwisterliebe, Verantwortung und der Suche nach dem eigenen Weg. Beide Schwestern sind sehr unterschiedliche und auch ihre Beziehung und im allgemeinen die Beziehung der Familie ist sehr besonders und teils schon toxisch, was ist nicht immer leicht lesbar macht. Bezug nehmend zum Grimmsche Märchen Schneeweißchen und Rosenrot, welches hier vorangestellt ist, kommen zwar Elemente, wie die Schwestern und der Bär darin vor, aber die Geschichte und das Märchen ist doch sehr modern und anders umgesetzt.
Inhaltlich möchte ich hier nicht allzu viel verraten und halte mich mit genaueren Informationen dazu bedeckt.
Der Schreibstil ist nicht immer ganz einfach und auch in die Charaktere fand ich nicht ganz so leicht, wie sonst hinein, da diese teils schon toxische Beziehung ein Hineinfinden etwas erschwert. Eine direkte Beschriftung in Kapitel ist nicht angegeben. Aber von der Form und der Gestaltung ist eine Gliederung erkennbar und die Anfänge durch vereinzelte besonders hervorgehobene Buschtaben erkennbar. Sam macht es einem auch nicht immer leicht und so lässt diese Geschichte einen durchaus nachdenklich zurück.
Eine Geschichte über Familie, Beziehungen und Abhängigkeiten, teils sehr bewegend und auch durchaus fesselnd. Dabei stimmt es nachdenklich und lässt auch ein wenig irritiert zurück. Für mich war es nicht ganz rund und leider kam ich nicht so gut und tief in Charaktere und Handlungen hinein, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber dies ist meinen Meinung und Ansichtssache. Von der Idee und die Hintergründen allemal interessant und mal sollte auf jeden Fall einen Blick hinein werfen.
Fazit:
Eine Mischung aus Märchen und Tagträumerei über Beziehungen, Familie und Abhängigkeiten.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Ich war sehr gespannt auf das Buch, weil ich von dem Debütroman "Das Verschwinden der Erde" enttäuscht war. Mich hat vor allem das Geschwisterverhältnis interessiert und auch die Beschreibungen des nervigen Jobs im schlecht-bezahlten Dienstleistungssektor. Da konnte ich mich …
Mehr
Ich war sehr gespannt auf das Buch, weil ich von dem Debütroman "Das Verschwinden der Erde" enttäuscht war. Mich hat vor allem das Geschwisterverhältnis interessiert und auch die Beschreibungen des nervigen Jobs im schlecht-bezahlten Dienstleistungssektor. Da konnte ich mich sehr reinfühlen, wenn man die ganze Zeit arbeitet, aber finanziell nicht vorwärtskommt.
Auch das Gefühl dadurch, dass man eingesperrt ist und man irgendwo wohnen muss, wo man nicht wohnen will, kann ich sehr gut nachvollziehen.
Irgendwie habe ich mir aber etwas anderes vorgestellt. Mir hat irgendwie die Handlung gefehlt. Auch das Auftreten des Bärs und die Reaktionen darauf, habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Trotzdem hat es mich gefesselt. Was ich von dem Ende halten soll, weiß ich nicht. Ob Sam glücklich wird?
Ich würde es weiter empfehlen, mit dem Hinweis, dass man sich darauf einlassen "muss".
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Geheimnisvoll mit überraschendem Ende
Der Schreibstil von Julia Phillips gefällt mir gut - ist sehr flüssig und spannend. Der Erzählstil ist angenehm zu lesen. Die Landschaft und die Schauplätze werden sehr gut beschrieben.
Den Einstieg mit einem Auszug aus einem …
Mehr
Geheimnisvoll mit überraschendem Ende
Der Schreibstil von Julia Phillips gefällt mir gut - ist sehr flüssig und spannend. Der Erzählstil ist angenehm zu lesen. Die Landschaft und die Schauplätze werden sehr gut beschrieben.
Den Einstieg mit einem Auszug aus einem Märchen der Gebrüder Grimm fand ich großartig.
Elena und Sam leben in ärmlichen Verhältnissen auf einer Insel. Sie leben im Haus zusammen mit ihrer todkranken Mutter, die sie pflegen müssen.
Sam arbeitet auf einer Fähre und entdeckt nachts im Meer vor der Küste einen Bären. Danach taucht der Bär an ihrer Haustür auf - das verändert das Leben der beiden Schwestern. Sam empfindet den Bären als Bedrohung, aber Elena fühlt sich von dem Bären angezogen. Sie beginnt sogar, den Bären zu füttern und ist sich der Gefahr nicht bewusst.
Der Roman ist aus der Sicht von Sam erzählt.
Eine außergewöhnliche Geschichte, die mich in den Bann gezogen hat. Das Ende ist tragisch und unerwartet. Ein modernes Märchen. Dafür 4 Sterne.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für