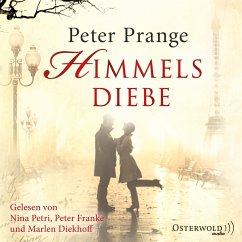Das Herz des Hais (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 245 Min.
Sprecher: Primus, Bodo
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
10,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
5 °P sammeln!
Der Kampf der schönen Malerin Lulubé – die für wilde Fasnachtsbräuche, Stierkampf und vulkanische Inseln schwärmt – mit ihrem sanften, allzu vernünftigen Gatten Kerubin ist eine tragikomische Liebes- und Ehegeschichte, wie wir in der deutschsprachigen Literatur wenige haben. Hier wird von Lulubé erzählt, die während ihres Urlaubs auf einer südlichen Insel einem ›Wilden Mann‹ und auch einem Menschenhai begegnet, mit deren Hilfe ein frühes Trauma überwindet und schließlich ihren Weg findet und geht und dem Gatten schreibt: »Wenn einmal die Bogensehne meiner Leidenschaftlich...
Der Kampf der schönen Malerin Lulubé – die für wilde Fasnachtsbräuche, Stierkampf und vulkanische Inseln schwärmt – mit ihrem sanften, allzu vernünftigen Gatten Kerubin ist eine tragikomische Liebes- und Ehegeschichte, wie wir in der deutschsprachigen Literatur wenige haben. Hier wird von Lulubé erzählt, die während ihres Urlaubs auf einer südlichen Insel einem ›Wilden Mann‹ und auch einem Menschenhai begegnet, mit deren Hilfe ein frühes Trauma überwindet und schließlich ihren Weg findet und geht und dem Gatten schreibt: »Wenn einmal die Bogensehne meiner Leidenschaftlichkeit schlaffer hängen sollte, bin ich bereits gestorben. Ich ziehe aus, den wilden Mann zu suchen, der Deine Herzensgüte im Kopf hat und dazu das Herz eines Hais.«
Das Herz des Hais ist eine der großartigsten Liebesgeschichten, allemal gültig bleibt Peter Härtlings Votum: »Eine Erzählung wie die vom Haiherzen ist ein Geschenk.«
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.