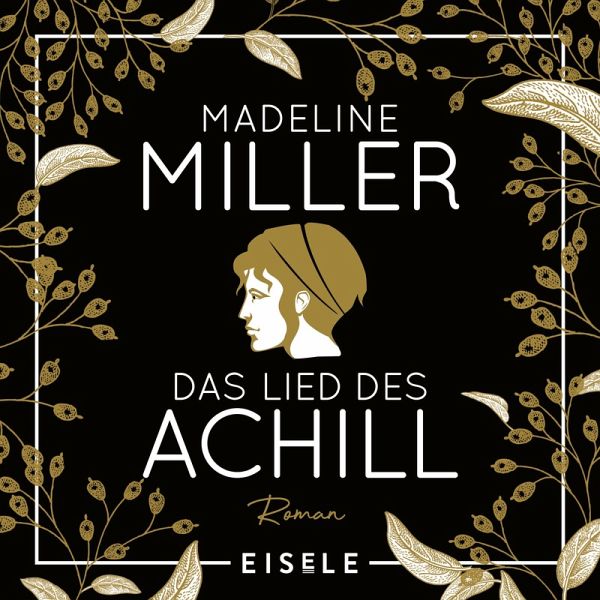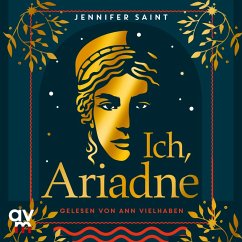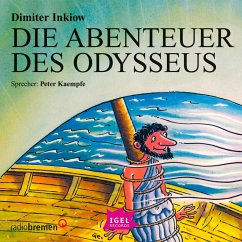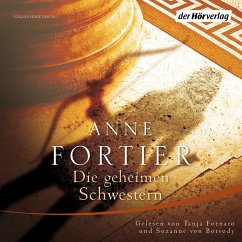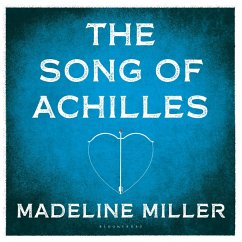Madeline Miller
Hörbuch-Download MP3
Das Lied des Achill (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 677 Min.
Sprecher: Fischer, Sebastian / Übersetzer: Windgassen, Michael

PAYBACK Punkte
8 °P sammeln!





Achill, Sohn der Meeresgöttin Thetis und des König Peleus, ist stark, anmutig und schön — niemand, dem er begegnet, kann seinem Zauber widerstehen. Patroklos ist ein unbeholfener junger Prinz, der nach einem schockierenden Akt der Gewalt aus seinem Heimatland verbannt wurde. Ein Zufall führt die beiden schon als Kinder zusammen, und je mehr Zeit sie gemeinsam verbringen, desto enger wird das Band zwischen ihnen. Nach ihrer Ausbildung in der Kriegs- und Heilkunst durch den Zentauren Chiron erfahren sie vom Raub der Helena. Alle Helden Griechenlands sind aufgerufen, gegen Troja in den Kamp...
Achill, Sohn der Meeresgöttin Thetis und des König Peleus, ist stark, anmutig und schön — niemand, dem er begegnet, kann seinem Zauber widerstehen. Patroklos ist ein unbeholfener junger Prinz, der nach einem schockierenden Akt der Gewalt aus seinem Heimatland verbannt wurde. Ein Zufall führt die beiden schon als Kinder zusammen, und je mehr Zeit sie gemeinsam verbringen, desto enger wird das Band zwischen ihnen. Nach ihrer Ausbildung in der Kriegs- und Heilkunst durch den Zentauren Chiron erfahren sie vom Raub der Helena. Alle Helden Griechenlands sind aufgerufen, gegen Troja in den Kampf zu ziehen, um die griechische Königin zurückzuerobern. Mit dem einzigen Ziel, ein ruhmreicher Krieger zu werden, nimmt Achill am Feldzug gegen die befestigte Stadt teil. Getrieben aus Sorge um seinen Freund, weicht Patroklos ihm nicht von der Seite. Noch ahnen beide nicht, dass das Schicksal ihre Liebe herausfordern und ihnen ein schreckliches Opfer abverlangen wird.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Madeline Millerstudierte Altphilologie an der Brown University in Providence, USA, und Dramaturgie an der Yale School of Drama, wo sie sich auf die moderne Adaption klassischer Texte spezialisierte. Später unterrichtete sie in Cambridge Latein und Griechisch. Für ihren Debütroman Das Lied des Achill wurde sie 2012 mit dem Orange Prize for Fiction ausgezeichnet, er schaffte es zudem auf Platz 1 der New-York-Times-Bestsellerliste. Auch ihr zweiter Roman Ich bin Circe avancierte zum New York Times Bestseller und stand auf der Shortlist des Women's Prize for Fiction. Millers dritte literarische Reise in die Welt der griechischen Mythologie war Galatea, ihre Neuerzählung des Pygmalion-Mythos. Ihre Bücher wurden in über 30 Sprachen übersetzt.
Produktdetails
- Verlag: Julia Eisele Verlag
- Erscheinungstermin: 28. Februar 2020
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 4099995050011
- Artikelnr.: 69684462
Patroklos ist die Stimme der bedingungslosen Liebe. Sie muss keine Bekenntnisse ablegen, sie spricht klar, licht, ohne große Bewegung an der Oberfläche, aber man spürt ihre Kraft in jedem Satz. Burkhard Müller Süddeutsche Zeitung 20200311
Broschiertes Buch
Der junge Patroklos wird aus seinem Elternhaus verbannt, der als gutmütig bekannte König Peleus nimmt ihn, wie andere verstossene Jungen, bei sich auf. Hier lernt Patroklos den jungen Achill kennen, ein Halbgott, Sohn von Peleus und der Meeresgöttin Thetis. Von Beginn an ist Patroklos …
Mehr
Der junge Patroklos wird aus seinem Elternhaus verbannt, der als gutmütig bekannte König Peleus nimmt ihn, wie andere verstossene Jungen, bei sich auf. Hier lernt Patroklos den jungen Achill kennen, ein Halbgott, Sohn von Peleus und der Meeresgöttin Thetis. Von Beginn an ist Patroklos von Achill angetan und weicht ihm nicht von der Seite…bis beide merken dass sie mehr empfinden als nur Freundschaft…doch dann zieht der Krieg gegen Troja auf und beide müssen sich entscheiden wie sie handeln wollen…
„Das Lied des Achill“ ist 2011 erschienen, erhält nach dem Erfolg von „Ich bin Circe“ jetzt erneut eine Neuauflage die vom Cover und ganzen Design sehr gelungen ist. Das Gold, der Kopf von Achill, die Blätter fallen sofort ins Auge und machen neugierig.
Jedoch muss ich gleich vorab anmerken dass man hier merkt dass dies das erste Buch der Autorin war, ich bin froh dass mich ihr zweites Buch „Ich bin Circe“ so mitreissen konnte. Leider war dies hier nicht der Fall.
Der Schreibstil ist locker, leicht, gut zu verstehen, aber es fiel mir hier und dort doch schwer gewisse Personen auseinanderzuhalten. Es fehlt bei diesem Buch einfach ein Personenregister damit man manchmal kurz „Spickeln“ kann wer denn nun wer ist.
Die zwei Hauptprotagonisten sind Patroklos und Achill, beide treffen in jungen Jahren aufeinander und könnten nicht unterschiedlicher sein. Während Achill eher das junge, sprunghafte Gemüt ist der unbekümmert lebt, aber nicht hochmütig, ist Patroklos von dem ganzen Sein des Achill angetan, er vergleicht sich ständig mit ihm und rückt so in den Hintergrund.
Und das zieht sich auch durch das ganze Buch – ja, es ist eine Liebesgeschichte zwischen zwei Männern, das ist okay, gut umgesetzt und überzeugend. Jedoch ging mir das Bewundern und das ständige mein Achill hier und da irgendwann ziemlich an den Nerv, denn ich hätte auch gerne mehr über Patroklos erfahren, dieser geht aber bei der ganzen Schwärmerei fast gänzlich unter.
Die Verwandlung des Achill, überhaupt wie die Autorin Achill darstellt hat mir sehr gut gefallen. Wir verfolgen und lernen ihn kennen als jungen Achill, seine Unbekümmertheit und sein Wesen waren interessant und auch den Wandeln auf dem Weg nach Troja und in den Krieg haben mich sehr fasziniert. Auch wenn er seine Halbgott Habe herunterspielt und das auch weiterhin machen möchte, so ganz gelingt es ihm nicht und er legt eine charakterliche Verwandlung hin. Hier kommt er den Legenden um sich selbst dann doch schon nahe.
Bis es aber gegen Troja geht, bis die beiden einen eigenen Weg gefunden haben vergeht viel Zeit im Buch und es war nicht sonderlich spannend, interessant oder dass ich das Buch nicht öfter mal weglegen konnte. Es ist einfach kein Vergleich zu dem zweiten Buch „Ich bin Circe“. Unter dem Strich konnte mich das Buch, gerade, zum Ende hin dann gar nicht überzeugen weil es einfach gegen die Legende von Achill geht. Ja, dem ein oder anderen wird es sehr romantisch erscheinen, mir hat das aber nicht wirklich zugesagt. Ich bin auch froh dass ich das zweite Buch „Ich bin Circe“ zuerst gelesen habe, denn die Autorin hat einiges an Geschichte, Legenden, Mythologie rund um Griechenland mit seinen Halbgöttern und Göttern drauf.
Auch wenn mich ihr „Ich bin Achill“ nicht gänzlich überzeugen konnte bleibe ich der Autorin treu und hoffe und spanne schon auf ihr nächstes Buch.
Weniger
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Ich habe nach dem Lesen dieses Buches keine Lust, mich über gute oder schlechte Übersetzungen auszulassen. Ob es nun Gewittersturm oder nur Gewitter heißen muss … geschenkt. Der Roman hat mir einfach zu gut gefallen, als dass ich ihn nun damit kaputtreden möchte. Warum? …
Mehr
Ich habe nach dem Lesen dieses Buches keine Lust, mich über gute oder schlechte Übersetzungen auszulassen. Ob es nun Gewittersturm oder nur Gewitter heißen muss … geschenkt. Der Roman hat mir einfach zu gut gefallen, als dass ich ihn nun damit kaputtreden möchte. Warum? Die Geschichte ist ja bekannt und die Autorin weicht auch nicht vom antiken Stoff ab. Sie erzählt ihn nur aus einer anderen, bisher nicht eingenommenen Perspektive, aus der des Patroklos. Mir hat besonders gefallen, dass Miller die Liebe der beiden Protagonisten ins Zentrum ihrer Erzählung stellt. Wie liebevoll die beiden miteinander umgehen, dass sie sich nie in Frage stellen, dass sie füreinander sorgen und dass sie nicht zornig auf den anderen sein können. Achill steht im Brennpunkt der Aufmerksamkeit. Durch die Augen des Patroklos wird er sehr differenziert und liebevoll geschildert. Und ohne Patroklos hätte er nicht das werden können, was aus ihm geworde ist: ein strahlender Held, an den man sich heute noch erinnert. Aus der Zuneigung zueinander ziehen sowohl Achill als auch Patroklos eine Kraft, die beide über sich hinaus wachsen lässt. Ihre unendliche Liebe schließlich führt folgerichtig auch zum aus der Legende bekannten Ende. Zum Tode Patroklos’, der Achills Platz auf dem Schlachtfeld eingenommen hat, zum Furor Achills, der den Tod seines Geliebten rächt, und zu Achills Vernachlässigung des eigenen Schutzes, die ihm seinen Tod bringt. So wie Achill immer für die Sicherheit des Patroklos einstand, so sorgte Patroklos im Leben immer dafür, dass Achill sein Schicksal tragen kann, und so kämpft selbst der Geist des Patroklos noch um das Andenken an seinen Geliebten. Dafür, dass er nicht nur als mordende Kampfmaschine in Erinnerung bleibt, sondern auch als Liebender und liebenswürdiger junger Mann, der schön war, gut singen konnte, der an das Gute im Menschen glaubte, der warmherzig und hilfsbereit war und nicht grundlos hassen konnte. Am Ende überzeugt Patroklos sogar die Göttin Thetis, Achills Mutter, davon, ihren Sohn in seiner Menschlichleit zu ehren, seine ganze Persönlichkeit anzuerkennen und zu respektieren. Und so können wir gewiss sein, dass die beiden großen Liebenden dieses Romans am Ende doch wieder vereint sind. Bis in alle Ewigkeit. – Tränen, Ende. Ich kann das Buch nur empfehlen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Nach “Ich bin Circe” ein weitere Roman inmitten der griechischen Antike von Madeline Miller.
Schon von Circe war ich begeistert und habe es verschlungen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich die griechische Mythologie im allgemeinen sehr spannend finde und dementsprechend viel …
Mehr
Nach “Ich bin Circe” ein weitere Roman inmitten der griechischen Antike von Madeline Miller.
Schon von Circe war ich begeistert und habe es verschlungen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich die griechische Mythologie im allgemeinen sehr spannend finde und dementsprechend viel lese was ich dazu in die Finger bekomme. So eben auch den Roman “Das Lied des Achill”
“Achill, Sohn der Meeresgöttin Thetis und des König Peleus, ist stark, anmutig und schön — niemand, dem er begegnet, kann seinem Zauber widerstehen. Patroklos ist ein unbeholfener junger Prinz, der nach einem schockierenden Akt der Gewalt aus seinem Heimatland verbannt wurde. Ein Zufall führt die beiden schon als Kinder zusammen, und je mehr Zeit sie gemeinsam verbringen, desto enger wird das Band zwischen ihnen.”
Dass das alles natürlich nicht mit rosa Wolken enden kann ist fast schon klar. Doch wie der Weg dahin und dann auch die weiteren Schickale beschrieben werden finde ich sehr gut. Die Sprache ist flüssig und man kann sich gut in die Szenen eindenken. Das aufgrund der bestehenden Mythologie der Ausgang nicht neu erfunden werden kann ist klar, doch macht die Autorin dennoch etwas ganz tolles daraus und man findet sich mitten in der Geschichte wieder und erlebt sie mit. Einzig das recht negativ belastete Frauenbild hat mich hier ein bisschen gestört. Doch alles in allem ein toller und kurzweiliger Roman.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Patroklos tötet aus Versehen einen Prinzen und wird von seinem Vater an den Hof des Peleus verbannt. Dort trifft er auf Achill und die beiden werden beste Freunde. Im Laufe der Zeit merken sie jedoch, dass sie mehr verbindet als Freundschaft. Dies wird von Achills Mutter, der Meeresgöttin …
Mehr
Patroklos tötet aus Versehen einen Prinzen und wird von seinem Vater an den Hof des Peleus verbannt. Dort trifft er auf Achill und die beiden werden beste Freunde. Im Laufe der Zeit merken sie jedoch, dass sie mehr verbindet als Freundschaft. Dies wird von Achills Mutter, der Meeresgöttin Thetis nicht gerne gesehen. Auch die Prophezeiung, die für Achill getroffen wurde, wirft einen düsteren Schatten auf ihre Beziehung. Als der trojanische Krieg ausbricht, rückt das Eintreffen der Prophezeiung näher und Patroklos weiß, dass ihm nicht mehr viel Zeit mit Achill bleibt.
Die Autorin hat mich mit ihrem Buch "Ich bin Circe" schon verzaubern können. Diesmal wagt sie sich an die Geschichte von Achill, der im trojanischen Krieg zu einem Helden wurde. Doch wie es dazu kam, wird hier nun eindrücklich erklärt. Die Geschichte wird aus Patroklos Sicht erzählt und dies in einer wunderbaren Art und Weise.
Zuerst erfahren wie einiges über Patroklos, seine Geburt und seine Jugendjahre bis zu dem verhängnisvollen Tag, an dem durch einen dummen Zufall jemand stirbt. Patroklos wird verbannt und trifft an seinem neuen Zuhause auf Achill. Sie werden zu Freunden und später zu Geliebten.
Eine Prophezeiung sagt voraus, dass Achill sterben wird und Patroklos nutzt jede Sekunde, die er mit Achill verbringen kann.
Wenn man sich auf die Geschichte einlässt, erwartet einem eine wunderbare Liebesgeschichte der anderen Art. Die Autorin legt jede Menge Gefühl in die Story und lässt Patroklos in seiner ganz eigenen Art erstrahlen.
Ich hätte stundenlang weiterlesen können, da das Verhältnis zwischen Patroklos und Achill einzigartig ist. Die beiden verstehen sich zeitweise blind. Jedoch gibt es immer wieder Momente, in denen sie sich sagen, was nicht so gut läuft.
Als es zum trojanischen Krieg kommt, spitzt sich die Lage zu.
Ich habe mir schwer getan, das Buch aus der Hand zu legen. Die Autorin lässt die griechische Mythologie lebendig werden und vermittelt ein Gefühl, dass alles so passiert ist, wie sie schreibt. Das Kopfkino hatte sehr viel zu tun.
Ich hoffe, dass die Autorin weiterhin mit der griechischen Mythologie weitermacht und uns noch weitere Götter, Helden oder Sagengestalten näher bringt.
Meggies Fussnote:
Achill und Patroklos - Liebe kennt keine Grenzen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Lange Zeit waren Helena und Paris für mich der Inbegriff des Trojanischen Krieges aus der griechischen Mythologie. Das hat sich mit „Das Lied des Achill“ von Madeline Miller jedoch gründlich geändert, denn darin sind Achill und Patroklos die Hauptfiguren. Mit viel …
Mehr
Lange Zeit waren Helena und Paris für mich der Inbegriff des Trojanischen Krieges aus der griechischen Mythologie. Das hat sich mit „Das Lied des Achill“ von Madeline Miller jedoch gründlich geändert, denn darin sind Achill und Patroklos die Hauptfiguren. Mit viel Gefühl nimmt die Autorin die Perspektive von Patroklos ein und erzählt von seiner Kindheit, seinem ersten Zusammentreffen mit Achill und der überwältigenden Liebe, die daraus erwächst. Dabei bleibt Miller der ursprünglichen Version weitestgehend treu, interpretiert diese jedoch auf ihre Weise, um eine vollkommen neue Geschichte zu erzählen – eine Geschichte von Liebe, Verzweiflung, Hoffnung und Schmerz.
Die Worte von Madeline Miller treffen einen bis ins Mark, so zielsicher geht sie damit um. Sei es, um die innige Freundschaft und Liebe von Achill und Patroklos einzufangen oder im Kontrast dazu die Grausamkeit des Krieges zu beschreiben. Doch von Anfang an! Erst geht es zurück in die Kindheit von Patroklos, denn hier setzt die Geschichte ein. Wir erleben ihn als zurückhaltenden, zarten Jungen der sich lieber vor den anderen Jungen am Hof seines Vaters, des Königs, versteckt. Bloß kein Aufsehen erregen, ist seine Devise, denn allen ist bekannt, dass er eine große Enttäuschung für seinen Vater ist. Statt ihn zu akzeptieren, bewundert sein Vater Achill, der als Kind zu Wettkämpfen am Hof erscheint.
Auch an Patroklos geht der erste Anblick von Achill nicht spurlos vorüber, er ist zerrissen zwischen Neid und Bewunderung. Diese Einführung legt den Grundton der Geschichte, sie macht deutlich, wie das Leben die zwei jungen Griechen geprägt hat: Patroklos, der treue Freund von Achill, der immer in seinem Schatten zu steht, still und unscheinbar, und daneben Achill, der stets von allen bewundert wird und es nicht erträgt, wenn ihm Unrecht widerfährt und er in seiner Ehre verletzt wird.
Es ist wundervoll, wie einfühlsam und greifbar die Figuren zum Leben erweckt werden. Insbesondere liebe ich den Blick der Autorin auf ihre Figuren, die in „Das Lied des Achill“ viel weniger als Helden der griechischen Mythologie dargestellt werden, sondern vielmehr als Menschen, die versuchen, ihrem Schicksal zu entkommen und sich letztendlich doch widerwillig fügen müssen. So ist Achill zwar ein strahlend schöner Halbgott und ein begnadeter Kämpfer, doch wünscht er sich nichts sehnlicher, als ein friedliches Leben gemeinsam mit Patroklos. Letztendlich wird er aber doch von Odysseus und Diomedes überlistet und in den Kampf involviert – der Rest ist sozusagen „Geschichte“, aber eben auch eine große, tragische Liebesgeschichte.
„Das Lied des Achill“ erinnert mich in seiner Leidenschaftlichkeit an „Romeo und Julia“. Und ebenso wie Romeo und Julia, können auch Achill und Patroklos ihrem Schicksal nicht entgehen. Wo in der einen Geschichte die Familien an der Tragödie Schuld sind, mischen in der Mythologie die Götter mit. So oder so, mich hat die Autorin emotional vollkommen gepackt. Das gelingt ihr so gut, weil ihr Schreibstil herrlich illustrativ ist. Man fühlt die griechische Hitze, man riecht die Düfte von Ölen und den Geruch des Meeres, den Schweiß der Männer, den Gestank des Lagers nach Opfergaben. Ebenso spürt man die tiefe Verbundenheit zwischen den beiden jungen Männern, die sich fortwährend weiterentwickelt. Da sind die anfängliche Unsicherheit und die rauschhaften ersten Wochen, später kommen Zweifel und Ängste hinzu, bis die beiden während des Krieges eine reife und kompromisslose Liebe verbindet.
Der Rhythmus der Erzählung ist ebenfalls großartig. Die Spannung wird konstant aufrechterhalten, aber immer wieder durchbrochen mit zahlreichen ruhigen und intimen Momenten zwischen Patroklos und Achill. Diese Momente sind das Herz von „Das Lied des Achill“, sie lassen diesen Teil der griechischen Mythologie lebendig werden.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Atemberaubend und bewegendes Debüt, in wunderschöner Neuauflage
Achill, ein Halbgott, ist strak, anmutig und schön – niemand kann seinem Bann widerstehen. Patroklos, ein junger unbeholfener Prinz, der verstoßen wurde. Der Zufall führt beide als Kinder zueinander. Die …
Mehr
Atemberaubend und bewegendes Debüt, in wunderschöner Neuauflage
Achill, ein Halbgott, ist strak, anmutig und schön – niemand kann seinem Bann widerstehen. Patroklos, ein junger unbeholfener Prinz, der verstoßen wurde. Der Zufall führt beide als Kinder zueinander. Die Zeit schweißt sie, trotz aller Widrigkeiten unzertrennlich zusammen. Kaum sind sie zu jungen Männern gereift, tobt ein Krieg. Die Schlacht, gegen die Trojaner, um die schöne Helena nach Sparta zurückzuholen. Auch Achill ist, neben vielen anderen Helden Griechenlands, aufgefordert sich dem Kampf anzuschließen. Patroklos, von Sorge getrieben, weicht seinem geliebten Achill nicht von der Seite. Doch trotz ihres Wissens, ahnen beide nicht welche Falle das Schicksal für sie und ihre Liebe bereithält.
Madeline Miller ist US- amerikanische Schriftstellerin. Nach ihrem Studium in Altphilologie unterrichtet sie Latein und Griechisch an Gymnasien. Das Lied des Achill ist ihr, 2011 bereits veröffentlichter Debütroman. Im Februar 2020 erschien, Dank dem Eisele Verlag, eine optisch bezaubernde Neuauflage. Der hochwertige Look in matt Schwarz und schillerndem Gold ist das perfekte Pendant zum großartigen Werk im inneren des Buches. Miller schrieb 10 Jahre an dieser Geschichte, der Homers Ilias zu Grunde liegt. Doch auch viele andere klassische Texte hatten ihren inspirierenden Einfluss. Man merkt dem Buch die Liebe und Arbeit an, es ist mit sehr viel Hingabe und einem Auge fürs Detail geschrieben. Patrokloses Erzählungen und Wissen geleiten uns durch einen Teil der viel besungenen Helden Saga und liefern Einblicke in die Hintergründe, in seine Kindheit, die Verstoßung und wie er Achill das erste Mal begegnete. Wir erleben die, wenn auch sehr unterschiedliche Ausbildung der beiden und deren Rolle im bekanntesten Krieg der griechischen Mythologie. Millers Charakterzeichnung ist sehr tiefreichend und der Schreibstil so bildgewaltig, dass die Erzählung eine große Sogwirkung bekommt. Der Leser taucht ganz in die Geschichte ab und erlebt sich selbst als einen Teil davon. Sogar die Weiterentwicklung der Charaktere, lässt die Autorin uns hautnah miterleben. Auch wenn Patroklos und Achill im Vordergrund der Erzählung stehen begegnen wir vielen bekannten Personen. Die, dank ihrer ebenfalls liebevoll ausgereiften Zeichnung, mit den beiden ein vollständiges, großes Bild ergeben. Wenngleich es sich hier um ein Liebespaar handelt, schafft Madeline Miller dennoch das miteinander so subtil und völlig ohne überzogene Szenen zu beschreiben. Durch die Verbundenheit zu den Protagonisten fiebert man, obgleich des bekannten Endes, enorm mit. Während der Kämpfe hält man förmlich den Atem an, um das drohende Ende beider noch irgendwie abwenden zu können. Das Lied des Achill ist sprachlich vielleicht nicht ganz so anspruchsvoll wie ihr zweites Buch „Ich bin Circe“ - jedoch bleibt es, nicht zuletzt wegen seiner harmonischen und mitreißenden Schreibweise, ein Highlight. Einzig Achilles und Hektors aufeinander treffen ist etwas knapp geraten. Ist es doch der Höhepunkt auf den die Geschichte zusteuert und der hätte, für mein Empfinden gern umfänglicher sein dürfen. Dieses winzige Detail konnte das Lesevergnügen jedoch nicht schmälern. Ich habe gehofft, gelacht, war angespannt, abgetaucht, verliebt und tot traurig beim Lesen. So müssen Bücher sein.
Fazit: ein unfassbar grandioses, mitreißendes Buch, dass nicht nur Fans von historischen Romanen oder griechischer Mythologie in seinen Bann ziehen wird.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für