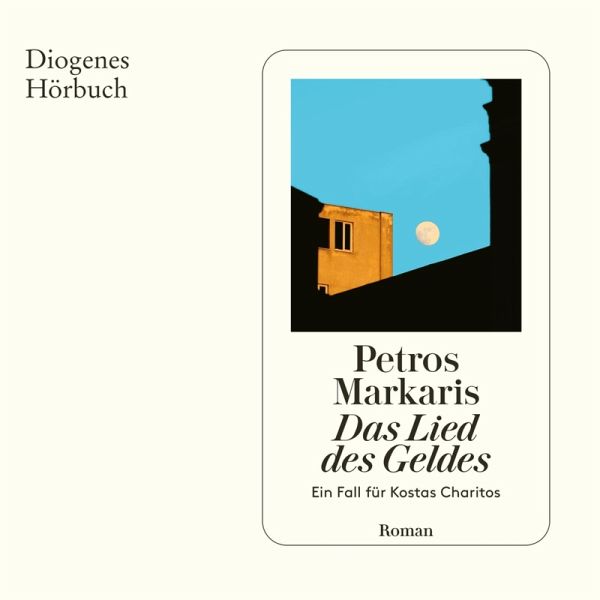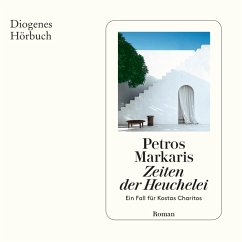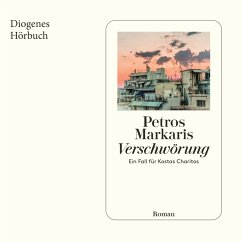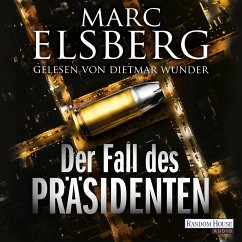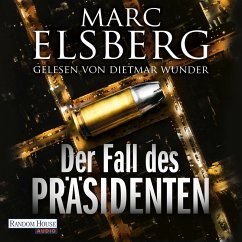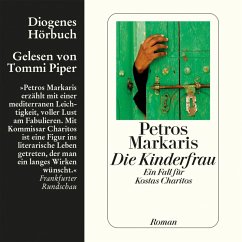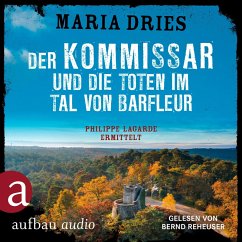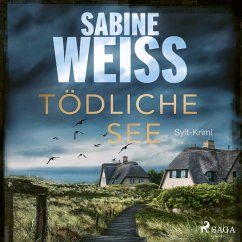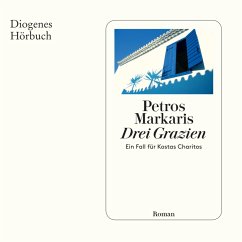Petros Markaris
Hörbuch-Download MP3
Das Lied des Geldes / Kostas Charitos Bd.13 (MP3-Download)
Ein Fall für Kostas Charitos Gekürzte Lesung. 375 Min.
Sprecher: Buser, Daniel / Übersetzer: Prinzinger, Michaela

PAYBACK Punkte
5 °P sammeln!





Feierlich wird die Linke zu Grabe getragen, in einem Trauerzug durch die Straßen von Athen. Was wie ein Karnevalsumzug aussieht, ist der Beginn einer neuen Protestbewegung: Die Armen schließen sich zusammen, um sich Gehör zu verschaffen. Ist in ihren Reihen der Mörder zu suchen, der die ausländischen Investoren auf dem Gewissen hat? Kommissar Charitos ermittelt und horcht auf, als er überall in der Stadt das Lied des Geldes vernimmt.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Petros Markaris, geboren 1937 in Istanbul, ist Verfasser von Theaterstücken und Schöpfer einer Fernsehserie, er war Co-Autor von Theo Angelopoulos und hat deutsche Dramatiker wie Brecht und Goethe ins Griechische übertragen. Mit dem Schreiben von Kriminalromanen begann er erst Mitte der Neunzigerjahre und wurde damit international erfolgreich. Er hat zahlreiche europäische Preise gewonnen, darunter den Pepe-Carvalho-Preis sowie die Goethe-Medaille. Petros Markaris lebt in Athen.

© Regine Mosimann / Diogenes Verlag
Produktdetails
- Verlag: Diogenes Verlag
- Gesamtlaufzeit: 463 Min.
- Erscheinungstermin: 28. Juli 2021
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783257694253
- Artikelnr.: 61682303
»Markaris' Kommissar Kostas Charitos hat längst Kultstatus.«
Geschencke für den Kopf (Fortsetzung von Seite 21)
Gerhard Matzig
EINE HERAUSFORDERUNG
An „die Weisheit des Alten vom Berge“ fühlt sich die eine Kritik erinnert. Eine andere Rezension vermisst die Aktualität. Herrje. Alexander Demandt ist Mitte achtzig, schon möglich, dass er alt ist. Und ja, er ist Althistoriker und kein Tweet. Trotzdem ist sein Buch voller Weltwissen über das kulturelle und territoriale Wesen der Grenze zwischen Sehnsucht und Schutzversprechen, vom Limes über die chinesische Mauer bis zu Paneuropa, eine einzigartig anregende Grenzerfahrung.
Alexander Demandt: Grenzen. Propyläen Verlag. 656 Seiten, 28 Euro.
EINE HILFE
Wir alle sind Reisende, die nicht reisen
Gerhard Matzig
EINE HERAUSFORDERUNG
An „die Weisheit des Alten vom Berge“ fühlt sich die eine Kritik erinnert. Eine andere Rezension vermisst die Aktualität. Herrje. Alexander Demandt ist Mitte achtzig, schon möglich, dass er alt ist. Und ja, er ist Althistoriker und kein Tweet. Trotzdem ist sein Buch voller Weltwissen über das kulturelle und territoriale Wesen der Grenze zwischen Sehnsucht und Schutzversprechen, vom Limes über die chinesische Mauer bis zu Paneuropa, eine einzigartig anregende Grenzerfahrung.
Alexander Demandt: Grenzen. Propyläen Verlag. 656 Seiten, 28 Euro.
EINE HILFE
Wir alle sind Reisende, die nicht reisen
Mehr anzeigen
können. Der nächste Lockdown steht vor der Tür. Wie die nächste Welle, die dem Fernweh entgegenbrandet. Der Architekturkritiker Wojciech Czaja hat was gegen die Stubenhockerei erfunden: ein Bilderbuch, das im Vertrauten, also in Wien, das Fremde entdeckt. Also die Welt. Es ist das Buch der Stunde.
Wojciech Czaja: Almost. Edition Korres-pondenzen. 232 Seiten, 20 Euro.
EINE WIEDERENTDECKUNG
Raider ist Twix und Facebook ist Meta. Die Plattform wird ein digitales Paralleluniversum. Als Avatare machen wir alles darin: shoppen, lieben, sterben. Bitte die Prophezeiung „Snow Crash“ von Neal Stephenson aus dem Jahr 1992 erneut lesen. Durchatmen, Facebook abmelden. Meta ist eine Metastase.
Neal Stephenson: Snow Crash. Fischer Tor. 576 Seiten, 16,99 Euro.
Egbert Tholl
EIN GROSSER SPASS
Vielleicht ist „Spaß“ das falsche Wort, aber eine große Freude war es schon, als The Notwist in diesem Jahr nach sechs Jahren wieder ein Studioalbum herausbrachten. „Vertigo Days“ ist so vielschichtig wie zugänglich, ganz viele Gäste machen mit, und das Ergebnis wirkt, als hänge man in seinem Zuhause eine Kette bunter Lampions auf. Die schaukeln dann sanft vor sich hin, und während man ihnen zuschaut, wird man leicht und froh.
The Notwist: Vertigo Days. Morr Music.
EINE WIEDERENTDECKUNG
Dieses Leben kann man nicht erfinden, man muss es gelebt haben. Leopold Tyrmand wurde 1920 in eine assimilierte jüdische Familie in Warschau hineingeboren, ging 1939 in den Widerstand nach Wilna, geriet in sowjetische Gefangenschaft, floh, besorgte sich einen französischen Pass und meldete sich – im Auge des Sturms ist es am sichersten – zum „Arbeitseinsatz im Reich“. 1943 wurde er Kellner im Parkhotel in Frankfurt am Main, und diese Zeit schrieb Tyrmand auf, in seinem herrlichen Roman „Filip“, 60 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung dieses Jahr auf Deutsch erschienen. Filip, der vermeintliche Franzose, haut die Nazibonzen übers Ohr, handelt mit Lebensmittelmarken, bezirzt mit ganz viel tiefem Herzeleid die Fräuleins, strotzt vor Überlebenswillen. Filip liebt Jazz – nach dem Krieg gründete Tyrmand den ersten Jazzclub Polens. Kein Buch beschreibt Deutschland im Krieg so wie dieses, ein Aberwitz, rasant, grandios.
Leopold Tyrmand: Filip. Frankfurter
Verlagsanstalt. 632 Seiten, 24 Euro.
Christine Dössel
EIN LIEBESBEWEIS
Klaus Pohl war dabei, als Peter Zadek 1999 „Hamlet“ inszenierte. Er spielte den Horatio und schrieb mit, was sich während der turbulenten Proben ereignete. Saufgelage, Wutausbrüche, Eitelkeiten. Angela Winklers Fluchtversuche vor der übergroßen Titelrolle; Zadeks Anstrengungen, sie zurückzuholen. Ein Buch des real gelebten Theaterwahnsinns, vor allem aber: der Theaterliebe. Eine Hommage auch an die Kollegen (viele davon tot). In der heimlichen Hauptrolle: der süffisante Ulrich Wildgruber, besetzt als Polonius – es war seine letzte Rolle vor seinem Freitod noch im selben Jahr. Pure Lesefreude. Und wehes Leseglück.
Klaus Pohl: Sein oder Nichtsein. Galiani. 286 Seiten, 23 Euro. Und als ungekürzte Autorenlesung auf CD.
EINE HERAUSFORDERUNG
Etwas für Theater-Nerds und Fans der Berliner Volksbühne – zumindest jener Ära, als Frank Castorf dort Intendant und Carl Hegemann Dramaturg und Begleitwortmusiker war: eine Sammlung von Hegemann-Texten (Essays, Nachrufe, Kommentare, Gespräche) aus den letzten 15 Jahren, die weit über das Theater hinausführen zu einer „Dramaturgie des Daseins“. Es geht um Schiller und Hölderlin, Wagner und Schlingensief, Marx und Materialismus, aber auch um Genuss, Liebe und Tod. Hegemann ist ein geistiger Lebemann.
Carl Hegemann: Dramaturgie des Daseins. Everyday live. Alexander Verlag. 445 Seiten, 33 Euro.
Martina Knoben
EINE HERAUSFORDERUNG
Einen „grafischen Essay“ nennt Anke Feuchtenberger ihr großformatiges Heft „Der Spalt“. Eine Erzählung in Bildern, in der Form eines Briefs an ihr „Kindeskind“, über das Leben als Frau, Mutter und Großmutter, in Corona-Zeiten, mit einem Hund. In ihren Kohlezeichnungen wurde das Licht buchstäblich freigekratzt. Das Werk einer großen Malerin. Anke Feuchtenberger: Der Spalt. Villa Stuck. 36 Seiten, 18 Euro.
EIN GROSSER SPASS
Mit „Asterix und der Greif“ hat sich Didier Conrad endgültig vom Asterix-Übervater Albert Uderzo emanzipiert. Er bleibt dessen Stil treu, aber mit starker eigener Handschrift. Conrads Zeichnungen sind actionreicher, die Porträts realistischer. Und die Schneelandschaften im neuem Band ohnehin ein großer Genuss. Jean-Yves Ferri, Didier Conrad: Asterix und der Greif. Egmont Ehapa. 48 Seiten, 6,90 Euro / geb. 12 Euro.
EIN LIEBESBEWEIS
„… und plötzlich standen wir auf einem Gipfel von der Größe eines Küchentisches und klammerten uns an die aus dem Schnee ragenden Eisenstangen des Gipfelkreuzes, starr vor Angst und begeistert zugleich“. Warum Menschen auf Berge steigen, obwohl es anstrengend, öde, manchmal lebensgefährlich und fast immer vollkommen nutzlos ist, lässt sich in „Berge im Kopf“, einem Klassiker des Nature Writing von Robert Macfarlane, nachlesen.
Robert Macfarlane: Berge im Kopf. Matthes & Seitz. 318 Seiten, 34 Euro.
Claudia Tieschky
EIN GROSSER SPASS
Manches am Sound der französischen Band La Femme erinnert an die Coolness der Zeit, als Element of Crime noch englisch sangen; dazu mischen sie kreuz und quer quietschbunte France-Gall-Aufgedrehtheit, Synthesizer, Trompeten, ungesüßte Texte. Verleitet eindeutig zu Bewegung.
La Femme: Paradigmes. Disque Pointu.
EINE HERAUSFORDERUNG
Adelheid Duvanel starb in einer Julinacht 1996 durch Unterkühlung im Wald bei Basel im Alter von sechzig Jahren. In ihrem Leben war sie von absurd vielen Katastrophen heimgesucht worden, als Teenager landete sie in der Psychiatrie, sie führte eine Ehe mit einem Maler, für den sie das eigene Malen aufgab, ihr Kind wurde drogenabhängig und aidskrank. Was sie hinterlassen hat, ist ein absolut makelloses eigenständiges Universum aus kurzen Texten: Mit präziser Sprache gemalte Szenen, heiter und manchmal ironisch erzählt, die still eskalieren, bis sich überwältigende Weltverlorenheit auftut. Das müsste abstoßen, weil man ja merkt, dass hier nichts mehr lovely wird. Aber immer überwiegt das faszinierend Unerwartete in den Geschichten der beunruhigenden Erzählerin Adelheid Duvanel, und man kann nicht genug davon bekommen. Jetzt liegen alle ihre Erzählungen in einem Band vor. Adelheid Duvanel: Fern von hier. Sämtliche Erzählungen. Limmat Verlag. 792 Seiten, 39 Euro.
Marie Schmidt
EINE HERAUSFORDERUNG
Eine Sechzehnjährige, ihre nur um genau 16 Jahre ältere Mutter, Konkurrenz, Liebe, Ablösung, das ganze ödipale Drama – oder wie man das nennt, wenn Männer und Väter nur als nette, hilflose Randfiguren mitspielen. Dazu die in einer schwarzen Familie aus Brooklyn auch materiell schmerzhafte Frage: Was haben wir eigentlich zu vererben? Jacqueline Woodsons „Alles glänzt“ ist ein Roman, hart wie ein Diamant, rhythmisch, berührend, nicht aus dem Kopf zu kriegen. Jacqueline Woodson: Alles glänzt. Piper. 208 Seiten, 22 Euro.
EINE HILFE
Man kann die Bücher des britischen Psychoanalytikers Adam Phillips schon auch als Ratgeber lesen. Vor allem hat er aber die ganze Weltliteratur im Rücken. Im deutschen Sprachraum gibt es eine Essayistik wie seine nicht. Dieses Jahr hat er ein Bändchen herausgebracht über ein gerade jetzt persönlich und politisch heikles Projekt: „On Wanting to Change“. Kann man sich (oder andere) überhaupt ändern? Will man? Die Fortsetzung heißt „On Getting Better“. Fürs nächste Jahr. Adam Phillips: On Wanting to Change. On Getting Better. Penguin. 160/176 S., 7,98/6,99 Euro.
EIN LIEBESBEWEIS
Die Zeile des Jahres: „How you lemonade all your sadness when you openin’ up?“ So die Rapperin Noname aus Chicago über das Gefühl beim Nachrichtenlesen. Optimistisch bleiben: schwierig. Wir bleiben dran. Noname: Rainforest. Single. Noname Publishing.
Kurt Kister
EIN GROSSER SPASS
Was Camilleris Commissario Montalbano für Sizilien ist, ist Hauptkommissar Kostas Charitos für die Athener Mordkommission. Sein Schöpfer Petros Markaris schreibt hinreißend. Mit jedem neuen Charitos-Roman versteht man das heutige Griechenland besser. Im jüngsten Fall geht es um einen toten, reichen Saudi, um linke Protestierer und um das Geld der anderen.
Petros Markaris: Das Lied des Geldes. Diogenes Verlag. 310 Seiten, 24 Euro.
EINE HERAUSFORDERUNG
Der Pianist Igor Levit macht keine halben Sachen. Sein jüngstes Werk, ambitioniert, geglückt: Schostakowitschs 24 Präludien und Fugen sowie die „Passacaglia on DSCH“ von Ronald Stevenson. Schostakowitsch ist sowieso heilig; Stevenson fast der helle Wahnsinn. Dreieinhalb Stunden großartigste Klaviermusik. Igor Levit: On DSCH. 3 CDs. Sony Classical.
EINE WIEDERENTDECKUNG
Ein einziges Buch über den Zweiten Weltkrieg? Dann Wassili Grossmans „Leben und Schicksal“ lesen. Jetzt gibt es noch eines, neu übersetzt. Es ist auch von Grossman und heißt „Stalingrad“. Der Name sagt alles, und das Buch sagt auf sehr vielen Seiten, manchmal pathetisch, warum diese Schlacht auf ewig mehr sein wird als nur Geschichte. 1952 ist „Stalingrad“ sehr zensiert auf Russisch erschienen; 70 Jahre später gibt es das rekonstruierte Meisterwerk auf Deutsch. Wassili Grossman: Stalingrad. Claassen Verlag. 1280 Seiten, 35 Euro.
Willi Winkler
EIN GROSSER SPASS
Die Ausstellung ist mittlerweile von Aachen nach London fortgezogen, aber den Katalog gibt es noch, „Dürer war hier“, ein Pracht- und Monumentalband, der die Reise des Malers 1520/21 in die Niederlande dokumentiert. Dürer wird gefeiert, aber er ist auf der Arbeit, malt, zeichnet, schreibt und sammelt Gesichter, Haare, Mützen, Gewandfalten für die Ewigkeit. Peter van den Brink: Dürer war hier. Michael Imhof Verlag. 680 Seiten, 49,95 Euro.
EIN LIEBESBEWEIS
Peter Jackson („Der Herr der Ringe“), hat 60 Stunden Filmmaterial der
Beatles von 1969 gesichtet und zu einer Dokumentation geschnitten. Nach 52 Jahren sind sie wieder da, unfassbar jung. Sie albern herum, zanken sich, machen begeistert Musik, obwohl es die letzten Aufnahmen sind, die vor der Trennung entstehen. Hier sind die vier wieder zusammen, die Götter des 20. Jahrhunderts. Für alle Menschen reinen Herzens: ein Geschenk.
The Beatles. Get Back. Regie: Peter Jackson. Drei Folgen, insgesamt sechs Stunden. Disney+.
Catrin Lorch
EINE HILFE
Kai Althoff gehört zu den bedeutendsten Malern überhaupt. Dass er immer noch nur in der Szene wirklich berühmt ist, wird sich so lange nicht ändern, wie er seine Gemälde und Zeichnungen in seltenen komplizierten Ausstellungsinstallationen mehr versteckt denn herzeigt. So ein Projekt war „Kai Althoff goes with Bernard Leach“ in der Londoner Whitechapel Gallery. Wobei diese Schau nicht nur zur Retrospektive gereicht hätte, sondern auch zum Trost im ersten Corona-Winter – wäre sie nicht im Lockdown verschwunden. Es ist zu hoffen, dass sich eine weitere Station findet, zum Glück ist gerade der elegante, in kupferrosa Leinen gebundene großformatige Katalog erschienen.
Kai Althoff Goes With Bernard Leach: With Forms and Templates for Effective Practice. Whitechapel Gallery. 100 Seiten, 70,95 Euro.
EINE WIEDERENTDECKUNG
Dass die amerikanische Musikerin Alice Coltrane mit einem neuen Glauben auch eine neue Musikrichtung annahm – nämlich den spirituellen Jazz –, wurde lange eher belächelt. Nun hat ihr Sohn Ravi eine Aufnahme wiederentdeckt, bei der sie in Sanskrit singt und sich selbst an der Wurlitzer-Orgel begleitet. Weswegen „Turiya Sings“ so einsam, so heilend und so eigenartig klingt, dass man am liebsten mitsummen würde, auf Sanskrit.
Alice Coltrane: Kirtan: Turiya Sings. Impulse!/Universal.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Wojciech Czaja: Almost. Edition Korres-pondenzen. 232 Seiten, 20 Euro.
EINE WIEDERENTDECKUNG
Raider ist Twix und Facebook ist Meta. Die Plattform wird ein digitales Paralleluniversum. Als Avatare machen wir alles darin: shoppen, lieben, sterben. Bitte die Prophezeiung „Snow Crash“ von Neal Stephenson aus dem Jahr 1992 erneut lesen. Durchatmen, Facebook abmelden. Meta ist eine Metastase.
Neal Stephenson: Snow Crash. Fischer Tor. 576 Seiten, 16,99 Euro.
Egbert Tholl
EIN GROSSER SPASS
Vielleicht ist „Spaß“ das falsche Wort, aber eine große Freude war es schon, als The Notwist in diesem Jahr nach sechs Jahren wieder ein Studioalbum herausbrachten. „Vertigo Days“ ist so vielschichtig wie zugänglich, ganz viele Gäste machen mit, und das Ergebnis wirkt, als hänge man in seinem Zuhause eine Kette bunter Lampions auf. Die schaukeln dann sanft vor sich hin, und während man ihnen zuschaut, wird man leicht und froh.
The Notwist: Vertigo Days. Morr Music.
EINE WIEDERENTDECKUNG
Dieses Leben kann man nicht erfinden, man muss es gelebt haben. Leopold Tyrmand wurde 1920 in eine assimilierte jüdische Familie in Warschau hineingeboren, ging 1939 in den Widerstand nach Wilna, geriet in sowjetische Gefangenschaft, floh, besorgte sich einen französischen Pass und meldete sich – im Auge des Sturms ist es am sichersten – zum „Arbeitseinsatz im Reich“. 1943 wurde er Kellner im Parkhotel in Frankfurt am Main, und diese Zeit schrieb Tyrmand auf, in seinem herrlichen Roman „Filip“, 60 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung dieses Jahr auf Deutsch erschienen. Filip, der vermeintliche Franzose, haut die Nazibonzen übers Ohr, handelt mit Lebensmittelmarken, bezirzt mit ganz viel tiefem Herzeleid die Fräuleins, strotzt vor Überlebenswillen. Filip liebt Jazz – nach dem Krieg gründete Tyrmand den ersten Jazzclub Polens. Kein Buch beschreibt Deutschland im Krieg so wie dieses, ein Aberwitz, rasant, grandios.
Leopold Tyrmand: Filip. Frankfurter
Verlagsanstalt. 632 Seiten, 24 Euro.
Christine Dössel
EIN LIEBESBEWEIS
Klaus Pohl war dabei, als Peter Zadek 1999 „Hamlet“ inszenierte. Er spielte den Horatio und schrieb mit, was sich während der turbulenten Proben ereignete. Saufgelage, Wutausbrüche, Eitelkeiten. Angela Winklers Fluchtversuche vor der übergroßen Titelrolle; Zadeks Anstrengungen, sie zurückzuholen. Ein Buch des real gelebten Theaterwahnsinns, vor allem aber: der Theaterliebe. Eine Hommage auch an die Kollegen (viele davon tot). In der heimlichen Hauptrolle: der süffisante Ulrich Wildgruber, besetzt als Polonius – es war seine letzte Rolle vor seinem Freitod noch im selben Jahr. Pure Lesefreude. Und wehes Leseglück.
Klaus Pohl: Sein oder Nichtsein. Galiani. 286 Seiten, 23 Euro. Und als ungekürzte Autorenlesung auf CD.
EINE HERAUSFORDERUNG
Etwas für Theater-Nerds und Fans der Berliner Volksbühne – zumindest jener Ära, als Frank Castorf dort Intendant und Carl Hegemann Dramaturg und Begleitwortmusiker war: eine Sammlung von Hegemann-Texten (Essays, Nachrufe, Kommentare, Gespräche) aus den letzten 15 Jahren, die weit über das Theater hinausführen zu einer „Dramaturgie des Daseins“. Es geht um Schiller und Hölderlin, Wagner und Schlingensief, Marx und Materialismus, aber auch um Genuss, Liebe und Tod. Hegemann ist ein geistiger Lebemann.
Carl Hegemann: Dramaturgie des Daseins. Everyday live. Alexander Verlag. 445 Seiten, 33 Euro.
Martina Knoben
EINE HERAUSFORDERUNG
Einen „grafischen Essay“ nennt Anke Feuchtenberger ihr großformatiges Heft „Der Spalt“. Eine Erzählung in Bildern, in der Form eines Briefs an ihr „Kindeskind“, über das Leben als Frau, Mutter und Großmutter, in Corona-Zeiten, mit einem Hund. In ihren Kohlezeichnungen wurde das Licht buchstäblich freigekratzt. Das Werk einer großen Malerin. Anke Feuchtenberger: Der Spalt. Villa Stuck. 36 Seiten, 18 Euro.
EIN GROSSER SPASS
Mit „Asterix und der Greif“ hat sich Didier Conrad endgültig vom Asterix-Übervater Albert Uderzo emanzipiert. Er bleibt dessen Stil treu, aber mit starker eigener Handschrift. Conrads Zeichnungen sind actionreicher, die Porträts realistischer. Und die Schneelandschaften im neuem Band ohnehin ein großer Genuss. Jean-Yves Ferri, Didier Conrad: Asterix und der Greif. Egmont Ehapa. 48 Seiten, 6,90 Euro / geb. 12 Euro.
EIN LIEBESBEWEIS
„… und plötzlich standen wir auf einem Gipfel von der Größe eines Küchentisches und klammerten uns an die aus dem Schnee ragenden Eisenstangen des Gipfelkreuzes, starr vor Angst und begeistert zugleich“. Warum Menschen auf Berge steigen, obwohl es anstrengend, öde, manchmal lebensgefährlich und fast immer vollkommen nutzlos ist, lässt sich in „Berge im Kopf“, einem Klassiker des Nature Writing von Robert Macfarlane, nachlesen.
Robert Macfarlane: Berge im Kopf. Matthes & Seitz. 318 Seiten, 34 Euro.
Claudia Tieschky
EIN GROSSER SPASS
Manches am Sound der französischen Band La Femme erinnert an die Coolness der Zeit, als Element of Crime noch englisch sangen; dazu mischen sie kreuz und quer quietschbunte France-Gall-Aufgedrehtheit, Synthesizer, Trompeten, ungesüßte Texte. Verleitet eindeutig zu Bewegung.
La Femme: Paradigmes. Disque Pointu.
EINE HERAUSFORDERUNG
Adelheid Duvanel starb in einer Julinacht 1996 durch Unterkühlung im Wald bei Basel im Alter von sechzig Jahren. In ihrem Leben war sie von absurd vielen Katastrophen heimgesucht worden, als Teenager landete sie in der Psychiatrie, sie führte eine Ehe mit einem Maler, für den sie das eigene Malen aufgab, ihr Kind wurde drogenabhängig und aidskrank. Was sie hinterlassen hat, ist ein absolut makelloses eigenständiges Universum aus kurzen Texten: Mit präziser Sprache gemalte Szenen, heiter und manchmal ironisch erzählt, die still eskalieren, bis sich überwältigende Weltverlorenheit auftut. Das müsste abstoßen, weil man ja merkt, dass hier nichts mehr lovely wird. Aber immer überwiegt das faszinierend Unerwartete in den Geschichten der beunruhigenden Erzählerin Adelheid Duvanel, und man kann nicht genug davon bekommen. Jetzt liegen alle ihre Erzählungen in einem Band vor. Adelheid Duvanel: Fern von hier. Sämtliche Erzählungen. Limmat Verlag. 792 Seiten, 39 Euro.
Marie Schmidt
EINE HERAUSFORDERUNG
Eine Sechzehnjährige, ihre nur um genau 16 Jahre ältere Mutter, Konkurrenz, Liebe, Ablösung, das ganze ödipale Drama – oder wie man das nennt, wenn Männer und Väter nur als nette, hilflose Randfiguren mitspielen. Dazu die in einer schwarzen Familie aus Brooklyn auch materiell schmerzhafte Frage: Was haben wir eigentlich zu vererben? Jacqueline Woodsons „Alles glänzt“ ist ein Roman, hart wie ein Diamant, rhythmisch, berührend, nicht aus dem Kopf zu kriegen. Jacqueline Woodson: Alles glänzt. Piper. 208 Seiten, 22 Euro.
EINE HILFE
Man kann die Bücher des britischen Psychoanalytikers Adam Phillips schon auch als Ratgeber lesen. Vor allem hat er aber die ganze Weltliteratur im Rücken. Im deutschen Sprachraum gibt es eine Essayistik wie seine nicht. Dieses Jahr hat er ein Bändchen herausgebracht über ein gerade jetzt persönlich und politisch heikles Projekt: „On Wanting to Change“. Kann man sich (oder andere) überhaupt ändern? Will man? Die Fortsetzung heißt „On Getting Better“. Fürs nächste Jahr. Adam Phillips: On Wanting to Change. On Getting Better. Penguin. 160/176 S., 7,98/6,99 Euro.
EIN LIEBESBEWEIS
Die Zeile des Jahres: „How you lemonade all your sadness when you openin’ up?“ So die Rapperin Noname aus Chicago über das Gefühl beim Nachrichtenlesen. Optimistisch bleiben: schwierig. Wir bleiben dran. Noname: Rainforest. Single. Noname Publishing.
Kurt Kister
EIN GROSSER SPASS
Was Camilleris Commissario Montalbano für Sizilien ist, ist Hauptkommissar Kostas Charitos für die Athener Mordkommission. Sein Schöpfer Petros Markaris schreibt hinreißend. Mit jedem neuen Charitos-Roman versteht man das heutige Griechenland besser. Im jüngsten Fall geht es um einen toten, reichen Saudi, um linke Protestierer und um das Geld der anderen.
Petros Markaris: Das Lied des Geldes. Diogenes Verlag. 310 Seiten, 24 Euro.
EINE HERAUSFORDERUNG
Der Pianist Igor Levit macht keine halben Sachen. Sein jüngstes Werk, ambitioniert, geglückt: Schostakowitschs 24 Präludien und Fugen sowie die „Passacaglia on DSCH“ von Ronald Stevenson. Schostakowitsch ist sowieso heilig; Stevenson fast der helle Wahnsinn. Dreieinhalb Stunden großartigste Klaviermusik. Igor Levit: On DSCH. 3 CDs. Sony Classical.
EINE WIEDERENTDECKUNG
Ein einziges Buch über den Zweiten Weltkrieg? Dann Wassili Grossmans „Leben und Schicksal“ lesen. Jetzt gibt es noch eines, neu übersetzt. Es ist auch von Grossman und heißt „Stalingrad“. Der Name sagt alles, und das Buch sagt auf sehr vielen Seiten, manchmal pathetisch, warum diese Schlacht auf ewig mehr sein wird als nur Geschichte. 1952 ist „Stalingrad“ sehr zensiert auf Russisch erschienen; 70 Jahre später gibt es das rekonstruierte Meisterwerk auf Deutsch. Wassili Grossman: Stalingrad. Claassen Verlag. 1280 Seiten, 35 Euro.
Willi Winkler
EIN GROSSER SPASS
Die Ausstellung ist mittlerweile von Aachen nach London fortgezogen, aber den Katalog gibt es noch, „Dürer war hier“, ein Pracht- und Monumentalband, der die Reise des Malers 1520/21 in die Niederlande dokumentiert. Dürer wird gefeiert, aber er ist auf der Arbeit, malt, zeichnet, schreibt und sammelt Gesichter, Haare, Mützen, Gewandfalten für die Ewigkeit. Peter van den Brink: Dürer war hier. Michael Imhof Verlag. 680 Seiten, 49,95 Euro.
EIN LIEBESBEWEIS
Peter Jackson („Der Herr der Ringe“), hat 60 Stunden Filmmaterial der
Beatles von 1969 gesichtet und zu einer Dokumentation geschnitten. Nach 52 Jahren sind sie wieder da, unfassbar jung. Sie albern herum, zanken sich, machen begeistert Musik, obwohl es die letzten Aufnahmen sind, die vor der Trennung entstehen. Hier sind die vier wieder zusammen, die Götter des 20. Jahrhunderts. Für alle Menschen reinen Herzens: ein Geschenk.
The Beatles. Get Back. Regie: Peter Jackson. Drei Folgen, insgesamt sechs Stunden. Disney+.
Catrin Lorch
EINE HILFE
Kai Althoff gehört zu den bedeutendsten Malern überhaupt. Dass er immer noch nur in der Szene wirklich berühmt ist, wird sich so lange nicht ändern, wie er seine Gemälde und Zeichnungen in seltenen komplizierten Ausstellungsinstallationen mehr versteckt denn herzeigt. So ein Projekt war „Kai Althoff goes with Bernard Leach“ in der Londoner Whitechapel Gallery. Wobei diese Schau nicht nur zur Retrospektive gereicht hätte, sondern auch zum Trost im ersten Corona-Winter – wäre sie nicht im Lockdown verschwunden. Es ist zu hoffen, dass sich eine weitere Station findet, zum Glück ist gerade der elegante, in kupferrosa Leinen gebundene großformatige Katalog erschienen.
Kai Althoff Goes With Bernard Leach: With Forms and Templates for Effective Practice. Whitechapel Gallery. 100 Seiten, 70,95 Euro.
EINE WIEDERENTDECKUNG
Dass die amerikanische Musikerin Alice Coltrane mit einem neuen Glauben auch eine neue Musikrichtung annahm – nämlich den spirituellen Jazz –, wurde lange eher belächelt. Nun hat ihr Sohn Ravi eine Aufnahme wiederentdeckt, bei der sie in Sanskrit singt und sich selbst an der Wurlitzer-Orgel begleitet. Weswegen „Turiya Sings“ so einsam, so heilend und so eigenartig klingt, dass man am liebsten mitsummen würde, auf Sanskrit.
Alice Coltrane: Kirtan: Turiya Sings. Impulse!/Universal.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Schließen
Ein wohlhabender chinesischer Geschäftsmann ist der erste Tote, hinterrücks erstochen. Er wird nicht der einzige bleiben. Die Ermittlungen des Athener Kommissars Kostas Charitos samt Team bringen erstaunliche Gemeinsamkeiten der Todesopfer zu Tage. Alle hatten große Mengen Geld in …
Mehr
Ein wohlhabender chinesischer Geschäftsmann ist der erste Tote, hinterrücks erstochen. Er wird nicht der einzige bleiben. Die Ermittlungen des Athener Kommissars Kostas Charitos samt Team bringen erstaunliche Gemeinsamkeiten der Todesopfer zu Tage. Alle hatten große Mengen Geld in die Hand genommen und Investitionen getätigt. Aufgekauft, was in dem gebeutelten Land zu haben war. Die Sahnestücke aus dem Ausverkauf Griechenlands.
Die sozialen Ungleichheiten haben sich verschärft. Die Älteren werden entlassen, die Jüngeren zu Billiglöhnen eingestellt. Die Nachwirkungen der Krise sind allgegenwärtig. Die, die ihre Arbeit verloren haben, können die Miete nicht mehr bezahlen, wissen nicht mehr, wie sie über die Runden kommen sollen. Der unkontrollierte Flüchtlingszustrom bringt zusätzliche Probleme. Die Politik hat auf ganzer Linie versagt. Rechtspopulisten sind im Aufwind, die Linke hat sich mit dem System arrangiert, schielt nach politischer Macht, hat ihre ursprünglichen Ziele und ihre Wähler verraten.
Wie überall in Europa formiert sich auch in Athen der Widerstand. Eine kleine Gruppe, zuerst nur die Bewohner des Obdachlosenheims und eine Handvoll Migranten, angeführt von Kostas‘ Freund, dem Altlinken Lambros. Anfangs kommen nur wenige Teilnehmer zu den Kundgebungen, in denen die Linke zu Grabe getragen wird, doch der Zustrom wächst und wird zu einem Protest des Mittelstands, dem sich auch Kostas‘ Familienmitglieder anschließen, auch wenn er sich um ihre Sicherheit sorgt.
Spannungsliteratur entsteht nicht im luftleeren Raum und sollte deshalb auch die politischen Gegebenheiten in die Handlung einbeziehen. Dies leisten Petros Markaris‘ Kriminalromane, und „Das Lied des Geldes“ ist ein gelungenes Beispiel dafür. Er verankert seine Romane in der politischen Realität Griechenlands und zeigt eine Gesellschaft, die an der sozialen Ungleichheit zu zerbrechen droht. Lesen!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Lambros Sissis, bester Freund von Kommissar Charitos, kann das Elend im Obdachlosenheim nicht mehr mitansehen. Seine politischen Ideale sind gestorben, es bleibt nur noch die Linke, die seiner Ansicht nach auf ganzer Breite versagt hat, zu Grabe zu tragen. Er organisiert einen Trauerzug samt Sarg …
Mehr
Lambros Sissis, bester Freund von Kommissar Charitos, kann das Elend im Obdachlosenheim nicht mehr mitansehen. Seine politischen Ideale sind gestorben, es bleibt nur noch die Linke, die seiner Ansicht nach auf ganzer Breite versagt hat, zu Grabe zu tragen. Er organisiert einen Trauerzug samt Sarg durch Athen, was ihm entsprechende Aufmerksamkeit einbringt. Die Armen verbünden sich, nicht mehr nur die Obdachlosen am unteren Rand der Gesellschaft, auch die Flüchtlinge und die ehemalige Mittelschicht leiden und schließen sich der neuen Protestbewegung an. Zu Charitos‘ Schrecken sind auch seine Frau Adriani und Tochter Katerina aktiv im Kampf gegen die Kapitalisten. Und diese müssen sich auch ganz konkret fürchten, denn ein Mörder scheint es gezielt auf ausländische Investoren abgesehen haben. Erst ein saudi-arabischer Bauunternehmer, dann ein chinesischer Unternehmer werden heimtückisch in eine Falle gelockt und erstochen. Der Beginn einer Serie? Offenkundig, denn stets wird am Tatort auch ein Lied vernommen, ein Lied, das von Geld und Gier erzählt.
Immer wieder hat Petros Markaris in seiner Reihe um den Athener Kommissar Kostas Charitos gesellschaftliche Entwicklungen aufgegriffen und sich deutlich positioniert. Wurde im vorausgehenden Band die Heuchelei der griechischen Elite kritisiert, greift er nun in „Das Lied des Geldes“ sowohl die drängende Armut, die nach der Finanzkrise weite Teile der Bevölkerung erfasst hat, auf und thematisiert, wie die Not von geschäftstüchtigen, ausländischen Investoren ausgenutzt und dadurch noch weiter verschlimmert wird.
Es braucht nicht viel, um Lambros Sissis‘ Resignation nachvollziehen zu können. Das Leid unmittelbar vor Augen, ohne jede Hoffnung auf Besserung, kann man nur noch mit einem gewissen Zynismus reagieren, wenn man nicht vollends verzweifeln möchte. Dass er schnell aus allerlei Richtungen Unterstützer findet, ist nicht verwunderlich, sondern verstärkt eher das Gefühl von Machtlosigkeit ob der schon seit Jahren andauernden Krise. Der friedliche Protest glückt und gewinnt die Sympathien. Dass dies einigen jedoch vielleicht zu wenig ist, kann man menschlich nachvollziehen.
Geschickt wird so der Bogen zur eigentlichen Krimihandlung geschlagen, deren Opfer zu der Riege der Profiteure der Notlage gehören und die sich auf Kosten der Schwächsten bereichern. Auch wenn Charitos im Sinne der juristischen Gerechtigkeit unterwegs ist, bleibt die moralische eine gänzlich andere Frage.
Markaris erzählt nicht die nervenzerreißenden Geschichten, sondern jene zutiefst menschlich motivierten, die mit langsamerem Tempo jedoch deutlich mehr Tiefgang erreichen und die Finger in die Wunden legen, wo es weh tut. Seine authentischen Figuren sind die einfachen Menschen, die trotz mancher Widrigkeit versuchen, den Alltag zu meistern und ein rechtschaffenes Leben zu führen, bis ihnen das jedoch nicht mehr gelingt. Die Täter sind oft die eigentlichen Opfer und so zeigt auch „Das Lied des Geldes“, dass die Realität komplexer ist als nur schwarz und weiß und dass die Frage nach dem, was richtig und was falsch ist, durchaus moralisch herausfordernd werden kann.
Einmal mehr ein aufrüttelnder Roman, der Spannung mit Sozialkritik verbindet.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für