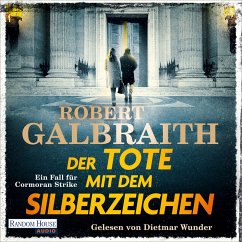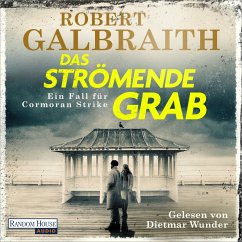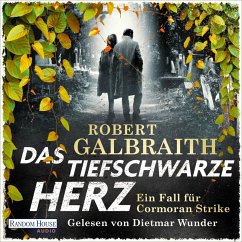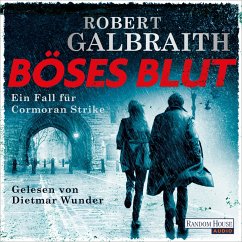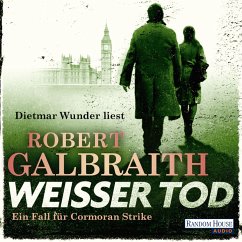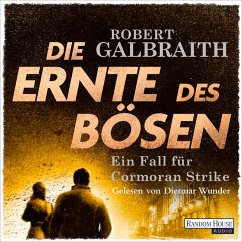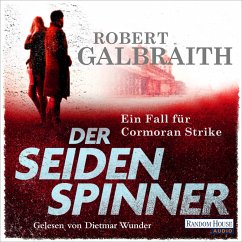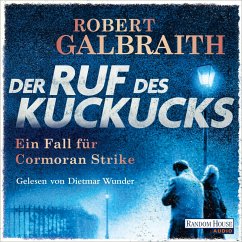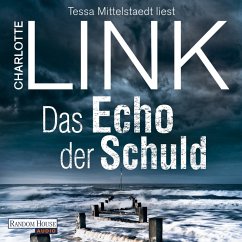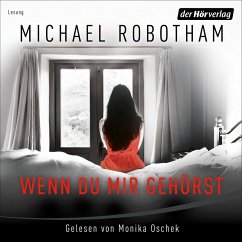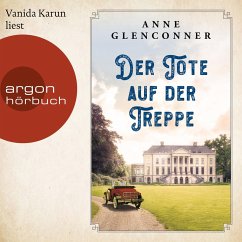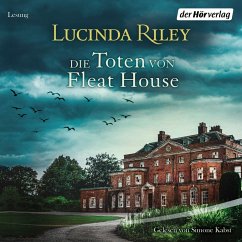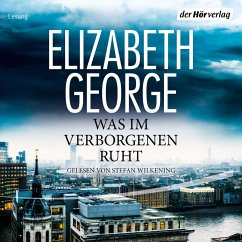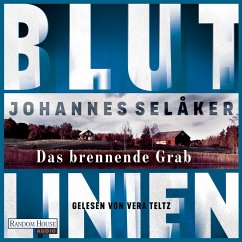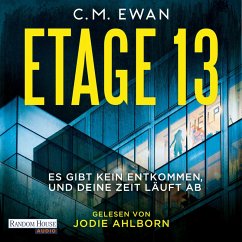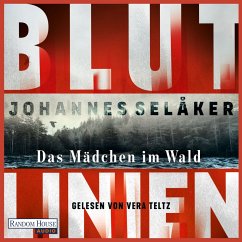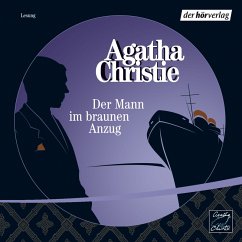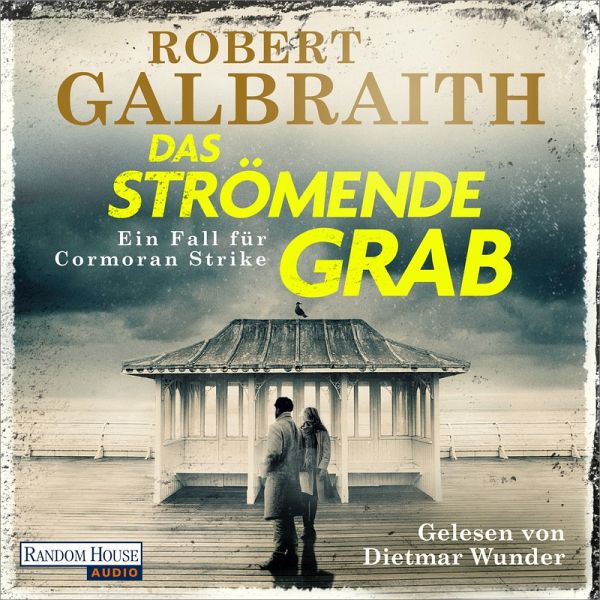
Das strömende Grab / Cormoran Strike Bd.7 (MP3-Download)
Ein Fall für Cormoran Strike Ungekürzte Lesung. 2058 Min.
Sprecher: Wunder, Dietmar / Übersetzer: Bergner, Wulf; Kurz, Kristof; Göhler, Christoph
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
35,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
18 °P sammeln!
Der spektakuläre siebte Kriminalfall von Top-2-SPIEGEL-Bestsellerautor Robert Galbraith, dem Pseudonym von J.K. Rowling, führt das Ermittlerduo Cormoran Strike und Robin Ellacott zu einer gefährlichen Sekte … Cormoran Strike wird von einem besorgten Vater kontaktiert, dessen Sohn Will sich im ländlichen Norfolk einer undurchsichtigen Glaubensgemeinschaft angeschlossen hat. Die Universal Humanitarian Church ist nach außen hin eine friedfertige Organisation, die sich für eine bessere Welt einsetzt. Doch Strike entdeckt bald, dass unter der harmlosen Oberfläche böse Machenschaften und u...
Der spektakuläre siebte Kriminalfall von Top-2-SPIEGEL-Bestsellerautor Robert Galbraith, dem Pseudonym von J.K. Rowling, führt das Ermittlerduo Cormoran Strike und Robin Ellacott zu einer gefährlichen Sekte … Cormoran Strike wird von einem besorgten Vater kontaktiert, dessen Sohn Will sich im ländlichen Norfolk einer undurchsichtigen Glaubensgemeinschaft angeschlossen hat. Die Universal Humanitarian Church ist nach außen hin eine friedfertige Organisation, die sich für eine bessere Welt einsetzt. Doch Strike entdeckt bald, dass unter der harmlosen Oberfläche böse Machenschaften und unerklärte Todesfälle lauern. Um Will zu retten, reist Strikes Geschäftspartnerin Robin Ellacott nach Norfolk, um sich der Sekte anzuschließen und inkognito unter den Mitgliedern zu leben. Doch sie ist nicht auf die Gefahren vorbereitet, die sie dort erwarten, geschweige denn auf den Preis, den sie wird zahlen müssen … Hören Sie auch die anderen Romane der packenden Cormoran-Strike-Reihe. Alle Bände können unabhängig voneinander gehört werden. »Mit Cormoran Strike und Robin Ellacott hat Galbraith/Rowling ein ungemein schillerndes und vielschichtiges Ermittlerduo kreiert. Die Dialoge der beiden sind pointiert, ohne bemüht witzig zu sein, die Charaktere stimmig entwickelt.« Hamburger Abendblatt »Rowling beherrscht ihr Handwerk. […] Immer will man wissen, wie es weitergeht.« SPIEGEL »Man bleibt dran, es macht fast süchtig […].« Süddeutsche Zeitung Ungekürzte Lesung mit Dietmar Wunder 34h 18min
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Entdecke weitere interessante Produkte
Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote