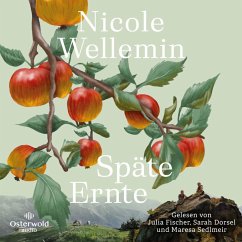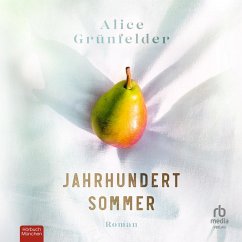Julia Schoch
Hörbuch-Download MP3
Das Vorkommnis / Biographie einer Frau Bd.1 (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 284 Min.
Sprecher: Arnhold, Sabine

PAYBACK Punkte
7 °P sammeln!





Eine Frau wird von einer Fremden angesprochen, die behauptet, sie hätten beide denselben Vater. Die überraschende Begegnung bleibt flüchtig, löst in ihr aber eine Welle von Emotionen aus. Fragen drängen sich auf, über Ehe und Mutterschaft, über Adoption und andere Familiengeheimnisse, über Wahrheit überhaupt. In Das Vorkommnis erzählt Julia Schoch - eine der eindrücklichsten Stimmen autofiktionalen Erzählens in der deutschen Literatur - von einem Leben, das urplötzlich eine andere Richtung bekommt. Fesselnd und klarsichtig, so zieht sie hinein in den Strudel der ungeheuerlichen Di...
Eine Frau wird von einer Fremden angesprochen, die behauptet, sie hätten beide denselben Vater. Die überraschende Begegnung bleibt flüchtig, löst in ihr aber eine Welle von Emotionen aus. Fragen drängen sich auf, über Ehe und Mutterschaft, über Adoption und andere Familiengeheimnisse, über Wahrheit überhaupt. In Das Vorkommnis erzählt Julia Schoch - eine der eindrücklichsten Stimmen autofiktionalen Erzählens in der deutschen Literatur - von einem Leben, das urplötzlich eine andere Richtung bekommt. Fesselnd und klarsichtig, so zieht sie hinein in den Strudel der ungeheuerlichen Dinge, die gleichzeitig auch alltäglich sind. Ein Roman von großer literarischer Tiefe und Schönheit, im Werk von Julia Schoch ein neuer Höhepunkt.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Julia Schoch, 1974 in Bad Saarow geboren, aufgewachsen in Mecklenburg, lebt als freie Schriftstellerin und Übersetzerin in Potsdam. Für ihr Werk erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, auch für ihre Übersetzungen französischer Literatur. Zuletzt erschien ihr Roman >Schöne Seelen und Komplizen<, mit dem sie - wie schon mit ihrem für den Preis der Leipziger Buchmesse nominierten Roman >Mit der Geschwindigkeit des Sommers< - auf Platz 1 der SWR-Bestenliste stand. Für ihr schriftstellerisches Gesamtwerk wird ihr 2022 die Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung verliehen.
Produktdetails
- Verlag: argon
- Erscheinungstermin: 10. Januar 2024
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783732474004
- Artikelnr.: 69599027
Perlentaucher-Notiz zur FAS-Rezension
Rezensentin Daniel Strigl wirkt etwas unentschlossen gegenüber Julia Schochs Roman, dem ersten Teil einer Trilogie; anfangs auch etwas skeptisch wegen des autofiktional klingenden Titels. Dann verfolgt sie aber doch interessiert die Geschichte, scheint es, die von einer Autorin und Mutter erzählt, deren Leben durch das Auftauchen einer Halbschwester aus den Fugen gerät. Wie Schoch davon erzählt, wie der Glauben der Icherzählerin an das Konzept Familie bröckelt und nach und nach zu einer regelrechten Ablehnung und Paranoia gegenüber ihrem Ehemann wird, scheint sie zumindest überzeugend zu finden, auch wenn sie Probleme mit der Umsetzung des Worts "Vorkommnis" hat - so wird sie den Eindruck einer "künstlich erzeugten Bedeutsamkeit" nicht recht los. Auch dass bei Schoch nichts unausgesprochen bleibt, gefällt ihr nicht besonders - immerhin das "Verwirrspiel" um Fiktion und Realität bleibe ungeklärt. Woraus die Folgebände ihre "Dynamik" ziehen werden, erwartet Strigl gespannt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Die ungeheure Dichte der Korrespondenzen zwischen allen Ebenen des Romans erzeugt ein so reiches 3-DPuzzle, dass man am Abglanz des Lebens darin seine Freude hat, auch wenn es ein entgleisendes Leben ist. Julia Schoch hat einen neuen Weg eingeschlagen. Wir folgen gespannt. Hubert Winkels Süddeutsche Zeitung 20220331
Gebundenes Buch
Familienaufstellung
„Das Vorkommnis“ von Julia Schoch beschäftigt sich mit der Wirkung, die das plötzliche Auftauchen einer Halbschwester im Leben einer Frau haben kann. Der Roman beginnt direkt mit eben diesem Vorkommnis: nach einer Lesung tritt eine Frau auf die …
Mehr
Familienaufstellung
„Das Vorkommnis“ von Julia Schoch beschäftigt sich mit der Wirkung, die das plötzliche Auftauchen einer Halbschwester im Leben einer Frau haben kann. Der Roman beginnt direkt mit eben diesem Vorkommnis: nach einer Lesung tritt eine Frau auf die Protagonistin zu und erklärt, sie hätten beide denselben Vater. Die Protagonistin umarmt die Frau kurz und setzt dann ihre Lesereise fort. Zunächst scheint sie die Begegnung mit der angeblichen Halbschwester eher als Randereignis zu sehen, das nicht weiter ernst zu nehmen ist. Doch langsam aber sicher beginnt die Protagonistin ihre Beziehungen und ihre Erinnerungen zu hinterfragen und in neuem Licht zu sehen.
Mir hat der Aufbau des Romans sehr gut gefallen: der direkte Einstieg in die überraschende Begegnung und daran anschließend die verschiedenen Stadien, die die Protagonistin in der Auseinandersetzung mit sich und ihrem Umfeld nach der Begegnung durchläuft. Auch sprachlich hat mich der Roman gepackt mit seiner klaren und präzisen Schreibweise. Nur in manchen Kapiteln hat mich die Autorin etwas verloren, da Einzelheiten so detailliert beleuchtet wurden, dass ich fast nicht folgen konnte. Alles in allem aber ein toller Roman, der mir beim Lesen viel Spaß gemacht hat.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Als die autofiktional schreibende Schriftstellerin auf einer Lesung einer Frau begegnet, die ihr mitteilt, sie hätten denselben Vater, ist das der Beginn einer Selbstreflexion, die die eigenen Familienverhältnisse, die Kindheit, die Ehe, den Beruf in Frage stellt. Während eines …
Mehr
Als die autofiktional schreibende Schriftstellerin auf einer Lesung einer Frau begegnet, die ihr mitteilt, sie hätten denselben Vater, ist das der Beginn einer Selbstreflexion, die die eigenen Familienverhältnisse, die Kindheit, die Ehe, den Beruf in Frage stellt. Während eines Studienaufenthalts in den USA mit den Kindern und der Mutter stellt sie sich den Erinnerungen an den Vater und der eigenen Kindheit in der sich auflösenden DDR. Gleichzeitig stellt sich die Frage nach der Bedeutung der eigenen Beziehung zum Vater ihrer Kinder. In diesem fast essayistischen Roman werden eindringliche Fragen gestellt nach der Wahrheit der Wahrnehmung, nach der Bedeutung von Literatur als Aufarbeitung der eigenen Geschichte. Was ist Fiktion, was ist Wahrheit? Es handelt sich um den ersten von drei geplanten Bänden der "Biographie einer Frau". Man kann auf die Fortsetzung gespannt sein.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Eine Frau, vielleicht Julia Schoch, vielleicht eine andere, wird auf einer Lesung angesprochen. Und zwar mit der Aussage, sie und die Ansprechende hätten denselben Vater. Was die Protagonistin nicht verwundert, denn der Umstand, dass es irgendwo eine weitere mögliche Schwester gibt, ist …
Mehr
Eine Frau, vielleicht Julia Schoch, vielleicht eine andere, wird auf einer Lesung angesprochen. Und zwar mit der Aussage, sie und die Ansprechende hätten denselben Vater. Was die Protagonistin nicht verwundert, denn der Umstand, dass es irgendwo eine weitere mögliche Schwester gibt, ist ihr bekannt - schon seit Ewigkeiten, sie weiß gar nicht, wie lange schon.
Diese Begebenheit wird der Protagonistin zum Anlass, sich selbst, ihr Verhältnis zu ihren Verwandten und zu ihrem Umfeld zu hinterfragen und zu beleuchten. Ja, es ist etwas von alledem und weil die Autorin Julia Schoch wundervoll zu schreiben vermag, habe ich ihren Text, den sie als Roman bezeichnet, durchaus genossen. Auch wenn er mich sehr verwirrt hat, aber das haben ihre Bücher so an sich, bei der Lektüre von "Schöne Seelen und Komplizen" war meine Verwirrung noch viel größer.
Es sind nicht die Geschehnisse, auf denen das Hauptaugenmerk der Autorin liegt, nein, es sind die Gedanken der Hauptfigur, der geistige, innere Umgang mit ihrem eigenen Hier und Jetzt, mit ihrer Vergangenheit und einer möglichen Zukunft, die im Fokus stehen.
Es scheint, als würde die Protagonistin sich oft selbst nicht verstehen, ihr Handeln in Frage stellen - vieles aber auch zu entschuldigen. Ich wundere mich beispielsweise über die vielen Freiheiten, die sie sich während ihres Arbeitsaufenthaltes in den Vereinigten Staaten nimmt, wo sie sich in Begleitung ihrer Kinder und ihrer Mutter aufhält. Eine Art ständige Bereitschaft zur Toleranz mit sich selbst kommt da bei mir an, die mir fremd ist.
Auf der anderen Seite gab es immer wieder auch Momente, in denen ich die Erzählerin nur zu gut verstehe, weil ich ähnliches durchlebt habe. Zum Beispiel in Bezug auf das unangenehme "Erwischt-Werden" durch andere Menschen, auch durch die nächsten Verwandten: "Ich glaube, die Wahrheit, um die es den meisten von uns geht, ist am ehesten dort zu finden, in jenen Momenten und Situationen, in denen unsere Existenz keine Zeugen hat." (S. 115)
Diese Passage bietet zugleich einen Einblick in die besondere Sprache der Autorin: ein ungewöhnlicher, sehr reicher Stil, sowohl was den Wortschatz als auch was die Bezugnahme auf andere Texte angeht.
Willkommen im Universum der Julia Schoch! Der Leser wird nicht wenig gefordert, was seine Aufmerksamkeit, seine Bereitschaft, in die Gedankenwelt der Protagonistin einzusteigen, angeht. Er bekommt aber - so meine Meinung - auch viel zurück: einen eleganten, facettenreichen literarischen Text, der mit nichts anderem zu vergleichen ist.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
eBook, ePUB
Zum Inhalt:
Bei einer Lesung wird eine Frau von einer ihr fremden Frau angesprochen, die ihr sagt, dass sie den gleichen Vater haben. Es bleibt bei einer kurzen Begegnung, löst aber enorme Emotionen aus. Plötzlich werden für die Frau fragen der Vergangenheit aufgewühlt, die sie …
Mehr
Zum Inhalt:
Bei einer Lesung wird eine Frau von einer ihr fremden Frau angesprochen, die ihr sagt, dass sie den gleichen Vater haben. Es bleibt bei einer kurzen Begegnung, löst aber enorme Emotionen aus. Plötzlich werden für die Frau fragen der Vergangenheit aufgewühlt, die sie enorm beschäftigen. Auf wird ihr Gefühlsleben völlig auf den Kopf gestellt.
Meine Meinung:
So ein ungewöhnliches, aber auch ungeheuer interessantes Buch habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Ich kann gar nicht so richtig sagen, was den Reiz des huches ausmacht, es ist einfach gut. Sehr gut und irgendwie besonders geschrieben. Ein Buch, dass schon eine ganze Weile im Kopf bleiben wird. Es hatte fast etwas poetisches, etwas leichtes, aber auch viel schwermütiges. Zum Beispiel wie relativ kühl über das Kind gesprochen wurde. Irgendwie fehlen mir die Worte um dieses Buch wirklich zu würdigen.
Fazit:
Außergewöhnlich
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
eBook, ePUB
Nach der Lesung wird die Autorin von einer Frau angesprochen: „Wir haben übrigens denselben Vater“. Obwohl diese Begegnung flüchtig ist, löst sie in der Protagonistin doch einiges aus.
Dieser Roman ist der Auftakt zu der Reihe „Biographie einer Frau“. Der …
Mehr
Nach der Lesung wird die Autorin von einer Frau angesprochen: „Wir haben übrigens denselben Vater“. Obwohl diese Begegnung flüchtig ist, löst sie in der Protagonistin doch einiges aus.
Dieser Roman ist der Auftakt zu der Reihe „Biographie einer Frau“. Der Schreibstil ist anspruchsvoll und schon besonders, aber auch distanziert. Es werden keine Namen genannt in diesem Roman.
Ich kann nicht verstehen, warum dieser Satz der Fremden so viel in der Protagonistin auslöst. Die Tatsache, dass ihr Vater ein uneheliches Kind hatte, war ihr doch wohl nicht unbekannt. Ihre Gedanken drehen sich um ihr Leben, ihre Familie, ihre Ehe und ihr Muttersein. Sie stellt alles in Frage, wird unsicherer und verliert ein wenig den Boden unter den Füßen. Die Gedanken springen hin und her und führen zu keinem Ergebnis. Ich konnte mich in die Erzählerin nicht hineinversetzen; sie kam mir nicht nahe und war mir auch nicht sympathisch.
Dieses Buch konnte mich nicht erreichen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
In dem Roman "Das Vorkommnis" berichtet die Protagonistin, eine Schriftstellerin, in der Ich-Form wie sie auf einer Lesung von einer Fremden angesprochen wird, die vorgibt ihre Halbschwester zu sein. Nach dieser Begegnung kommt es zunächst zu keinem weiteren Treffen. Trotzdem wirft …
Mehr
In dem Roman "Das Vorkommnis" berichtet die Protagonistin, eine Schriftstellerin, in der Ich-Form wie sie auf einer Lesung von einer Fremden angesprochen wird, die vorgibt ihre Halbschwester zu sein. Nach dieser Begegnung kommt es zunächst zu keinem weiteren Treffen. Trotzdem wirft dieses Vorkommnis eine ganze Reihe von Fragen auf, trügerische Erinnerungen werden geschildert, genauso die Beziehungen zur leiblichen Schwester, die Geschichte der Eltern und Großeltern. Auch die verlebte Kindheit in der DDR wird angerissen. Die meisten Kapitel spielen jedoch in Bowling Green, einer Kleinstadt in den USA, in der die Protagonistin als Dozentin arbeitet.Ihre Mutter und ihre Kinder sind dabei, ihr Mann bleibt in Deutschland zurück und spielt nur eine Nebenrolle.
Die Kapitel sind episodenhaft. Viele Gedanken sind absolut nachvollziehbar, viele aber auch unerklärlich - wie das Misstrauen ihrem Mann gegenüber. Es bleibt so vieles "in der Luft hängen", es wird in der Zeit mehrfach hin- und her gesprungen. Es fehlt dem Buch eine nochvollziehbare Handlung. Die Gefühle der Ich-Erzählerin, sind sie auch noch so irritierend, werden dafür absolut eindrücklich geschildert.
Die weiteren Personen werden nur "Mutter" "Mann" "älteres Kind" "Schwester" genannt, deshalb bleibt man distanziert als Zuschauerin und kann keinerlei emotionale Bindung aufbauen. Das ist sicher so gewollt, aber für meinen Geschmack bleibt man irgendwie außen vor. Für mich war das eher ermüdend. Die Gedanken der Protagonistin sind beeindruckend in Worte gefasst, aber es wird keine runde Geschichte daraus. Es ist nicht fertig erzählt und das lässt mich irgendwie unzufrieden zurück.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Zum Nachdenken
Zum Anfang finde ich das Cover des Buches sehr schön gestaltet es passt gut zur Handlung.
In der Geschichte geht es um eine Autorin welche wiederum eine andere Frau trifft, die behauptet sie hätten denselben Vater. Dies löst in der Hauptperson etwas aus. Sie …
Mehr
Zum Nachdenken
Zum Anfang finde ich das Cover des Buches sehr schön gestaltet es passt gut zur Handlung.
In der Geschichte geht es um eine Autorin welche wiederum eine andere Frau trifft, die behauptet sie hätten denselben Vater. Dies löst in der Hauptperson etwas aus. Sie denkt über vieles aus ihrem Leben nach.
Es werden viele verschiedene Themen, wie uneranderm Familienprobleme oder Beziehungen. Außerdem wurde die Zeit der DDR erwähnt.
Das Ganze wird von der Frau erzählt, welche rückblickend auf die Geschehnisse sieht. Ihre Gedankengänge sind nachvollziehbar und mitreißend geschrieben. Man kann außerdem noch lange darüber nachdenken.
Eine Begegnug kann sehr viel auslösen und vieles Verändern. Das Buch beschreibt die sehr gut. Alles ist sehr realistisch. Man kann sich sofort in die Protagonistin hineinversetzen und die Atmosphäre ist sehr fesselnd.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Das Buch hat mich gleichermaßen gepackt wie auch mit einem großen Fragezeichen zurück gelassen. Wirklich sehr erfrischend finde ich, dass es nur 191 Seiten hat und damit für einen Schnellleser wie mich ein kleiner Happen zwischendurch ist. Vor allem war ich ab der ersten Minute …
Mehr
Das Buch hat mich gleichermaßen gepackt wie auch mit einem großen Fragezeichen zurück gelassen. Wirklich sehr erfrischend finde ich, dass es nur 191 Seiten hat und damit für einen Schnellleser wie mich ein kleiner Happen zwischendurch ist. Vor allem war ich ab der ersten Minute in einem absoluten Leseflow und inhaltlich komplett drin. Es ist zugleich einfach geschrieben, als auch total gehoben. Wie auch das Cover des Buches es vermuten lässt, ist es eben kein Teenieroman, sondern Literatur. Es wird von alten Zeiten in der DDR erzählt, aber gleichermaßen wird eine Serie wie Dexter zitiert. Ein Buch, dass gleichzeitig über sehr Vieles schreibt, aber inhaltlich keine richtige Geschichte hat.
Im Fazit hat mich das Buch trotz einer gewissen Barriere des Covers und der inhaltlichen Schwere mit der leichten Erzählung und der packenden Schreibweise zumindest auf den 191 Seiten unterhalten. Für eine kleine Geschichte zwischendurch kann ich es empfehlen. Wer eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Thematik „Halbgeschwister“ erwartet, findet sich hier eher in einer Biografie wieder.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Auf einer Lesung wird die Autorin von einer Frau angesprochen: sie hätten denselben Vater. Später schreibt sie ihr, sie antwortet. Die ganze Situation bleibt stehen wie ein schwacher Abdruck eines doch so monumentalen Ereignisses. Dabei ist die unerwartete Begegnung der Startschuss …
Mehr
Auf einer Lesung wird die Autorin von einer Frau angesprochen: sie hätten denselben Vater. Später schreibt sie ihr, sie antwortet. Die ganze Situation bleibt stehen wie ein schwacher Abdruck eines doch so monumentalen Ereignisses. Dabei ist die unerwartete Begegnung der Startschuss für die Infragestellung eines ganzen Lebens.
Die feine Raffinesse des Romans liegt darin, dass er sich inhaltlich primär gar nicht mit dem „Vorkommnis“ beschäftigt. Als sei es nur eine Randnotiz. Die "Handlung" ist das emotionale Chaos, in das die Protagonstin gestürzt wird. Trotzdem wird es auf keiner Seite langweilig.
Erst im Laufe der Rückblicke der Ich-Erzählerin schält sich heraus, welch radikalen Einschnitt allein dieses neue Wissen auf ihr Leben hat. Der Blick auf ihre Beziehungen zu Eltern, Schwester, Ehemann und eigenen Kindern bekommt einen völlig neuen Winkel. Und was ¬sagt ihre so veränderte Vergangenheit eigentlich über sie selbst aus? Kann das Wissen darum ihre Gegenwart und Zukunft grundlegend verändern, obwohl es faktisch für sie keine Auswirkungen nach sich zieht?
Die Geschichte dieser Frau ist auch die der deutsch-deutschen Trennung, von Generationen- und Geschlechterkonflikten, Elternschaft und der Sehnsucht nach Macht über die eigene Geschichte.
Beeindruckend, wie Schoch es schafft, so viel auf so wenigen Seiten unterzubringen. Dabei zeigt sie Stilsicherheit und eine berührende Kombination aus Rohheit und schonungsloser Empfindsamkeit, die ich sehr mutig und ansprechend zu lesen fand. Die Geschichte hätte auch genau hier so stehen bleiben können, ein wenig unvollendet wie eben vieles im Leben. Da dies nur der Auftakt einer Trilogie ist, werden wir aber sicher bald mehr erfahren. Ich freu mich drauf.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
„Das Vorkommnis“ Biographie einer Frau von Julia Schoch
Auf einer Lesung wird die Autorin von einer fremden Frau angesprochen, die sich ihr als ihre Halbschwester vorstellt. Dieses Ereignis verändert alles. Was gewesen ist erscheint als Lüge, was die Zukunft bringt macht …
Mehr
„Das Vorkommnis“ Biographie einer Frau von Julia Schoch
Auf einer Lesung wird die Autorin von einer fremden Frau angesprochen, die sich ihr als ihre Halbschwester vorstellt. Dieses Ereignis verändert alles. Was gewesen ist erscheint als Lüge, was die Zukunft bringt macht misstrauisch. Wir tauchen tief ein in die Gefühls- und Gedankenwelt der Protagonistin. Und dennoch erfahren wir durch die sprachliche Eleganz der Autorin eine kühle Distanz. Die Schlagkraft dieses Vorkommnisses ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich, sondern halt nach und bewegt sich wie eine verschlingende Lavamasse durch ihr das Leben. Plötzlich wird alles was feststand in Frage gestellt. Die liebsten Menschen sind plötzlich fremd und fern vom eigenen Selbst. Die Gedanken verstricken sich in Kreisen und nehmen immer absurdere, teils paranoide Züge an. Julia Schoch hat hier in Worte verpackt was einem selbst in den eigenen Gedanken wirr vorkommt. Sie beherrscht das Wort wie ein Instrument und komponiert aus dem Ereignis ein Gebilde von allumfassender Klarheit.
Dies ist der erste Band einer Trilogie. Dennoch empfinde ich das Werk als vollkommen und bin wirklich neugierig auf welche Art und Weise Julia Schoch diese Reihe fortführen wird.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für
Entdecke weitere interessante Produkte
Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote