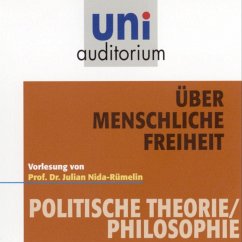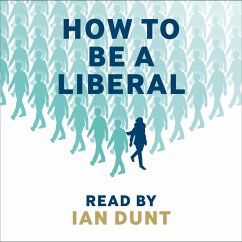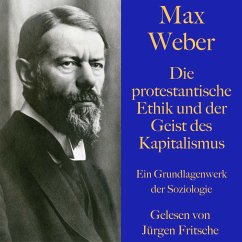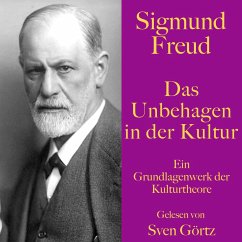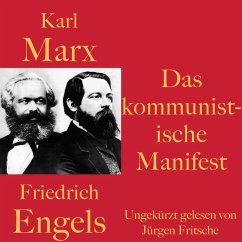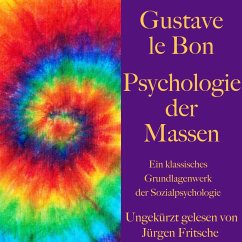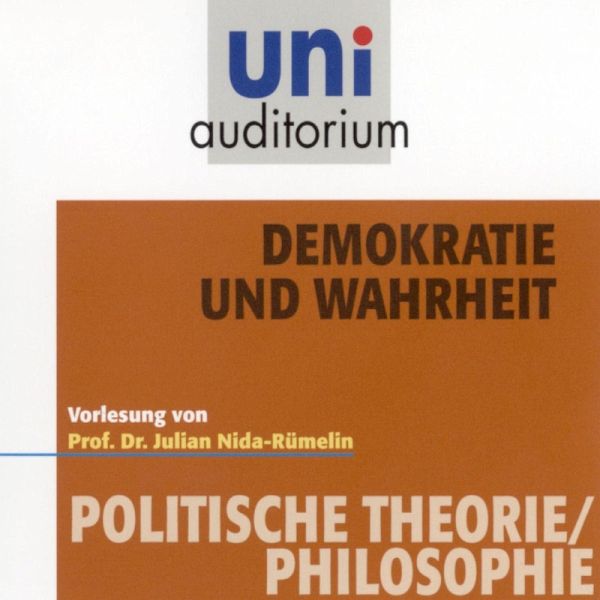
Demokratie und Wahrheit (MP3-Download)
Gekürzte Lesung. 47 Min.
Sprecher: Nida-Rümelin, Julian
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
8,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
4 °P sammeln!
Entgegen der verbreiteten Auffassung, das Wahrheitsansprüche in der Demokratie unangemessen seien, begründet Nida-Rümelin die These, dass ohne normative Wahrheitsansprüche die demokratische Gesellschaft und Politik undenkbar seien. Die demokratische Ordnung beruht auf normativen Überzeugungen, wie die der Toleranz aus Respekt und der gleichen Freiheit aller Menschen.
Wenn die Überzeugungen zur Disposition stünden, wäre auch die Demokratie als Lebensform obsolet.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.