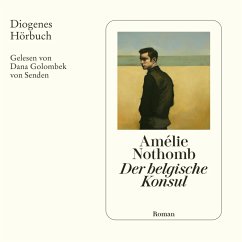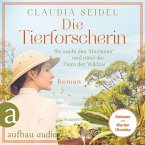Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Das Herz der Finsternis schlug schon in den Ardennen: Amélie Nothombs Roman "Der belgische Konsul" über das Leben ihres Vaters.
Die größte Geiselnahme des zwanzigsten Jahrhunderts fand Anfang November 1964 statt, und eines ihrer Opfer war Patrick Nothomb, erst seit drei Monaten belgischer Generalkonsul in Stanleyville (heute Kinsangani), der Metropole des Ost-Kongo und ein wichtiger Operationsort der damaligen Simba-Rebellion, die mit sowjetischer und kubanischer Hilfe ein kommunistisches Regime im 1960 unabhängig gewordenen Kongo etablieren wollte. Die Rebellen setzten in Stanleyville an die 1400 Menschen fest, überwiegend Weiße, aber auch Schwarze, die ihnen als ideologisch unzuverlässig erschienen. An die hundert Geiseln wurden ermordet, bis am 24. November eine kombinierte belgisch-amerikanische Befreiungsaktion durchgeführt wurde. Nothomb hatte überlebt, obwohl er die politisch höchstrangige Geisel war. Oder auch gerade deswegen: Er hatte die Forderungen der Rebellen zu übermitteln. Im Gegenzug bemühte er sich um Aufschübe geplanter Hinrichtungen. Eine davon hatte ihm selbst gedroht. Was aus seiner Sicht damals geschah, schrieb er fast dreißig Jahre später auf. Sein Buch "Dans Stanleyville" ist jedoch längst vergriffen.
Nun gibt es wieder zu lesen über Patrick Nothomb. Seine drei Jahre nach den Ereignissen von 1964 im japanischen Kobe, der nächsten diplomatischen Station des Konsuls, geborene Tochter Amélie, mittlerweile seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen in französischer Sprache, hat den Tod ihres Vaters im Jahr 2020 zum Anlass genommen, noch einmal für ihn die Stimme zu erheben: in einem Roman namens "Premier sang" (Erstes Blut), das nun in deutscher Übersetzung als "Der belgische Konsul" erschienen ist. Der Unterschied im Titel ist einer ums Ganze: Er verschiebt die Gewichtung des Erzählten von der frühen Jugend Patrick Nothombs zum spektakulären Höhepunkt seines Lebens, der Geiselnahme. Das ist verführerisch; auch diese Rezension hat ja entsprechend angefangen. Doch als der Patrick Nothomb des Romans 1964 Konsul wird, hat er schon längst zum ersten Mal Blut gesehen. Und das kann er nicht: Blut sehen. Als er es in seiner Kindheit zum ersten Mal tut, fällt er in Ohnmacht. So wird es sein Leben lang bleiben.
Von diesem Leben erzählt der Roman seiner Tochter aber nur die 28 ersten Jahre, bis Stanleyville. Dort spielen sich Beginn und Finale ab - als Rahmung für die ungleich längere Schilderung von Kindheit und Jugend. Patrick Nothombs Vater stirbt schon in dessen erstem Lebensjahr, und so sind die beiden prägenden Männer in seinem jungen Leben die Großväter: mütterlicherseits ein alter General, väterlicherseits ein adliger Dichter. Den in den tiefsten Ardennen gelegenen Herrensitz dieses Barons und vor allem dessen Kinderschar ("ein Tornado", deren jüngster Bestandteil aus zweiter Ehe nicht älter ist als Patrick selbst) besucht der Enkel erstmals mit sechs, und was er dort erlebt, ist haarsträubend. Es hieße jedoch, den größten Reiz der Lektüre dieses Romans zu beseitigen, würde man es hier mehr als andeuten.
Also sei nur gesagt, dass der kleine Patrick Hunger- und Kälteproben durchlebt, dazu anhand der von keinem Zug der Moderne berührten Lyrik seines Großvaters (und gegen sie) sein literarisches Grundverständnis erwirbt - und aus einem diesbezüglichen Missverständnis heraus die besondere Gunst des Barons. Vor allem jedoch erlebt der kleine Junge seine Ferienzeiten in dessen Schloss als großes Abenteuer, ungeachtet des Entsetzens von Mutter und anderem Großelternpaar über die Zustände in den Ardennen. Amélie Nothomb lässt ihren kleinen Icherzähler eine Reise ins Herz der Finsternis erleben, für die es den späteren Weg in den Kongo gar nicht gebraucht hätte - sie wird nurmehr konsequente Fortsetzung des Abenteuerspiels der Jugend sein, und das paradoxe Freiheitsgefühl in höchst prekären Umständen wird sich dort noch einmal wiederholen.
So ist "Der belgische Konsul" ein psychologisch ausgefuchstes Stück Literatur, das aber allemal auch über den für Amélie Nothomb typischen Witz verfügt - man denke nur an "Der japanische Verlobte" -, der hier meist auf Kosten des tumben Tors geht, der Patrick als Kind notgedrungen ist. Wobei sein notorisch gut gelaunter Blick auf eine Welt, die sich gleichzeitig im Zweiten Weltkrieg befindet, unterschwellig ständig als bedroht gekennzeichnet ist, denn einmal wissen wir ja durch den dreiseitigen Kongo- Prolog, der ihn und damit auch uns Leser bis vors Peloton geführt hat, was in dieser Welt möglich ist. Und dann ist es zwar eine scheinnaive Perspektive, die der Icherzähler einnimmt, aber die ganze Rückblende auf seine jungen Jahre erfolgt aus der Situation des Todgeweihten heraus - als erzählerische Analogie zu jener Lebensbilderfolge, die angeblich im Moment des Sterbens noch einmal an einem vorbeizieht. Und diese erwachsene Sicht der Dinge ist durch die leise Ironie des Textes auch immer präsent.
Dieser Roman hat 140 Seiten, und man benötigt keine drei Stunden dafür. Aber man hätte gerne sehr viel mehr Zeit in Patricks Welt verbracht. Dass Amélie Nothomb für dieses Werk ihre bisher wichtigsten literarischen Auszeichnungen erhalten hat, den französischen Prix Renaudot und den italienischen Premio Strega, ist nur konsequent angesichts des virtuosen Spiels, das sie darin mit der Fiktionalisierung von Realität treibt. Alles klingt wie eine Nacherzählung von skurriler Familiengeschichte, doch sobald man an der Oberfläche kratzt, kommt darunter anderes zum Vorschein: eine Jugend, die als Satyrspiel dem Drama vorausgeht, das wir zwanzigstes Jahrhundert nennen. ANDREAS PLATTHAUS
Amélie Nothomb: "Der belgische Konsul". Roman.
Aus dem Französischen von Brigitte Große. Diogenes Verlag, Zürich 2023. 143 S., geb., 23,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main