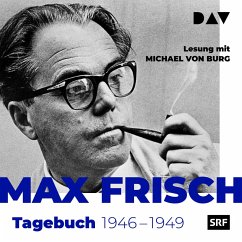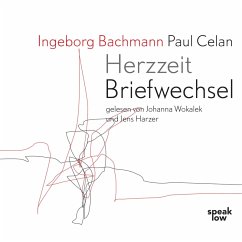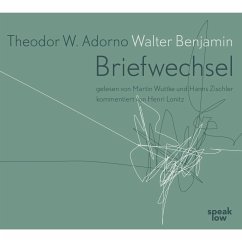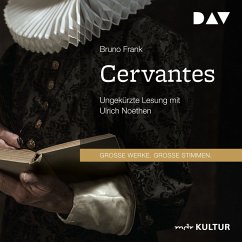Der Briefwechsel (MP3-Download)
Gekürzte Lesung. 298 Min.
Sprecher: Harzer, Jens; Fellinger, Raimund; Noethen, Ulrich

PAYBACK Punkte
7 °P sammeln!





gelesen von Jens Harzer und Ulrich Noethen, kommentiert von Raimund Fellinger
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Peter Handke wird am 6. Dezember 1942 in Griffen (Kärnten) geboren. Die Familie mütterlicherseits gehört zur slowenischen Minderheit in Österreich; der Vater, ein Deutscher, war in Folge des Zweiten Weltkriegs nach Kärnten gekommen. Zwischen 1954 und 1959 besucht Handke das Gymnasium in Tanzenberg (Kärnten) und das dazugehörige Internat. Nach dem Abitur im Jahr 1961 studiert er in Graz Jura. Im März 1966, Peter Handke hat sein Studium vor der letzten und abschließenden Prüfung abgebrochen, erscheint sein erster Roman Die Hornissen. Im selben Jahr 1966 erfolgt die Inszenierung seines inzwischen legendären Theaterstücks Publikumsbeschimpfung in Frankfurt am Main in der Regie von Claus Peymann. Seitdem hat er mehr als dreißig Erzählungen und Prosawerke verfasst, erinnert sei an: Die Angst des Tormanns beim Elfmeter (1970), Wunschloses Unglück (1972), Der kurze Brief zum langen Abschied (1972), Die linkshändige Frau (1976), Das Gewicht der Welt (1977), Langsame Heimkehr (1979), Die Lehre der Sainte-Victoire (1980), Der Chinese des Schmerzes (1983), Die Wiederholung (1986), Versuch über die Müdigkeit (1989), Versuch über die Jukebox (1990), Versuch über den geglückten Tag (1991), Mein Jahr in der Niemandsbucht (1994), Der Bildverlust (2002), Die Morawische Nacht (2008), Der Große Fall (2011), Versuch über den Stillen Ort (2012), Versuch über den Pilznarren (2013). Auf die Publikumsbeschimpfung 1966 folgt 1968, ebenfalls in Frankfurt am Main uraufgeführt, Kaspar. Von hier spannt sich der Bogen weiter über Der Ritt über den Bodensee 1971), Die Unvernünftigen sterben aus (1974), Über die Dörfer (1981), Das Spiel vom Fragen oder Die Reise zum sonoren Land (1990), Die Stunde da wir nichts voneinander wußten (1992), über den Untertagblues (2004) und Bis daß der Tag euch scheidet (2009) über das dramatische Epos Immer noch Sturm (2011) bis zum Sommerdialog Die schönen Tage von Aranjuez (2012) zu Die Unschuldigen, ich und die Unbekannte am Rand der Landstraße (2016). Darüber hinaus hat Peter Handke viele Prosawerke und Stücke von Schriftsteller-Kollegen ins Deutsche übertragen: Aus dem Griechischen Stücke von Aischylos, Sophokles und Euripides, aus dem Französischen Emmanuel Bove (unter anderem Meine Freunde), René Char und Francis Ponge, aus dem Amerikanischen Walker Percy. Sein Werk wurde mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet. Die Formenvielfalt, die Themenwechsel, die Verwendung unterschiedlichster Gattungen (auch als Lyriker, Essayist, Drehbuchautor und Regisseur ist Peter Handke aufgetreten) erklärte er selbst 2007 mit den Worten: »Ein Künstler ist nur dann ein exemplarischer Mensch, wenn man an seinen Werken erkennen kann, wie das Leben verläuft. Er muß durch drei, vier, zeitweise qualvolle Verwandlungen gehen.« 2019 wurde Peter Handke mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Siegfried Unseld wurde am 28. September 1924 in Ulm geboren und starb am 26. Oktober 2002 in Frankfurt am Main. Nach dem Abitur wurde er im Zweiten Weltkrieg zum Kriegsdienst einberufen und war drei Jahre lang, bis 1945, als Marinefunker im Einsatz. Nach seiner Rückkehr absolvierte er beim Ulmer Aegis Verlag eine Lehre als Verlagskaufmann. 1947 erhielt er durch die Vermittlung von Professor Weischedel die erstrebte Zulassung an der Universität Tübingen und studierte dort Germanistik, Philosophie, Nationalökonomie, Völkerrecht, Bibliothekswissenschaften und Sinologie. Seinen Lebensunterhalt bestritt Unseld als Werkstudent. Bis 1950 arbeitete er im Verlag J. C. B. Mohr in Tübingen. 1951 promovierte er mit einer Dissertation über Hermann Hesse zum Dr. phil. 1952 trat er in den Suhrkamp Verlag ein, wurde 1958 Gesellschafter der Suhrkamp Verlag KG und übernahm nach dem Tod Peter Suhrkamps die Verlagsleitung. Neben seiner beruflichen Tätigkeit besuchte er 1955 das von Henry Kissinger geleitete Internationale Seminar der Harvard Universität in Cambridge/Mass. (USA). Unseld führte die Verlage Suhrkamp und Insel und den 1981 von ihm gegründeten Deutschen Klassiker Verlag bis zu seinem Tod im Jahr 2002. Raimund Fellinger, geboren 1951 im Saarland, arbeitete nach Studium von Germanistik, Linguistik und Politikwissenschaft seit 1979 als Lektor im Suhrkamp Verlag, seit 2006 als Cheflektor. Er starb am 25. April 2020 in Frankfurt am Main.
Produktdetails
- Verlag: speak low
- Gesamtlaufzeit: 298 Min.
- Erscheinungstermin: 1. April 2014
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783940018069
- Artikelnr.: 65259211
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Erhellend findet Leopold Federmair die nun gesammelt vorliegende, 37 Jahre umspannende Korrespondenz Peter Handkes mit seinem Verleger und dies vor allem auch im Lichte weiterer Veröffentlichungen zu Leben und Werk des Autors anlässlich dessen 70. Geburtstags, die Federmair in seiner großzügigen Schilderung der gemeinsamen Stationen von Handke und Unseld im einzelnen als Beleg und Exkursmöglichkeit anführt. Ein Vergleich mit Unselds Briefwechsel mit Thomas Bernhard bietet sich überdies an: Der Handke-Band fällt nicht ganz so dramatisch und witzig wie dieser aus, urteilt der Rezensent, doch gestattet er ebenso wertvolle Einblicke in das "schöpferische Innen- und Außenleben" des Autors sowie in dessen zuweilen krisenhaftes Verhältnis zu Unseld. Diesem attestiert Federmair ein gutes Gespür für Handkes Auf und Ab, wie er insbesondere anhand dessen Umgang mit Handkes Lebens- und Schaffenskrise 1978 belegt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»In [Handkes] Briefen [geht] es fast ausschließlich um ihn und seine Empfindlichkeiten. Es führt aber doch zum Kern von Handkes Wahrnehmungs- und also Schreibkunst.« Volker Weidermann Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 20121202
»Nicht nur psychologisch und kreativitätspsychologisch jedoch ist dieser Briefroman spannend. Man kann ihn vielfaltig lesen: als Zeitroman der sechziger und siebziger Jahre, als Porträt eines Ausgewanderten, als Reiseliteratur, als Beispiel lebenspraktischer Gewinnung von Welt und Überwindung von Provinzialität, als Bildungsroman.«
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben
Andere Kunden interessierten sich für