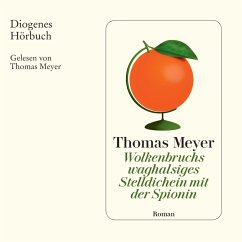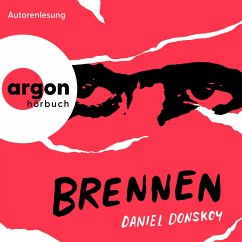Der falsche Gruß (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 185 Min.
Sprecher: Brückner, Christian
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
14,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
7 °P sammeln!
Ercks Vater wurde zweimal verlassen: einmal von seiner Ehefrau und einmal von der DDR. Beides hat der Professor aus Leipzig nicht verwunden. Erck ist mit diesem Schmerz groß geworden, aber Aufgeben ist seine Sache nicht. Als er beim besten Verlag der Republik einen Buchvertrag unterschreibt, ist er fast am Ziel. Wäre da nur nicht dieser Hans Ulrich Barsilay mit seinem extravaganten Auftreten, seinen schönen Ex-Freundinnen, seiner perfekten Prosa und seiner Gewissenlosigkeit. Das Problem: Er ist beim selben Verlag. Und vieles deutet darauf hin, dass er versucht, Erck sein Thema zu stehlen. H...
Ercks Vater wurde zweimal verlassen: einmal von seiner Ehefrau und einmal von der DDR. Beides hat der Professor aus Leipzig nicht verwunden. Erck ist mit diesem Schmerz groß geworden, aber Aufgeben ist seine Sache nicht. Als er beim besten Verlag der Republik einen Buchvertrag unterschreibt, ist er fast am Ziel. Wäre da nur nicht dieser Hans Ulrich Barsilay mit seinem extravaganten Auftreten, seinen schönen Ex-Freundinnen, seiner perfekten Prosa und seiner Gewissenlosigkeit. Das Problem: Er ist beim selben Verlag. Und vieles deutet darauf hin, dass er versucht, Erck sein Thema zu stehlen. Höchste Zeit, ihm mit einer Intrige zuvorzukommen. Maxim Biller erzählt die Geschichte von einem, der irre wird an Deutschland, weil er um jeden Preis hinein will: in die Gesellschaft, ins Scheinwerferlicht, ins Walhalla der neuen wiedervereinten Nation.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.