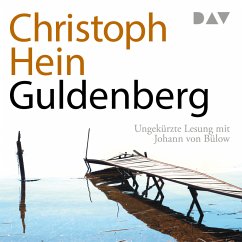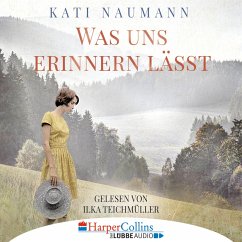Der fremde Freund / Drachenblut (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 315 Min.
Sprecher: Hein, Christoph
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
9,49 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
5 °P sammeln!
DDR, Anfang der 80er-Jahre: Claudia ist Ärztin, geschieden und kinderlos. Als ihr Nachbar Henry eines Abends in ihre Wohnung stürmt und nicht mehr geht, lässt sie sich auf eine Beziehung mit ihm ein, die es trotz oberflächlicher Nähe nicht vermag, ihren Schutzpanzer aus Selbstverleugnung, Resignation und Gefühlskälte zu durchbrechen. Henry bleibt ihr fremd. Mit der vielgelobten Novelle »Der fremde Freund«, die in Westdeutschland unter dem Titel »Drachenblut« erschien, gelang Christoph Hein der literarische Durchbruch im geteilten Deutschland. Eine schonungslose Geschichte über pers...
DDR, Anfang der 80er-Jahre: Claudia ist Ärztin, geschieden und kinderlos. Als ihr Nachbar Henry eines Abends in ihre Wohnung stürmt und nicht mehr geht, lässt sie sich auf eine Beziehung mit ihm ein, die es trotz oberflächlicher Nähe nicht vermag, ihren Schutzpanzer aus Selbstverleugnung, Resignation und Gefühlskälte zu durchbrechen. Henry bleibt ihr fremd. Mit der vielgelobten Novelle »Der fremde Freund«, die in Westdeutschland unter dem Titel »Drachenblut« erschien, gelang Christoph Hein der literarische Durchbruch im geteilten Deutschland. Eine schonungslose Geschichte über persönliche Entfremdung im Überwachungsstaat – gelesen vom Autor selbst. Ungekürzte Autorenlesung 1 mp3-CD ca. 5 h 22 min
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.




heike-s.jpg)