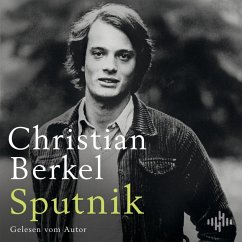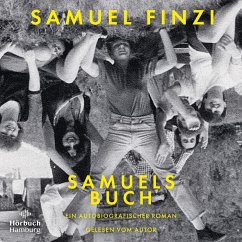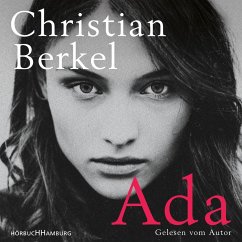Jörg Hartmann
Hörbuch-Download MP3
Der Lärm des Lebens (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 461 Min.
Sprecher: Hartmann, Jörg

PAYBACK Punkte
9 °P sammeln!





In Der Lärm des Lebens erzählt Jörg Hartmann auf hinreißende Weise seine Geschichte und die seiner Eltern und Großeltern. Es ist eine Liebeserklärung an die Kraft der Familie - und an den Ruhrpott. Ob es um die Situation seiner gehörlosen Großeltern im Nationalsozialismus geht, das Leben seiner Mutter als Pommesbudenbesitzerin, die Demenzerkrankung seines Vaters, der Dreher und leidenschaftlicher Handballer war, die vielen skurrilen Erlebnisse in der Großfamilie oder um Schlüsselbegegnungen, die er als Schauspieler hatte - immer hält Hartmann die Balance zwischen Tragik und Komik. E...
In Der Lärm des Lebens erzählt Jörg Hartmann auf hinreißende Weise seine Geschichte und die seiner Eltern und Großeltern. Es ist eine Liebeserklärung an die Kraft der Familie - und an den Ruhrpott. Ob es um die Situation seiner gehörlosen Großeltern im Nationalsozialismus geht, das Leben seiner Mutter als Pommesbudenbesitzerin, die Demenzerkrankung seines Vaters, der Dreher und leidenschaftlicher Handballer war, die vielen skurrilen Erlebnisse in der Großfamilie oder um Schlüsselbegegnungen, die er als Schauspieler hatte - immer hält Hartmann die Balance zwischen Tragik und Komik. Er hat dabei einen kraftvollen Erzählton - persönlich, berührend, humorvoll. Und fragt: Warum kehren wir immer wieder zu unseren Wurzeln zurück? Es geht Hartmann darum, den Kreislauf des Lebens zu fassen: Eltern und Kinder, Anfang und Ende, Aufbruch und Ankunft, Werden und Vergehen - eben alles, was zum geliebten Lärm des Lebens gehört. Ein weises, geschichtenpralles Hörbuch über Herkunft und Heimat - und den Wunsch, sich davon zu lösen und in die Welt zu ziehen. Eine Éducation sentimentale und, wie nebenbei, eine Mentalitätsgeschichte der Bundesrepublik.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Jörg Hartmann gehört zu den bedeutendsten deutschen Charakterdarstellern. 1969 geboren, wuchs er in Herdecke, im Ruhrpott, auf. Nach seiner Schauspielausbildung und verschiedenen Theaterengagements wurde er 1999 Ensemblemitglied der Berliner Schaubühne. Fernsehproduktionen wie 'Weissensee' oder der Dortmund-Tatort, in dem er Kommissar Faber spielt, machten ihn einem breiten Publikum bekannt; im Kino war er etwa in 'Wilde Maus' oder zuletzt in 'Sonne und Beton' zu sehen. Jörg Hartmann wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Deutschen Fernsehpreis, der Goldenen Kamera und dem Grimme-Preis. Für den Tatort 'Du bleibst hier' (2023) schrieb er das Drehbuch. Er hat drei Kinder und lebt mit seiner Familie in Potsdam.
Produktdetails
- Verlag: argon
- Erscheinungstermin: 12. März 2024
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783732421220
- Artikelnr.: 69952873
Perlentaucher-Notiz zur WELT-Rezension
Jörg Hartmann, bekannt geworden als Faber im Dortmunder Tatort, hat mit "Der Lärm des Lebens" ein Memoir geschrieben, dass vom Leben im Revier erzählt, von den Großeltern, beide gehörlos, die ums Haar von den Nazis ermordet worden wären, und vom Vater, der an Demenz erkrankt und stirbt, resümiert Rezensent Elmar Krekeler. Dass Hartmann das eher leise erzählt, gefällt dem Kritiker, der anerkennend sein Pilsken hebt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Ungemein witzig und hinreißend komisch ... Da hat einer ein Buch geschrieben, der mit dem Herzen durchs Leben geht. Christine Westermann Stern
Jörg Hartmann, bekannt geworden als Faber im Dortmunder Tatort, hat mit "Der Lärm des Lebens" ein Memoir geschrieben, dass vom Leben im Revier erzählt, von den Großeltern, beide gehörlos, die ums Haar von den Nazis ermordet worden wären, und vom Vater, der an Demenz erkrankt und stirbt, resümiert Rezensent Elmar Krekeler. Dass Hartmann das eher leise erzählt, gefällt dem Kritiker, der anerkennend sein Pilsken hebt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Zum Inhalt:
Der Autor nimmt uns mit auf die Reise durch die Geschichte seiner Familie und auch seiner eigenen Geschichte, sei es die Situation der gehörlose Großeltern im Nationalsozialismus, seinem demenzkranken Vater, seinem Weg zur Schauspielerei oder auch einfach über den …
Mehr
Zum Inhalt:
Der Autor nimmt uns mit auf die Reise durch die Geschichte seiner Familie und auch seiner eigenen Geschichte, sei es die Situation der gehörlose Großeltern im Nationalsozialismus, seinem demenzkranken Vater, seinem Weg zur Schauspielerei oder auch einfach über den Ruhrpott.
Meine Meinung:
Ich hatte keine rechte Vorstellung, wie das Buch oder auch das Hörbuch sein würde und ich bin wirklich sehr positiv überrascht worden. Der Autor hat das Talent einen einzufangen, eine Geschichte zu erzählen, als wäre man sogar ein Stück weit dabei. Er erzählt in einer liebevollen Art, mit viel Humor aber auch traurigen Untertönen, dass einen die Geschichte einfach gefangen nimmt. Sehr gut hat mir auch gefallen, dass der Autor das Hörbuch selbst liest, das macht die Geschichte noch nahbarer und er liest auch einfach gut.
Fazit:
Hat mir sehr gut gefallen
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Überflüssig
Eine Bemerkung zuvor: Ich kenne Jörg Hartmann als Darsteller des Tatort-Kommissars Faber und ich schätze seine schauspielerische Leistung sehr. Sein Buch allerdings schätze ich überhaupt nicht.
Dass Schauspieler ihre Memoiren schreiben, ist schon seit …
Mehr
Überflüssig
Eine Bemerkung zuvor: Ich kenne Jörg Hartmann als Darsteller des Tatort-Kommissars Faber und ich schätze seine schauspielerische Leistung sehr. Sein Buch allerdings schätze ich überhaupt nicht.
Dass Schauspieler ihre Memoiren schreiben, ist schon seit längerem gang und gäbe. Dabei gibt es Schauspieler, die wirklich etwas zu erzählen haben. Ich nenne als Beispiele die Trilogie von Joachim Meyerhoff oder das Buch von Edgar Selge „Hast uns endlich gefunden“. Beide berichten sprachsicher Begebenheiten aus ihrem Leben, die mehr als individuelle Relevanz haben.
Jörg Hartmann dagegen hat m.E. nichts zu erzählen, was von überindividueller Relevanz wäre. Beworben wird der Roman damit, dass es um die Situation seiner gehörlosen Großeltern in der Nazizeit, die Lebensklugheit seiner Mutter, die eine zeitlang eine Pommesbude betreiben hat, und die Demenz seines Vaters geht. Diese Aspekte sind aber völlig untergeordnet, sie machen keine 10% des Buches aus. Der Rest ist Selbstdarstellung mit dem Ziel, sich in einem möglichst positiven Licht darzustellen. Am penetrantesten geschieht dies in dem Kapitel, in dem Hartmann einen Kindergeburtstag bei einer neureichen Familie darstellt, über die er Kübel von Spott ausschüttet.
Neben der Selbstdarstellung haben andere Personen keinen Platz, um differenzierter dargestellt zu werden.
Ach ja, und es gibt immer wieder Klagen über den Zustand der Welt. Aber auch diese Klagen gehen letztlich nicht über Plattitüden hinaus.
Sprachlich ist das Buch wenig anspruchsvoll. Hartmann liebt die Aneinanderreihung von kurzen Hauptsätzen und Satzellipsen. Das liest sich dann folgendermaßen: „Auf der Schwelle fällt mein Blick ins Kinderzimmer. Trifft Theos Ritterburg. Trifft Hannahs Kuschelecke. Trifft die vielen Stofftiere. Und eine Welle bricht. Direkt über mir.“ Solche Passagen gibt es zuhauf. Das mag man vielleicht noch hinnehmen.
Völlig abgeschmackt ist aber folgender Vergleich: „Jenny-Nanny flatterte strahlend voraus, Tschernobyl war nichts dagegen…“
Mein Fazit: Das Buch ist irrelevant, Es liefert der Leserin/dem Leser keine neuen Erkenntnisse oder Sichtweisen auf Welt.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Es fällt mir schwer, eine Bewertung abzugeben. Es handelt sich um die Lebensgeschichte des Autors, wie kann man diese bewerten, er berichtet von seinem Leben, das erlebt man, man denkt es sich schließlich nicht aus. Ich hatte mich angesprochen gefühlt, es geht um Herkunft, Familie, …
Mehr
Es fällt mir schwer, eine Bewertung abzugeben. Es handelt sich um die Lebensgeschichte des Autors, wie kann man diese bewerten, er berichtet von seinem Leben, das erlebt man, man denkt es sich schließlich nicht aus. Ich hatte mich angesprochen gefühlt, es geht um Herkunft, Familie, den ständigen Zeitmangel, das schlechte Gewissen den alt werdenden Eltern gegenüber. Dieser erste Teil der Geschichte war schön zu lesen, berührend und voller Liebe und auch Tragik. Die Erinnerungen an die Großeltern sind gut dargestellt, auch die Anfänge im Berufsleben, humorvoll und liebevoll der Bericht vom Besuch beim schwerkranken Vater. Die Erinnerungen, die einen mit Wucht treffen, gut geschildert. Nach der Hälfte der Geschichte verpuffte das allerdings, da ging es nun überwiegend um die Zweifel, die einen in der Lebensmitte treffen, der Humor war irgendwie raus und mir erschien die Geschichte nur noch wie eine Aneinanderreihung von Anekdoten. Die große Herdecker Familie blieb in der zweiten Hälfte mehr oder weniger unerwähnt, gerade mal das plötzliche Auftauchen eines Puppenhauses brachte die Mutter wieder in Erinnerung, das fand ich sehr schade. Der Autor packt eine Menge Zeitgeschehen in die Geschichte, das hätte durch seinen Blick auf Corona, Kinder und die Mutter spannend sein sollen, das war aber eher zäh, wie auch die schon lieblose Darstellung des Kindergeburtstages. Da hofft man, dass sich niemand wiedererkennt...Die körperlichen Beschwerden des Autors zum Ende der Geschichte stehen ohne weitere Erklärung da, aber hinterlassen natürlich Fragen. Die Geschichte ist deshalb für mich nicht ganz überzeugend, zweigeteilt wie gesagt, schade.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Biste hier zum Vorsprechen?
Jörg Hartmann... der Name hat mir zunächst nichts gesagt.
Aber dann beim Lesen über ihn und Ansehen eines Fotos kam mir der Stasi-Offizier aus der TV-Serie "Weissensee" doch bekannt vor.
Das Bild auf dem eher unspektakulären Cover …
Mehr
Biste hier zum Vorsprechen?
Jörg Hartmann... der Name hat mir zunächst nichts gesagt.
Aber dann beim Lesen über ihn und Ansehen eines Fotos kam mir der Stasi-Offizier aus der TV-Serie "Weissensee" doch bekannt vor.
Das Bild auf dem eher unspektakulären Cover zeigt eigentlich eher die Freude, als den Lärm des Lebens. Es sei denn, der fliegende Junge schreit gerade sehr kräftig.
In dem Buch "Der Lärm des Lebens" erzählt der Autor aus seinem Leben. Dabei hat er keine Autobiografie verfasst, sondern eher seine Erinnerungen zusammen gefasst.
Anstoß zu dem Buch lieferte ihn nach seiner Aussage der Tod seines demenzkranken Vaters, der früher als Dreher arbeitete und leidenschaftlicher Handballer war.
Der 1969 geborene Jörg Hartmann berichtet über seine gehörlosen Großeltern, die Wirtschaftswunderjahre, seine eigene Jugend, den mühevollen Beginn seiner Karriere und auch Corona. Er zeiht also auch ein Band durch die Geschehnisse in der Bundesrepublik.
Die Kapitel sind episodenhaft ohne direkte zeitliche Gliederung. Dieser eher sprunghafte und übergangslose Wechsel gefällt mir nicht ganz so gut, ich mag chronologisches dann eher.
Insgesamt ist Jörg Hartmann ein gehaltvolles und doch bodenständiges Buch gelungen, voller Anekdoten aus einem Leben mit diversen Höhen und Tiefen. Ich empfehle es gern mit 4 Sternen weiter, vor allem auch für Fans, die den Menschen hinter dem Schauspieler kennen lernen möchten.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Jörg Hartmann ist ein bekannter Schauspieler, im Dortmunder Tatort ist er als Faber zu sehen. Nun hat er einen größtenteils biografischen Roman veröffentlich in dem er uns von seinen Anfänger als Schauspielschüler und von seinen ersten Engagement berichtet, von seinen …
Mehr
Jörg Hartmann ist ein bekannter Schauspieler, im Dortmunder Tatort ist er als Faber zu sehen. Nun hat er einen größtenteils biografischen Roman veröffentlich in dem er uns von seinen Anfänger als Schauspielschüler und von seinen ersten Engagement berichtet, von seinen Reisen, seinen Ängsten und Sorgen und der ungewollten viel zu häufigen Abwesenheit von seiner Familie, besonders als Ehemann und Vater. Einen großen Raum nimmt auch seine Kindheit im Ruhrgebiet ein, das liebevolle Elternhaus, der sportliche Vater, dem der Sohn nicht gerecht werden konnte, die Freiheiten, die er genoss, seine Erlebnisse mit seinen Freunden. Rückblenden erzählen von seinen Großeltern, beide taubstumm, intelligent und in ihrem Dorf sehr beliebt, die dennoch die Sorge hatten, im dritten Reich dem Euthanasieprogramm der Nazis zum Opfer zu fallen.
Anekdotenreich, zeitlich und thematisch wechselnd, doch immer in einem logischen Zusammenhang wird sehr lebensnah und lebendig über das Schauspielerleben und die Familie Jörg Hartmanns erzählt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Ehrlich, ungeschönt und authentisch: Der Mensch hinter dem „Tatort“-Kommissar
Stellt Euch vor, Ihr sitzt in einer typischen Ruhrpott-Kneipe: Grauer Klinkerbau, die großen Fenster verhängt mit vergilbten Spitzengardinen. Es riecht nach kaltem Zigarettenrauch, der Tresen …
Mehr
Ehrlich, ungeschönt und authentisch: Der Mensch hinter dem „Tatort“-Kommissar
Stellt Euch vor, Ihr sitzt in einer typischen Ruhrpott-Kneipe: Grauer Klinkerbau, die großen Fenster verhängt mit vergilbten Spitzengardinen. Es riecht nach kaltem Zigarettenrauch, der Tresen ist mit einer abgrundtief hässlichen Vase bestückt, in der angestaubte Kunstblumen ein tristes Dasein fristen. Das meistgehörte Wort ist „Hömma“ und Euch gegenüber beim Pils sitzt ein markiger Typ, der im melodischsten Ruhrpott-Slang lustige, aber auch tieftraurige Episoden aus seinem Leben erzählt. Genauso fühlt man sich als Leser von Jörg Hartmanns biografischem Buch „Der Lärm des Lebens“ (Erscheinungstermin: 12. März 2024) – und das soll ausnahmslos als Kompliment verstanden werden!
Der 1969 geborene Schauspieler, der den meisten Fernsehzuschauern durch seine Paraderolle Kommissar Faber im Dortmunder „Tatort“ bekannt sein dürfte, lädt die Leser auf 304 Seiten zu sehr persönlichen Einblicken in sein bewegtes Leben ein. Es wird niemals öde, ihm dabei zuzuhören – und ich schwöre, ich hatte von Anfang bis Ende beim Lesen Jörg Hartmanns Stimme im Kopf!
Ratsam ist es, sich bei der Lektüre gleich ein paar Klebezettel in greifbare Nähe zu legen, denn so viele geistreiche Gedanken und (auch ungeschönte) Wahrheiten säumen dieses Buch, die es wert sind, nicht nur gelesen, sondern auch bedacht zu werden.
Jörg Hartmann schildert in äußerst authentischem Ton seine Anfänge als ambitionierter Schauspielstudent, nimmt uns mit zurück in seine Kindheit im beschaulichen Herdecke, erzählt von zerplatzten und wahrgewordenen Träumen und spannt den Bogen bis in die Ödnis des Corona-Lockdowns, der für ihn als Schauspieler auch durchaus die Chance zur Neuausrichtung bot.
Das zentrale Thema des Buchs ist der Tod seines Vaters. Jörg Hartmann streift die raue Faber-Schale ab und zeigt sich sehr verletzlich. Wer Details von rauschenden Filmpartys und Interna aus der Welt der Reichen und Schönen erwartet, ist bei „Der Lärm des Lebens“ (gottseidank) verkehrt, denn Jörg Hartmann ist ein durchweg sympathischer, einfacher Typ ohne jedwede Starallüren, der mit den großen und kleinen Sorgen des Familienalltags bestens vertraut ist. Fast schon beängstigend normal für einen Schauspieler seines Formats!
Bei aller Ernsthaftigkeit kommt aber der Humor nicht zu kurz. Der Mime nimmt sich auch gern mal selbst auf die Schippe, wenn er sich in Selbstgesprächen als „larmoyantes Arschloch“ bezeichnet.
Ich hing beim Lesen quasi an Jörg Hartmanns Lippen und habe dieses biografische Stück Literatur innerhalb kürzester Zeit verschlungen. Wenn man dann das Buch zuklappt, das imaginäre Pilsglas leer ist, und die Wirtin der eingangs erwähnten fiktiven Ruhrpottkneipe das Licht löscht, dann meint man, in Jörg Hartmann einen echten Kumpel gefunden zu haben. „Und das is hier bei uns im Ruhrpott viel mehr als Freunde.“ (Zitat von Seite 25)
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Der Lärm der Hartmänner und -frauen
Hier geht es um die Familie von Schauspieler Jörg Hartmann, genau, den Faber aus dem Dortmunder Tatort, wo er mir als zeitweilig depressiver Vorgesetzter, der nicht nur ein (Lebens)Päckchen zu tragen hat, lieb und teuer geworden …
Mehr
Der Lärm der Hartmänner und -frauen
Hier geht es um die Familie von Schauspieler Jörg Hartmann, genau, den Faber aus dem Dortmunder Tatort, wo er mir als zeitweilig depressiver Vorgesetzter, der nicht nur ein (Lebens)Päckchen zu tragen hat, lieb und teuer geworden ist.
Zumal er ein echter Ruhrpottler ist, aus Herdecke nämlich, was nur einen Katzensprung entfernt ist von Bochum, wo ich einige Jahre gelebt habe - und zwar sehr gerne! Gerade der Sound des Potts hat sich mir im Ohr - und mehr noch im Herzen - festgesetzt und er ist es auch, den ich bei der Lektüre dieses Buches genossen habe - Hartmann beherrscht ihn auch schriftlich aus dem ff und kommt in dieser Hinsicht ausgesprochen authentisch rüber.
Allerdings nicht so sehr in anderer, dazu stellt er sich dann doch etwas zu sehr in den Mittelpunkt. Was mir zunächst - gerade bei der Beschreibung des Vorsprechens an der Berliner Schaubühne - sehr gefiel, das empfand ich schon bald als recht anstrengend. Ja, Herr Hartmann, ich weiß, was für ein Supertyp Sie sind - auf der Bühne jedenfalls und das reicht mir völlig. In diesem biographischen Werk hätten andere Familienmitglieder gern stärker in den Vordergrund rücken dürfen. Deren Lärm kommt dann im Vergleich zu dem des Autors selbst doch recht verhalten rüber!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
In den letzten Jahren haben viele Schauspieler*innen autobiographische oder autofiktionale Bücher veröffentlicht, und normalerweise interessiere ich mich nicht dafür. Bei Jörg Hartmann war ich allerdings neugierig, da er auf mich sehr sympathisch, bodenständig und humorvoll …
Mehr
In den letzten Jahren haben viele Schauspieler*innen autobiographische oder autofiktionale Bücher veröffentlicht, und normalerweise interessiere ich mich nicht dafür. Bei Jörg Hartmann war ich allerdings neugierig, da er auf mich sehr sympathisch, bodenständig und humorvoll wirkt, auch wenn er eher auf schwierige, oft negative behaftete Figuren abonniert scheint (Weißensee, Das Ende einer Nacht, Die vermisste Frau, Dortmunder Tatort).
Jörg Hartmann schreibt überraschend persönlich, gibt teilweise tiefe Einblicke in seine Gedanken und Gefühle. Sehr berührend schildert er die letzten Besuche bei seinem dementen Vater und dessen Beerdigung. Eher nachdenkliche Passagen wechseln sich mit humorvollen ab, und an einigen Stellen musste ich laut lachen, etwa wenn er die Proben für ein Vorsprechen beschreibt, bei denen ein Mettbrötchen am Buffet eine Rolle spielt. Jörg Hartmann erzählt nicht chronologisch, sondern springt zwischen Begebenheiten aus der Kindheit und Aktuellem, zwischen seinen taubstummen Großeltern und seinen Schauspielberuf hin und her, dies allerdings sehr elegant, sprachgewandt und natürlich, so dass es stets flüssig zu lesen ist. Besonders gut gefielen mir die Passagen über Hartmanns Schauspielstudium, da diese mit viel trockenem Witz erzählt werden. Weniger anfangen konnte ich mit einigen Anekdoten aus dem Ruhrpott, diese wirkten teilweise sehr banal. In der zweiten Hälfte fällt das Buch leider meiner Meinung nach deutlich ab. Hartmann hadert mit den Problemen unserer Zeit, mit der Vergänglichkeit des Lebens, mit der Sattheit unserer Konsumgesellschaft. Allerdings fehlt mir in seinen Ausführungen der Tiefgang, und da ist nichts, was nicht den meisten von uns auch durch den Kopf geht. Das Buch zieht sich, Hartmann wirkt schwermütig und melancholisch. Etwas befremdet war ich von Hartmanns Art, andere Menschen zu bezeichnen. Eine der Krankenpflegerinnen seines Vaters nennt er immer nur "die Korpulente", einen Mann, dem er in China begegnete, den "Zahnramponierten" bzw. "Zahnlädierten". Über die neureichen Eltern eines Kindes aus der Kita seines Sohnes, bei denen seine Familie zum Kindergeburtstag eingeladen war, zieht er mit boshaftem Spott her. Auch wenn ich seine Antipathie gut verstehen kann, frage ich mich doch, ob hier nicht auch eine gehörige Portion Sozialneid mitspielt, und wie es sich für diese Familie anfühlen muss, wenn sie sich im Buch wiedererkennen sollte.
Fazit: Für eingefleischte Hartmann-Fans ein empfehlenswertes, sehr persönliches und unterhaltsames Buch. Meine Erwartungen hat es leider nicht ganz erfüllt. Auch wenn Jörg Hartmann viel Sprachgefühl beweist und ich mir generell vorstellen könnte, ein weiteres Buch von ihm zu lesen, hat mich der Inhalt nicht überzeugt, da ich viele Passsagen als nichtssagend oder oberflächlich empfand.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Pottjugend
Jörg Hartmann kennt man aus vielen Fernsehproduktionen, vor allem als Kommissar Faber in den Tatort-Folgen aus Dortmund. Nun hat er seine Geschichte und die seiner Familie zu einer - ja, was denn? - Autobiografie? verarbeitet und das ist ein echtes …
Mehr
Pottjugend
Jörg Hartmann kennt man aus vielen Fernsehproduktionen, vor allem als Kommissar Faber in den Tatort-Folgen aus Dortmund. Nun hat er seine Geschichte und die seiner Familie zu einer - ja, was denn? - Autobiografie? verarbeitet und das ist ein echtes Lesevergnügen.
Aufgewachsen ist Hartmann in Herdecke südlich von Dortmund, er ist also ein echtes Pottkind und bringt den rauen Charme des Ruhrgebiets auch in seinem Buch hervorragend rüber. Seine Familie besteht aus echten Typen, die mit ihrer Lebensklugheit und ihrem Humor alle Gefahren des Lebens mühelos umschiffen. Und das oft mit dem typischen Ruhrpottslang, hart, aber herzlich. Das Buch ist manchmal haarscharf am Klischee, aber oft auch herzerfrischend.
Eingestreut in die Kindheitsgeschichte sind Episoden aus Hartmanns Schauspielerleben, von seinem Traum an der legendären Schaubühne in Berlin zu spielen, von Problemen in der Coronazeit.
Das alles ist mal witzig, mal ernsthaft und immer gut geschrieben. Hartmann könnte mit seiner Weltsicht ein Bruder von Hape Kerkeling sein...
In der Figur des Faber scheint eine Menge Hartmann zu stecken, aber Hartmann ist noch viel mehr. Das erkennt man schnell in diesem lesenswerten Buch.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Vom Aufwachsen im Ruhrpott hinein in die Theaterwelt
Der Schauspieler Jörg Hartmann gibt in der Lärm des Lebens sehr persönliche Einblicke in die Anfänge seiner Schauspielkarriere Anfang der 90er Jahre und das Aufwachsen in einem klassischen Arbeiterhaushalt der 70er Jahre im …
Mehr
Vom Aufwachsen im Ruhrpott hinein in die Theaterwelt
Der Schauspieler Jörg Hartmann gibt in der Lärm des Lebens sehr persönliche Einblicke in die Anfänge seiner Schauspielkarriere Anfang der 90er Jahre und das Aufwachsen in einem klassischen Arbeiterhaushalt der 70er Jahre im Ruhrpott.
Sehr informativ sind nicht nur die Einblicke in die Theaterwelt, die Hürden und Erfolge als Jungschauspieler und das aufregende Berlin nach dem Mauerfall. Der Schauspieler erzählt ebenso über das Aufwachsen im Deutschland der 60er und 70er, noch geprägt von der Schuldfrage des Nachkriegsdeutschlands, dem Wiederaufbau und zeichnet so eine kleine Sozialstudie des klassischen Arbeitermilieus in seiner Heimat Herdecke zu dieser Zeit.
Berührt haben mich die Begegnungen mit und Reflexionen über seinen Vater, der mittlerweile an Demenz erkrankt ist. Hier zeigt Hartmann, dass er nicht nur ein hervorragender Schauspieler, sondern auch ein aufmerksamer und emphatischer und nicht zuletzt sozialkritischer Beobachter der Gesellschaft, seiner Mitmenschen und Angehörigen ist.
Die Struktur ist für mich nicht vollständig gelungen. Auch wenn die Geschichte von Anekdoten lebt, hätte ich mir oft eine deutlichere zeitliche und geographische Verortung, sei es im Text oder durch Überschriften gewünscht.
In der Gesamtschau ist der Lärm des Lebens ein gelungenes Debüt mit berührenden Reflexionen über das Leben und Aufwachsen des Schauspielers im Ruhrpott mit all seinen (auch sprachlichen) Eigenheiten und interessanten Einblicken in die Theater- und Schauspielwelt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für