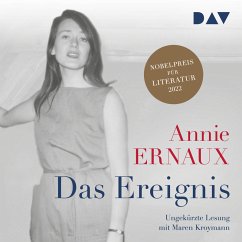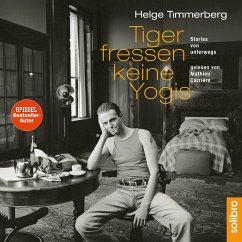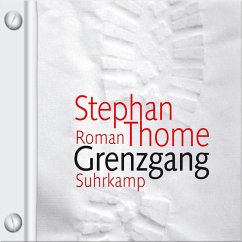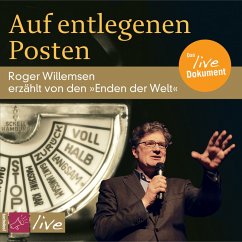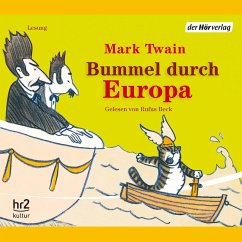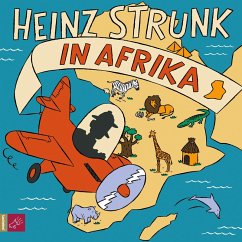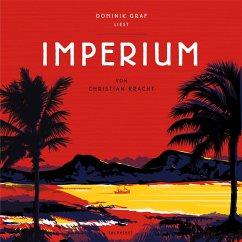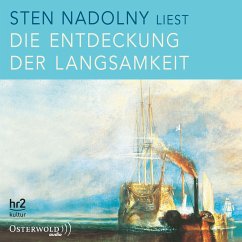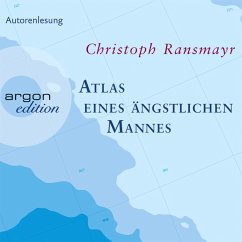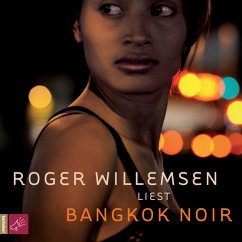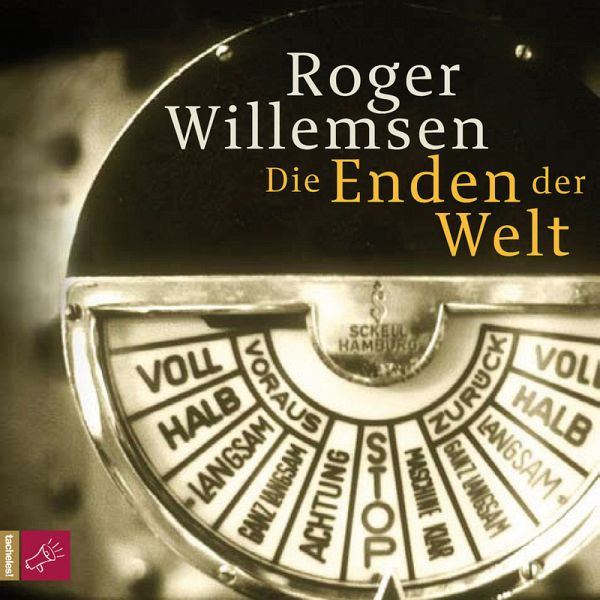
Die Enden der Welt (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 426 Min.
Sprecher: Willemsen, Roger
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
16,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
8 °P sammeln!
Auf fünf Erdteilen war Roger Willemsen unterwegs, um seine ganz persönlichen Enden der Welt zu finden. Manchmal waren es die großen geographischen: das Kap von Südafrika, Patagonien, der Himalaja, die Südseeinseln von Tonga, der Nordpol. Manchmal waren es aber auch ganz einzigartige, individuelle Endpunkte: eine Bahnstation in Birma, ein Bett in Minsk, ein Fresko des Jüngsten Gerichts in Orvieto, eine Behörde im kriegszerrütteten Kongo. Immer aber geht es in diesen grandiosen literarischen Reisebildern auch um ein Enden in anderem Sinn: um ein Ende der Liebe und des Begehrens, der Illu...
Auf fünf Erdteilen war Roger Willemsen unterwegs, um seine ganz persönlichen Enden der Welt zu finden. Manchmal waren es die großen geographischen: das Kap von Südafrika, Patagonien, der Himalaja, die Südseeinseln von Tonga, der Nordpol. Manchmal waren es aber auch ganz einzigartige, individuelle Endpunkte: eine Bahnstation in Birma, ein Bett in Minsk, ein Fresko des Jüngsten Gerichts in Orvieto, eine Behörde im kriegszerrütteten Kongo. Immer aber geht es in diesen grandiosen literarischen Reisebildern auch um ein Enden in anderem Sinn: um ein Ende der Liebe und des Begehrens, der Illusionen, der Ordnung und Verständigung. Um das Ende des Lebens - und um den Neubeginn. "Heute waren die Wolken eine Sehenswürdigkeit, nicht geringer als die Berge. Von ihrem Anblick ruhte ich mich aus, bis ich hungrig wurde. Da war es vier Uhr früh, alles schlief, und ich tappte durch die Gänge. Um halb sieben Uhr fiel mir eine Frau aus dem Aufzug entgegen, betäubt von Insektenspray. Ich hielt sie kurz im Arm. Glücklich fühlten wir uns beide nur, weil der Insektenspray so stark war. 'In dieser Gegend', sagte sie, 'entwickeln sich alle Dinge dramatisch."
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.