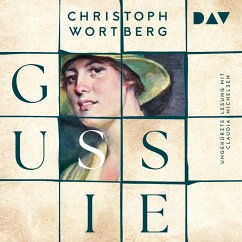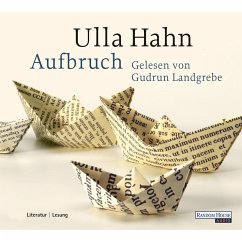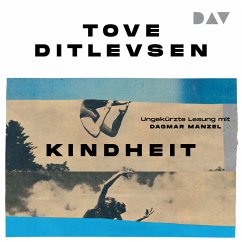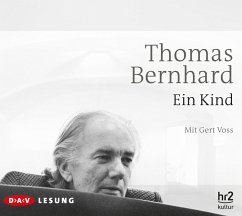Die Erfindung des Lebens (MP3-Download)
Gekürzte Lesung. 474 Min.
Sprecher: Ortheil, Hanns-Josef
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
15,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
8 °P sammeln!
Ein sehr persönlicher Text - vom Autor selbst interpretiert. Als einziges überlebendes Kind seiner Eltern wächst Johannes Catt im Köln der Nachkriegszeit auf. Nach dem Verlust seiner vier Brüder ist die Mutter stumm geworden. Auch das Kind lernt nur zögernd sprechen und bleibt lange Zeit ein Außenseiter. Nur das Klavierspielen macht ihm Spaß. Doch seine Karriere als Pianist scheitert. Nach unglaublichen Höhen und tiefen Abstürzen findet Catt schließlich im Schreiben seinen Weg... In seinem neuen, autobiographisch inspirierten Roman erzählt Hanns-Josef Ortheil die Geschichte eines j...
Ein sehr persönlicher Text - vom Autor selbst interpretiert. Als einziges überlebendes Kind seiner Eltern wächst Johannes Catt im Köln der Nachkriegszeit auf. Nach dem Verlust seiner vier Brüder ist die Mutter stumm geworden. Auch das Kind lernt nur zögernd sprechen und bleibt lange Zeit ein Außenseiter. Nur das Klavierspielen macht ihm Spaß. Doch seine Karriere als Pianist scheitert. Nach unglaublichen Höhen und tiefen Abstürzen findet Catt schließlich im Schreiben seinen Weg... In seinem neuen, autobiographisch inspirierten Roman erzählt Hanns-Josef Ortheil die Geschichte eines jahrelang stummen Kindes, dessen Eltern im Krieg und in der Nachkriegszeit vier Söhne verloren haben. Zusammen mit der ebenfalls stummen Mutter wächst es in einer künstlichen Schutzzone auf, aus der es sich erst langsam durch das geliebte Klavierspiel und den unorthodoxen Sprachunterricht des Vaters befreien kann. Doch die Befreiung ist schmerzhaft. Sie führt den Jungen auf lange, einsame Reisen durch Deutschland und in einem letzten Befreiungsakt schließlich nach Rom. Dort wird er ein erfolgreicher Pianist, der Freundschaften schließt und sogar ein Liebesverhältnis eingeht. Diese Bindungen aber zerreißen, und auch die Pianistenkarriere muss aufgegeben werden. Nach der Rückkehr nach Deutschland macht ihm ein früherer Lehrer den faszinierenden Vorschlag, es mit dem Schreiben zu versuchen … In Anlehnung an die großen Bildungsromane der deutschen Literatur entwirft dieser auch historisch weit ausholende Roman eine Biographie, die nach jedem Rückschlag wieder ganz neu erfunden werden muss. Entstanden ist dabei die ergreifende Geschichte von einem jungen Pianisten und späteren Schriftsteller, deren am Ende glücklicher Verlauf an ein Wunder grenzt.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.