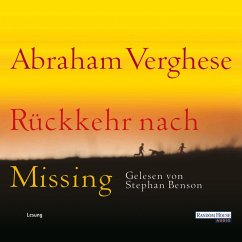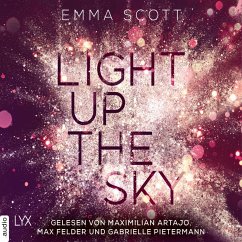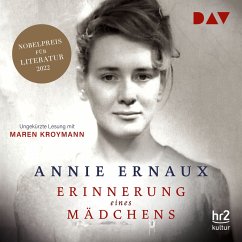Die Glasglocke (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 453 Min.
Sprecher: Hoss, Nina / Übersetzer: Kaiser, Reinhard

PAYBACK Punkte
5 °P sammeln!
Die neunzehnjährige Esther gewinnt eine vierwöchige Hospitanz bei einem Modemagazin in New York, garniert mit Partyeinladungen und Werbegeschenken. Doch Esther, bisher strebsame Studentin, kann sich weder in den Arbeitsalltag einfinden noch die Verlockungen der Stadt genießen. Sie fühlt sich, als lebte sie unter einer Glasglocke, die sie mehr und mehr von allem trennt. Plaths einziger Roman avancierte zum Kult, beschrieb er doch wie nie zuvor die Stimmungslage junger Frauen und ihre Zerrissenheit angesichts gesellschaftlicher Anforderungen. Nina Hoss fängt die einzigartige Atmosphäre des...
Die neunzehnjährige Esther gewinnt eine vierwöchige Hospitanz bei einem Modemagazin in New York, garniert mit Partyeinladungen und Werbegeschenken. Doch Esther, bisher strebsame Studentin, kann sich weder in den Arbeitsalltag einfinden noch die Verlockungen der Stadt genießen. Sie fühlt sich, als lebte sie unter einer Glasglocke, die sie mehr und mehr von allem trennt. Plaths einziger Roman avancierte zum Kult, beschrieb er doch wie nie zuvor die Stimmungslage junger Frauen und ihre Zerrissenheit angesichts gesellschaftlicher Anforderungen. Nina Hoss fängt die einzigartige Atmosphäre des Romans kongenial ein.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.