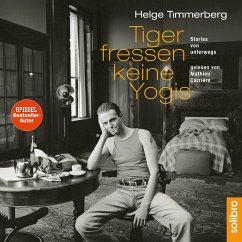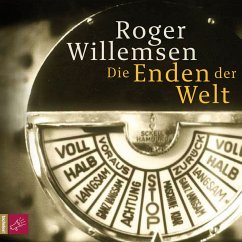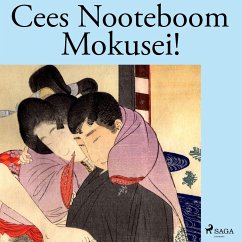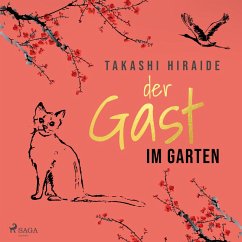Marion Poschmann
Hörbuch-Download MP3
Die Kieferninseln (Ungekürzt) (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 279 Min.
Sprecher: Stieren, Frank

PAYBACK Punkte
9 °P sammeln!





"Willst du etwas über Kiefern wissen - geh zu den Kiefern." - Matsuo Bash? Gilbert Silvester, Privatdozent und Bartforscher im Rahmen eines universitären Drittmittelprojekts, steht unter Schock. Letzte Nacht hat er geträumt, dass seine Frau ihn betrügt. In einer absurden Kurzschlusshandlung verlässt er sie, steigt ins erstbeste Flugzeug und reist nach Japan, um Abstand zu gewinnen. Dort fallen ihm die Reisebeschreibungen des klassischen Dichters Basho in die Hände, und plötzlich hat er ein Ziel: Wie die alten Wandermönche möchte auch er den Mond über den Kieferninseln sehen. Auf der ...
"Willst du etwas über Kiefern wissen - geh zu den Kiefern." - Matsuo Bash? Gilbert Silvester, Privatdozent und Bartforscher im Rahmen eines universitären Drittmittelprojekts, steht unter Schock. Letzte Nacht hat er geträumt, dass seine Frau ihn betrügt. In einer absurden Kurzschlusshandlung verlässt er sie, steigt ins erstbeste Flugzeug und reist nach Japan, um Abstand zu gewinnen. Dort fallen ihm die Reisebeschreibungen des klassischen Dichters Basho in die Hände, und plötzlich hat er ein Ziel: Wie die alten Wandermönche möchte auch er den Mond über den Kieferninseln sehen. Auf der traditionsreichen Pilgerroute könnte er sich in der Betrachtung der Natur verlieren und seinen inneren Aufruhr hinter sich lassen. Aber noch vor dem Start trifft er auf den Studenten Yosa, der mit einer ganz anderen Reiselektüre unterwegs ist, demComplete Manual of Suicide. Die Kieferninselnist ein Roman von meisterhafter Leichtigkeit: tiefgründig, humorvoll, spannend, zu Herzen gehend. Im Teeland Japan mischen sich Licht und Schatten, das Freudianische Über-Ich und die dunklen Götter des Shintoismus. Und die alte Frage wird neu gestellt: Ist das Leben am Ende ein Traum? Marion Poschmann, 1969 in Essen geboren, studierte Germanistik und Slawistik und lebt heute in Berlin. Für ihre Prosa und Lyrik wurde sie vielfach ausgezeichnet. Marion Poschmanns Roman "Die Kieferninseln" ist ein Meisterwerk. - Die Zeit
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Marion Poschmann wurde in Essen geboren und lebt heute in Berlin. Für ihre Lyrik und Prosa wurde sie mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bremer Literaturpreis 2021 für ihren Lyrikband Nimbus und im selben Jahr mit dem WORTMELDUNGEN-Literaturpreis. Zuletzt erhielt sie 2023 den Joseph-Breitbach-Preis für ihr Gesamtwerk.
Produktdetails
- Verlag: SAGA Egmont
- Gesamtlaufzeit: 279 Min.
- Erscheinungstermin: 6. Oktober 2017
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9788711877319
- Artikelnr.: 49246289
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Intellektuelle Männer mittleren Alters, die einen Ausweg aus einem eingefahrenen Leben suchen, sind momentan anscheinend Trend, beobachtet Tobias Lehmkuhl. Gilbert Silvester, der Hauptprotagonist in Marion Poschmanns neuem Roman "Die Kieferninseln" ist ein besonders gelungener Vertreter dieser Zunft, naturgemäß aber kein sonderlich sympathischer, findet der Rezensent. Der "Bartforscher im Rahmen eines Drittmittelprojekts" flüchtet aus seinem Leben, reist nach Japan, begibt sich auf die Spuren des Haiku-Dichters Bashō und rettet einem Japaner das Leben, fasst Lehmkuhl zusammen. Poschmann ist ein so feinsinniger wie lustiger Roman gelungen, in dem "Bartmode und Gottesbild" zusammenkommen, so der Rezensent, der sich nach "Mondbetrachtung in mondloser Nacht" über diese zweite Auseinandersetzung mit Japan gefreut hat.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Was das Buch ausgesprochen lesenswert macht, sind die Balance zwischen Tragik und Komik, die bildhafte Genauigkeit bis in Details und die über Abgründe gleitende Leichtigkeit.« Dorothea von Törne NZZ am Sonntag 20171210
Gebundenes Buch
Gilbert Silvester geht jegliche Fähigkeit zur Selbstreflexion vollständig ab.
Seine Wahrnehmung ist seine Wirklichkeit ist die absolute, unumstößliche Wahrheit: er träumt, seine Frau habe ihn betrogen, also hat sie ihn betrogen, also lügt sie, wenn sie es …
Mehr
Gilbert Silvester geht jegliche Fähigkeit zur Selbstreflexion vollständig ab.
Seine Wahrnehmung ist seine Wirklichkeit ist die absolute, unumstößliche Wahrheit: er träumt, seine Frau habe ihn betrogen, also hat sie ihn betrogen, also lügt sie, wenn sie es abstreitet. Traum und Wirklichkeit sind fließende Konstrukte, deren Grenzen von Gilbert in keinster Weise hinterfragt werden.
Und so fliegt er nach Japan – obwohl er Ländern, in denen mehr Tee als Kaffee getrunken wird, grundlegend misstraut! –, beschließt, auf den Spuren des verehrten Dichters Matsuo Bashō zu wandeln, rettet den Studenten Yosa Tamagotchi vor dem Suizid und nimmt ihn kurzerhand mit auf seine merkwürdige Pilgerreise.
Kulturschock? Ja und nein.
Unbeirrt belehrt Gilbert seinen jungen Begleiter über die Kultur seines eigenen Landes, was der sich fast schon unterwürfig gefallen lässt, erweist sich jedoch selber als nahezu unbelehrbar. Fest entschlossen, auf seiner Pilgerreise Erleuchtung zu erleben, lässt er diese über weite Strecken des Buches dennoch nicht zu. Er will beeindruckt werden, ist aber unempfänglich: sowohl für die Schönheit imaginärer Kirschblüten (da die Jahreszeit die falsche ist für echte Blüten) als auch für das albtraumhafte Szenario des Selbstmordwaldes von Aokigahara, wo Yosa den idealen Ort für seinen Freitod sucht.
Erst im Kabuki-Theater ist Gilbert gegen seinen Willen dann doch fasziniert, obwohl oder gerade weil ihm das Konzept vollkommen fremd ist.
Die Autorin spielt mit dem klassischen Doppelgängermotiv: Gilbert spiegelt sich wider in Yosa, projiziert seine eigenen Schwächen, Ängste und Sehnsüchte auf den jungen Mann und würdigt ihn für genau diese herab. So sagt er, ohne sich der Ironie bewusst zu sein, er setze "keinerlei Vertrauen mehr in Yosas Vorschläge, die bisher samt und sonders davon zeugen, wie ein undisziplinierter Geist sich von verworrenen Gefühlen übermannen und sich zu irrationalen und sinnlosen Handlungen treiben lässt".
So deutlich ist Yosa ein Spiegelbild von Gilbert, dass man sich als Leser fragen muss: gibt es diesen Studenten mit dem unwahrscheinlichen Nachnamen 'Tamagotchi' überhaupt? Befindet sich Gilbert wirklich auf einer Reise nach Matsushima oder ist das alles nur ein Traum? Die Autorin verzichtet auf einfache Erklärungen, so dass jeder Leser seine eigene Wahrheit finden muss.
"Die Kieferninseln" ist eine sprachlich wunderschöne, inhaltlich außergewöhnliche Gratwanderung zwischen Schein und Sein. Dabei ist das Buch nicht nur durch seine lyrische Wortmalerei ansprechend, sondern auch durch sein feines Psychogramm eines unverbesserlichen Pedanten, mit dem man dennoch mitfühlen muss, da er, ob ihm das nun bewusst ist oder nicht, auf der Suche ist nach mehr als seiner beengten Existenz.
Es ist kein Buch zum Verstand abschalten und berieseln lassen, dafür aber eines, das zeigt, dass anspruchsvolle Literatur nicht trocken und langweilig sein muss: die Geschichte ist unterhaltsam, sie ist spannend, sie ist manchmal von einer Art tragisch angehauchter Komik. Gilbert und Yosa sind eine sonderbare Reisegemeinschaft, innerhalb derer vieles ungesagt bleibt – aber es ist ein beredtes Schweigen, in das der Leser viel hinein interpretieren kann, so wie das japanische Haiku erst vollendet wird durch die Interpretation des Lesers.
Matsuo Bashōs Leben spielt nur im Hintergrund eine Rolle, aber seine Lyrik schwingt mit in den Beschreibungen der Landschaften, den von Marion Poschmann gewählten Bildern und nicht zuletzt den von Gilbert und Yosa verfassten Haiku, so laienhaft diese auch sein mögen.
Fazit:
Die Geschichte hat etwas Schwebendes, Schwereloses: Man weiß nie genau, wo die Grenzen zwischen Schein und Sein verlaufen – was erlebt Gilbert wirklich, was ist vielleicht nur ein Traum? Man kann vieles zwischen den Zeilen entdecken, hinterfragen, interpretieren, oder auch einfach die Schönheit der Sprache auf sich wirken lassen.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Clash of Cultures
Die mit vielen Ehrungen überhäufte Schriftstellerin Marion Poschmann ist heuer mit ihrem neuen, dem vierten Roman «Die Kieferninseln» bereits das zweite Mal unter den Finalisten des Deutschen Buchpreises, sie gilt einigen sogar als Favoritin. Wir haben es …
Mehr
Clash of Cultures
Die mit vielen Ehrungen überhäufte Schriftstellerin Marion Poschmann ist heuer mit ihrem neuen, dem vierten Roman «Die Kieferninseln» bereits das zweite Mal unter den Finalisten des Deutschen Buchpreises, sie gilt einigen sogar als Favoritin. Wir haben es dabei mit einer federleicht geschriebenen Tragikkomödie zu tun, die in Japan spielt und Witz wie auch Tragik aus dem Zusammenprall zweier unterschiedlicher Kulturen zieht, verkörpert zudem durch zwei einsame Protagonisten, wie sie konträrer nicht sein könnten.
«Er hatte geträumt, dass seine Frau ihn betrügt», lautet der erste Satz des Romans. Privatdozent Gilbert Silvester, Kulturwissenschaftler ohne Fortune, der im Rahmen eines Drittmittelprojekts über Bartfrisuren forscht, ist auch am selben Abend noch fest von ihrer Schuld überzeugt und stellt sie zur Rede. Es kommt zum Streit, wütend rafft er ein paar Sachen zusammen, verlässt das Haus und fährt zum Flughafen. Auf Seite zwei schon sitzt er in einem Airbus nach Tokyo, es war der früheste Interkontinentalflug, den er buchen konnte. Als er in der japanischen Metropole ziellos herumstreift, bemerkt er auf einem Bahnhof einen jungen Mann, der offensichtlich Suizid begehen will. Er bringt ihn davon ab, indem er ihm klar macht, wie vulgär doch ein Bahnhof sei für sein Vorhaben. «Wir finden einen besseren Platz», verspricht Gilbert und nimmt den Petrochemie-Studenten Yosa Tamagotchi, der trotz ordentlicher Noten unter extremer Prüfungsangst leidet, mit in sein Hotel.
Indem die Autorin ihrem Protagonisten den Namen jenes virtuellen Kückens gibt, das Ende der neunziger Jahre weltweit einen kurzzeitigen Hype ausgelöst hatte, betont und verdeutlicht sie dessen Hilfsbedürftigkeit. Gilbert entdeckt den Samariter in sich, er will Yosa helfen, einen würdigen Ort für seinen Suizid zu finden. Gemeinsam begeben sie sich auf den Spuren des berühmten japanischen Haiku-Dichters Matsuo Bashō an jene mystischen Orte, die er auf seiner legendären Pilgerreise Ende des 17ten Jahrhunderts besucht hatte und deren Endpunkt damals die Bucht von Matsushima war, - die Kieferninseln. Der gemeinsame Trip ist natürlich geprägt vom erwartbaren Clash of Cultures, den die Autorin geschickt einwebt in ihre leichtfüßig, zuweilen auch lakonisch erzählte Geschichte. Entsetzt merkt Kaffeetrinker Gilbert zum Beispiel erst im Flugzeug, dass Japan ja zu den Teenationen gehört. Und dass es dort ethnisch bedingt auch kaum Bartträger gibt, also keine für seine Studien verwertbare Bartkultur, - auch Yosa hat nur ein dünnes Ziegenbärtchen, und auch das ist nur angeklebt, wie sich später herausstellt. Und wenn sich ein Zugschaffner bei Gilbert für dreißig Sekunden Verspätung entschuldigt, erscheint ihm als Kunden der Deutschen Bundesbahn das schon fast überirdisch.
Die Geschichte wird zu weiten Teilen in Form der inneren Rede aus der Perspektive Gilberts erzählt, ein echter Gedankenaustausch zwischen den beiden einsamen Männern scheitert an den englischen Sprachkenntnissen Yosas. Es gibt zudem keine markanten Nebenfiguren im Roman, alles ist nebelhaft und unbestimmt, auch Gilberts Frau und Yosas Familie bleiben völlig profillos. Wahrhaft irrwitzig ist die Szene im Selbstmordwald Aokigahara am Fuße des Fuji, den Umweltschützer einmal im Jahr von verwesten Leichen säubern, 102 Tote waren es im Jahre 2003, - auch hier übrigens ein literarischer Nachahmeffekt wie bei Goethes Werther. Es gelingt der Autorin mühelos, die schon fast hysterische Naturliebe der Japaner poetisch umzusetzen, ihr Held Gilbert ist am Ende tief in die japanische Mentalität mit ihren strengen Ritualen eingetaucht, wovon insbesondere die Haiku zeugen, die er eifrig verfasst bei seiner roadtripartigen Sinnsuche. Ein pikaresker Roman, morbide zugleich und damit auch irritierend, der unbestimmt zwischen Traum und Wirklichkeit pendelt, in der zweiten Hälfte dann leider einiges von seinem Esprit verliert, das Ende aber immerhin wohltuend offen lässt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Ein deutscher Hochschuldozent reist spontan nach Japan, wo er durch Zufall einen Studenten trifft, der Selbstmord begehen möchte. In der Folge treten die beiden gemeinsam eine Reise durch Japan an.
Eine spannungsgeladene Handlung bietet das Buch nicht - eher stehen die Eindrücke und …
Mehr
Ein deutscher Hochschuldozent reist spontan nach Japan, wo er durch Zufall einen Studenten trifft, der Selbstmord begehen möchte. In der Folge treten die beiden gemeinsam eine Reise durch Japan an.
Eine spannungsgeladene Handlung bietet das Buch nicht - eher stehen die Eindrücke und Gedanken der Langnase Gilbert im Land des Lächelns im Vordergrund. Dabei wird er dem Leser gegenüber zumeist recht allwissend und abgeklärt (für mich auch deswegen unsympathisch) dargestellt, obwohl Japan nach eigener Aussage nie von größerem Interesse (zumindest als Reiseziel) für ihn war. Einerseits erfrischend, mit ihm den Kulturschock Japan nicht so oberflächlich und offensichtlich wie in anderen Büchern zu erleben, andererseits doch auch erstaunlich, wie leicht er auf Anhieb die japanischen Eigenheiten und gesellschaftlichen Regeln versteht - vielleicht manchmal auch etwas unglaubwürdig. Dass er dabei immer etwas außerhalb steht und Land und Leute als Außenstehender beobachtet, ist wiederum realistisch. Insgesamt finde ich die Beschreibung Japan dann aber doch klug.
Zwischendurch dann philosophische Betrachtungen von Flora, Fauna, dem Leben ansich und Lyrik - Bezüge zu den japanischen Dichtern Saigyō und Bashō. Für mich etwas viel, anderen Lesern wird das aber bestimmt gerade gefallen.
Es ist eine seltsame, nicht leicht eingängliche Geschichte. Irgendwie passt diese ungewohnte, fremde Erzählart dann aber doch gut zu Japan! Es lohnt, sich offen auf diesen schmalen Erzählband einzulassen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Ein Traum, so realistisch, dass er einfach wahr sein muss. Gilbert Silvester, Privatdozent und aktuell an Männerbärten forschend, hat geträumt, dass ihn seine Frau Mathilda betrügt und da sie ihn ohnehin verlassen wird, kann er auch direkt gehen. Kurzerhand bucht er einen Flug …
Mehr
Ein Traum, so realistisch, dass er einfach wahr sein muss. Gilbert Silvester, Privatdozent und aktuell an Männerbärten forschend, hat geträumt, dass ihn seine Frau Mathilda betrügt und da sie ihn ohnehin verlassen wird, kann er auch direkt gehen. Kurzerhand bucht er einen Flug nach Japan, völlig sinn- und ziellos und findet sich nur wenige Stunden später in einem sterilen Tokioter Hotel wieder. Er irrt durch die Stadt und wird Zeuge eines versuchten Selbstmordes in der U-Bahn. Yosa Tamagotchi wollte sich vor den Zug werfen, doch Silvester verhinderte dies durch seine Kontaktaufnahme. Nachdem er realisiert, welchem Schauspiel er gerade beigewohnt hat, überzeugt er den Japaner, dass die U-Bahn ein unwürdiger Ort für eine solche Tat ist. Das Land hat so viel inspirierendere Orte, an denen man sich das Leben nehmen kann. Der ohnehin verunsicherte Student gibt sich und sein Leben also in die Hände des Wissenschaftlers, der für Yosa den perfekten Ort zum Sterben finden will. Eine moderne Odyssee mit dem Ziel nicht der Heimkehr, sondern der Reise in die Ewigkeit, beginnt.
Marion Poschmann hat einen geradezu lyrischen Roman verfasst, der eigentlich eher einer Novelle gleicht. Im Zentrum steht Gilbert Silvester, der in seinem Leben nur wenige der erhofften beruflichen Ziele realisieren konnte und nun aufgrund eines Traums die Flucht ans andere Ende der Welt angetreten hat. Orientierung und Halt in dieser außergewöhnlichen Situation gibt ihm ein Gedicht- und Erzählband des japanischen Schriftstellers Basho, dessen Reise er verfolgen wird. Über den zweiten Protagonisten erfahren wir nicht viel mehr als dass er große Selbstzweifel bezüglich seines Könnens hegt und sich daher das Leben nehmen will. Ein überschaubares Set an Figuren und Charakterzügen.
Sie machen sich auf zu einer einstmals modernen Siedlung, die Vorbild für die Nachkriegsbauweisen im zerstörten Europa wurde und heute nur noch Verfall ausstrahlt. Auch der sogenannte Wald der Toten, Aokigahara, ist nicht der geeignete Ort, zu viele Leichen liegen dort schon rum als dass man in Ruhe seinen Frieden finden könnte. Der Mihara-Vulkan wäre eine angemessene Lokalität, doch diese liegt nicht auf ihrem Weg. Die Kiefernwälder in der Bucht von Matsushima könnten die Erfüllung bringen und sind ohnehin ein Ziel Gilbert Silvesters.
Es ist nicht nur das ungewöhnliche Motiv, dass die beiden Figuren zusammen und durch den Roman führt, mit dem Marion Poschmann überzeugen kann. Die Erzählung lebt von der sprachlichen Umsetzung, die den feinen Unterschieden zwischen Westen und Osten in jeder Nuance gerecht wird und die scharfsinnigen Beobachtungen der Natur und der Menschen fabelhaft in Worte transformiert. Ihre Beschreibungen der Natur lassen eher an Poesie erinnern als an romanhafte Beschreibungen, hier greift sie vor allem auf fernöstliche Bilder der japanischen Mystik zurück, die dem Wald und den Bäumen übernatürliche Kräfte zuschreiben. Ein starker Kontrast zum eher verkopften und sachlichen Westen. Dort gibt es auch die Schattierungen nicht, die Zwischentöne und Nuancen, die Gilbert Silvester nur in Japan in der freien Natur finden und bewundern kann:
„Die Schau der Naturerscheinungen war weder mit Kunst noch mit Architektur, noch mit Geschichte verbunden, sie war zart und geheimnisvoll, und wenn daraus doch eine Form von Bildung erwuchs, ließ sie sich hinterher weder erklären noch abrufen.“ (Pos. 1657)
Eine Bildungsreise der ganz anderen Art, die erst in die Ferne und doch wieder zurück führt. Nominiert auf der Longlist des Deutschen Buchpreis 2017 und aufgrund der Sprachgewalt für mich ein klarer Favorit.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Das Hörbuch "Die Kieferninseln" von Marion Poschmann beinhaltet eine CD und ist bei Steinbach sprechende Bücher erschienen.
Der Hörbuchsprecher Frank Stieren hat eine sehr ruhige, meditative, leicht heitere Stimme, die absolut zur Geschichte passt.
Gilbert Silvester …
Mehr
Das Hörbuch "Die Kieferninseln" von Marion Poschmann beinhaltet eine CD und ist bei Steinbach sprechende Bücher erschienen.
Der Hörbuchsprecher Frank Stieren hat eine sehr ruhige, meditative, leicht heitere Stimme, die absolut zur Geschichte passt.
Gilbert Silvester hat letzte Nacht geträumt das seine Frau ihn betrügt. In einer Kurzschlussreaktion verlässt er Hals über Kopf das Land und reist nach Japan. Dort trifft er per Zufall auf den Studenten Yosa, der sich das Leben nehmen will. Er kann ihn davon überzeugen mit ihm zu wandern, um den besten Selbstmordplatz ausfindig zu machen. Nach einer Reisebeschreibung des klassischen Dichters Basho möchten sie zu den Kieferinseln gehen.
Das Hörbuch zieht sich an manchen Stellen etwas, ist aber dennoch absolut hörenswert. Die Reise der Protagonisten ist absolut meditativ und spirituell. Der Hörer hat das Gefühl selbst an der Wanderung teilzunehmen und lernt einiges über die Kultur Japans, aber auch tiefergehende, philosophische, kulturelle Gedanken und Visionen. Das Werk regt zum Nachdenken an und führt in tiefere Gefilde der eigenen Seele. Dabei vermischt es gekonnt die japanischen Traditionen, Werte, die Kultur und auch Sagen des Landes. Ein ruhiges, aber beeindruckendes Hörerlebnis!
Fazit: Sehr meditative, spirituelle Reise durch Japan und ins Innere der eigenen Seele. Teilweise etwas zäh, ruhig, aber sehr beeindruckend. Hörempfehlung!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Wenn aus Träumen Realität wird, kann daraus eine tiefgründige und humorvolle Reise nach Japan werden; so wie in diesem Buch.
Gilbert Silvester ist einer jener Männer, die irgendwann feststellen, dass sich ihr Leben nicht so entwickelt hat, wie sie es sich in jungen Jahren …
Mehr
Wenn aus Träumen Realität wird, kann daraus eine tiefgründige und humorvolle Reise nach Japan werden; so wie in diesem Buch.
Gilbert Silvester ist einer jener Männer, die irgendwann feststellen, dass sich ihr Leben nicht so entwickelt hat, wie sie es sich in jungen Jahren vorstellten. Statt wie viele seiner früheren Kommilitionen Karriere zu machen, hangelt er sich von Projektvertrag zu Projektvertrag, während seine Frau als Gymnasiallehrerin erfolgreich ist. Eines Nachts träumt er, dass sie ihm untreu ist und als er erwacht, ist klar, dass dieser Traum die Wahrheit darstellt. Fassungslos verlässt er das Haus und fliegt schnellstmöglich so weit weg wie es geht - nach Tokio. Dort plant er eine Reise auf den Spuren des Dichters Bashō, doch noch bevor er sie antritt, kann er den Selbstmord des jungen Japaners Yosa verhindern. Dieser schließt sich ihm an und gemeinsam machen sie sich auf den Weg.
Es ist eine ruhige, stellenweise poetische und auch philosophische Geschichte, die jedoch nicht ohne Humor ist. Gilbert ist ein etwas dröger 'Held', der sich seines beruflichen Mißerfolges zwar durchaus bewusst ist, verantwortlich dafür sind aber die Fehler der Anderen: die Kritikunfähigkeit seines Doktorvaters, der nicht geschätzte Auslandsaufenthalt - irgendwas war immer. Stets ist er das Opfer, nun das seiner Frau, die ihn mit ihrer Untreue (wenn auch nur geträumt) nach Japan getrieben hat. Wirklich amüsant wird es, als er Yosa begegnet und versucht, ihm die Welt zu erklären, die japanische natürlich. Und ihm (gedachte) Vorhaltungen macht, die exakt auf seine eigene Person zutreffen, was mir Gilbert aber wieder sympathischer machte (wie häufig, wenn ich über Personen lächeln muss ;-)).
Voller Poesie sind die zahlreichen Naturbeschreibungen, ganz im Sinne des Dichters Bashō, für den Poesie einen eigenen Lebensstil darstellte; selbst die des Selbstmörderwaldes, der tatsächlich existiert. Und auch die philosophischen Gedankengänge Gilberts von der Bartbetrachtung (seinem aktuellen Forschungsprojekt) bis zum Allmachtsparadoxon sind lesenswert-amüsant.
Ein ungemein vielschichtiges Buch, das mit Genuss und Aufmerksamkeit gelesen werden sollte und aus dem man viel über Japan erfahren kann.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für