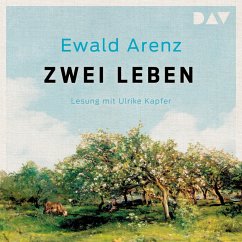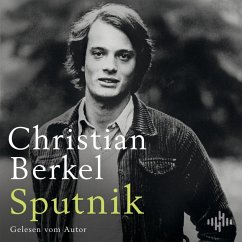Die Krume Brot (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 338 Min.
Sprecher: Hüller, Sandra
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
17,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
9 °P sammeln!
Adelina, Tochter italienischer Einwanderer, arbeitet in einer Schweizer Fabrik, als sie sich 1973 nach kurzer Ehe allein mit einem Kind wiederfindet, Emma. Ein quälender Kampf ums Überleben beginnt, bis sie einen älteren Belgier kennenlernt und in dessen Gutshof im Piemont zieht. Vieles wird nun leichter, aber ohne Liebe bleibt alles fad. Und eines Tages ist der Belgier fort, mitsamt dem Kind. Kurz darauf taucht ein Mann auf, ein Streuner, ein Brigant. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach Emma. Der Mann ist oft fort und kehrt zurück mit Geld, Essen und Zeitungen, in denen von Über...
Adelina, Tochter italienischer Einwanderer, arbeitet in einer Schweizer Fabrik, als sie sich 1973 nach kurzer Ehe allein mit einem Kind wiederfindet, Emma. Ein quälender Kampf ums Überleben beginnt, bis sie einen älteren Belgier kennenlernt und in dessen Gutshof im Piemont zieht. Vieles wird nun leichter, aber ohne Liebe bleibt alles fad. Und eines Tages ist der Belgier fort, mitsamt dem Kind. Kurz darauf taucht ein Mann auf, ein Streuner, ein Brigant. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach Emma. Der Mann ist oft fort und kehrt zurück mit Geld, Essen und Zeitungen, in denen von Überfällen und ausgeraubten Munitionsdepots berichtet wird. Er nimmt Adelina mit in seine Mailänder Kommune, und zum ersten Mal fühlt sie sich als Teil einer Gruppe. Sie macht Schießübungen und Botengänge, geht der Polizei aus dem Weg. Das ist nicht schwierig, denn die Bullen sind beschäftigt. In dieser Zeit der Bomben und der Gewalt sucht eine Mutter ihre Tochter, lange vergeblich. Bis der Streuner meldet, er habe in dem Gutshof Licht gesehen: ein Mann sei dort, ein Mann mit einem Kind.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.