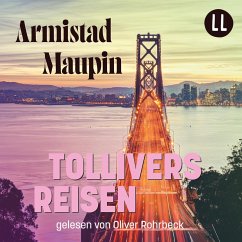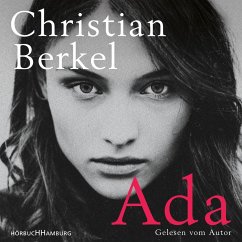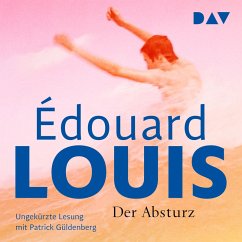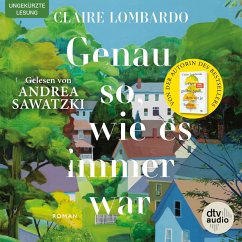Rebecca Makkai
Hörbuch-Download MP3
Die Optimisten (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 1028 Min.
Sprecher: Hoffmann, Max / Übersetzer: Abarbanell, Bettina

PAYBACK Punkte
8 °P sammeln!





Chicago, 1985: Yale ist ein junger Kunstexperte, der mit Feuereifer nach Neuerwerbungen für seine Galerie sucht. Gerade ist er einer Gemälde- sammlung auf der Spur, die seiner Karriere den entscheidenden Schub verleihen könnte. Er ahnt nicht, dass ein Virus, das gerade in Chicagos Boystown zu wüten begonnen hat, einen nach dem anderen seiner Freunde in den Abgrund reißen wird.
Paris, 2015: Fiona spürt ihrer Tochter nach, die sich offenbar nicht finden lassen will. Die Suche nach ihr gestaltet sich ebenso zu einer Reise in die eigene Vergangenheit, denn in Paris trifft sie auf ...
Chicago, 1985: Yale ist ein junger Kunstexperte, der mit Feuereifer nach Neuerwerbungen für seine Galerie sucht. Gerade ist er einer Gemälde- sammlung auf der Spur, die seiner Karriere den entscheidenden Schub verleihen könnte. Er ahnt nicht, dass ein Virus, das gerade in Chicagos Boystown zu wüten begonnen hat, einen nach dem anderen seiner Freunde in den Abgrund reißen wird.
Paris, 2015: Fiona spürt ihrer Tochter nach, die sich offenbar nicht finden lassen will. Die Suche nach ihr gestaltet sich ebenso zu einer Reise in die eigene Vergangenheit, denn in Paris trifft sie auf alte Freunde aus Chicago, die sie an das Gefühls- chaos der Achtzigerjahre erinnern und sie mit einem großen Schmerz von damals konfrontieren.
Die Optimisten ist eine zutiefst bewegende Geschichte darüber, wie Liebe uns retten, aber ebenso vernichten kann, und wie uns traumatische Ereignisse ein Leben lang prägen, bis Heilung möglich wird.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Rebacca Makkai ist eine der renommiertesten amerikanischen Schriftstellerinnen der Gegenwart. Ihr dritter Roman Die Optimisten bedeutete für sie den großen Durchbruch und wurde nicht nur ein New-York-Times-Bestseller, sondern stand auch auf der Shortlist für den Pulitzer Prize und den National Book Award. Ich hätte da ein paar Fragen an Sie ist ihr vierter Roman, der sofort nach Erscheinen auf die New-York-Times-Bestsellerliste sprang. Rebecca Makkai lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern in Chicago.
Produktdetails
- Verlag: Julia Eisele Verlag
- Erscheinungstermin: 30. März 2020
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 4099995130010
- Artikelnr.: 69684421
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Tobias Döring findet Rebecca Makkais Roman etwas zu lang. Am besten gefällt ihm der Teil, in dem sich die Autorin, gestützt auf genaue Recherche, wie Döring vermutet, mit der Partyszene im Chicago Mitte der 80er befasst, genauer mit der Schwulenszene und der aufkommenden AIDS-Welle. Dieser Teil dreht sich um einen jungen Galeristen, der mit dem Virus infiziert wird und dessen Leben aus dem Lot gerät. Der Autorin gelingt hier laut Döring ein "ereignisreiches" Zeitpanorama, das auch noch Gegenwartsbezüge zulässt, wie er findet. Der andere damit "locker verknüpfte" Teil, in dem eine Mutter-Tochter-Geschichte im Vordergrund steht, überzeugt Döring weniger. Weniger wäre hier mehr gewesen, glaubt er.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Rebecca Makkai hat einen großen Roman mit langem Atem geschrieben, der nie ins Lamento abdriftet. Elke Heidenreich Die Zeit
Broschiertes Buch
Die Optimisten
Rebecca Makkai
Übersetzerin: Bettina Abarbanell
Es hat fast 200 Seiten gebraucht bis es mich packte, ein paar Seiten später kamen mir zum ersten Mal die Tränen und dann ging es gemeinsam mit ihm, im freien Fall, nach unten, bis zum Grund.
Sein Name ist Yale und …
Mehr
Die Optimisten
Rebecca Makkai
Übersetzerin: Bettina Abarbanell
Es hat fast 200 Seiten gebraucht bis es mich packte, ein paar Seiten später kamen mir zum ersten Mal die Tränen und dann ging es gemeinsam mit ihm, im freien Fall, nach unten, bis zum Grund.
Sein Name ist Yale und er ist Kunstexperte in Chicago. Er sieht gut aus, er ist gebildet und ich möchte diesen coolen, schwulen Typen zum besten Freund haben. Mit ihm reden, feiern und lachen, aber ich merke ganz schnell, dass es keine lustige Geschichte mit ihm wird: Er hört nicht auf mich, schreibt meine Warnungen in den Wind. Und so bewegen wir uns gemeinsam in eine Richtung. Wir laufen auf etwas ganz schlimmes zu, etwas, dass erst seit kurzem einen Namen hat: AIDS.
1985 erlebt Yale, wie sein ganzer Freundeskreis von einem Virus beherrscht wird.
Der zweite Erzählstrang spielt 2015: Fiona reist nach Paris um ihre Tochter Claire zu finden, die seit Jahren untergetaucht ist. Vor ein paar Jahren war sie noch Mitglied einer Sekte, aber auch dort ist sie unauffindbar.
„Wenn er nicht gestorben wäre, hätten unsere Wege sich bald getrennt. Er hätte ein Leben draußen in der Welt geführt, wäre mir aus dem Sinn geraten. Aber wenn jemand tot ist und niemand außer einem Selbst sein Andenken hauptsächlich bewahrt, dann wäre es doch eine Art Mord, ihn loszulassen, oder? Ich habe ihn so geliebt, selbst wenn es eine komplizierte Liebe war, und wo soll all diese Liebe hin? Er war tot, also konnte sie sich nicht verändern, sich nicht in Gleichgültigkeit verwandeln. Ich saß mit dieser Liebe fest.“ (S.463/464)
Fazit:
Das Buch spricht ein wichtiges Thema an, das auch in der heutigen Zeit nicht vergessen werden sollte. Es ist ein bewegendes und trauriges Buch, eines was einem mit gebrochenen Herzen zurücklässt. Es liest sich schnell und ist in einer angenehmen Sprache geschrieben. Insgesamt ein gutes Buch, dem 150 Seiten weniger gut gestanden hätten. 4 Sterne von mir.
An dieser Stelle möchte ich noch ein weiteres Buch zum Thema AIDS empfehlen, welches auch im @eiseleverlag erschienen ist: ’Sag den Wölfen, ich bin zu Hause’ von Carol Rifka Brunt ist für mich das beste Buch überhaupt.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
eBook, ePUB
Der junge Kunstexperte Yale Tishman ist 1985 auf der Suche nach besonderen Objekten für seine Galerie, daher steht er mit Nora wegen einer Gemäldesammlung in Kontakt. Doch dann greift ein Virus um sich, der das Leben von ihm und seinen Freunden in Chicagos „Boystown“ …
Mehr
Der junge Kunstexperte Yale Tishman ist 1985 auf der Suche nach besonderen Objekten für seine Galerie, daher steht er mit Nora wegen einer Gemäldesammlung in Kontakt. Doch dann greift ein Virus um sich, der das Leben von ihm und seinen Freunden in Chicagos „Boystown“ verändert. Angst davor sich zu infizieren kommt auf. Freunde von Yale erkranken und sterben. Dazu wird der Hass auf die Homosexuellen noch größer als er ohnehin schon war.
Im zweiten Handlungsstrang, der 2015 spielt, ist Fiona in Paris auf der Suche nach ihrer Tochter Claire, zu der sie schon eine ganze Weile keinen Kontakt mehr hatte. Sie trifft alte Freunde, die sie aus Chicago kennt und Erinnerungen kommen hoch. Fiona hat damals ihren Broder Nico und ihren Freund Yale an das Virus verloren.
Dies ist ein komplexer und bewegender Roman, der sich aber nicht einfach so weg lesen lässt. Der Schreibstil von Rebecca Makkai ist wunderbar eindringlich. Es geht um Leben und Tod, um die Kunst und darum, wie Erlebtes und ein Leben lang begleitet und prägt.
Die beiden Handlungsstränge wechseln sich ab. Ich fand es aber wesentlich interessanter in die achtziger Jahre in Chicago einzutauchen und mitzuerleben, wie durch die Krankheit doch viele Lebensträume zerbrechen. Ich kann mich noch erinnern, als die ersten Meldungen über Aids in den Medien waren. Für mich war das aber weit weg, nun erleben ich wie die Wirklichkeit für die Betroffenen aussah und es hat mich berührt.
Bei allem dem Traurigen, der Angst und dem Tod, spürt man aber auch Optimismus. Es sind die Liebe, das Leben und die Freundschaft, die zählen.
Ein interessanter und berührender Roman.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
In Die Optimisten verarbeitet Rebecca Makkai auf mitreißende, packende und emotional tief berührende Weise und auf zwei Zeitebenen (Chicago 1985 bis frühe 90er und Paris 2015) Ereignisse rund um die erste Aids-Welle.
Ich habe sehr lang für diesen Roman gebraucht, was weder …
Mehr
In Die Optimisten verarbeitet Rebecca Makkai auf mitreißende, packende und emotional tief berührende Weise und auf zwei Zeitebenen (Chicago 1985 bis frühe 90er und Paris 2015) Ereignisse rund um die erste Aids-Welle.
Ich habe sehr lang für diesen Roman gebraucht, was weder meinem üblicherweise rasanten Lesetempo geschuldet ist, noch der Tatsache, dass dieses Buch mich nicht angesprochen hätte. Im Gegenteil: ich konnte Die Optimisten nicht schnell lesen, weil es sich hier um einen wirklich tollen, gut gemachten Roman handelt, der den Leser allerdings auch oftmals so stark erschüttert und angreift, dass man die Lektüre unterbrechen muss.
Die Autorin versteht es ganz hervorragend, die Unsicherheit, das Unwissen, die Angst und das mit einer Aids-Diagnose verbundene Bewusstsein des herannahenden Todes zu transportieren, ohne dabei zu unnötigen Schaueffekten oder übertriebener Dramatik zu greifen. Die Optimisten ist vielmehr ein sehr ruhiger Roman, der zu fesseln versteht, indem er die Furcht und Verzweiflung der ersten Aids-Jahre anhand des äußerst sympathisch gezeichneten, intellektuellen und mitfühlenden Yale personalisiert, den der Leser auf seinem Weg begleitet. Dabei geht es mitnichten nur um die Krankheit, sondern auch um Liebe, Freundschaft, Gemeinschaft, Familie und vor allem Kunst und die Bedeutung von Erinnerung und Vergangenheit. Makkai lässt sich viel Zeit, ein Bild der Zeit heraufzubeschwören, Freundeskreise auszuloten, aber auch die Realität der homosexuellen Community und den noch ungewohnten Alltag auf den Aids-Stationen darzustellen. Durch das gemäßigte Erzähltempo wird auch der Leser Teil dieser Welt und „freundet“ sich sozusagen mit Yale an, leidet und bangt mit ihm. Der Chicago-Teil weist trotz seines Umfangs nicht allzu viele Längen auf und ist in seiner Darstellung der Hilflosigkeit angesichts des Virus regelrecht – in einem positiven Sinne - schmerzhaft. Ebenso beeindruckend ist die Einsamkeit, die Isoliertheit der als Outsider betrachteten gay community, die hier anhand von Yale fast greifbar gemacht wird.
Der Paris-Teil hat mich nicht ganz so begeistert, was sicherlich daran liegt, das Fiona, eine Freundin von Yale, als Figur für den Leser schwieriger zu begreifen ist. Dennoch hat dieser Teil für den Romanaufbau seine wesentliche Funktion – auch wenn er sicherlich etwas kürzer hätte sein können - und verfügt durch Fionas Suche nach ihrer Tochter Claire über einen eigenen Spannungsbogen.
Die Optimisten ist ein besonderer und gelungener Roman, der mich wegen seiner Geschichte, seines großartig ausgestalteten Protagonisten und seines Erzählstil zutiefst bewegt hat.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Mann oh Mann, was für ein Roman!!!
Der von Bettina Abarbanell ins Deutsche übersetzte Roman spielt auf zwei Zeitebenen, ab 1985 in Chicago und 2015 in Paris. Er nimmt uns mit in die Zeit, als der HIV-Virus in den USA bekannt wurde und die ersten, meist homosexuelle Männer, …
Mehr
Mann oh Mann, was für ein Roman!!!
Der von Bettina Abarbanell ins Deutsche übersetzte Roman spielt auf zwei Zeitebenen, ab 1985 in Chicago und 2015 in Paris. Er nimmt uns mit in die Zeit, als der HIV-Virus in den USA bekannt wurde und die ersten, meist homosexuelle Männer, dahinraffte. Der Hauptprotagonist Yale, ein Kunstexperte und bei einer Galerie angestellt, und Fiona, Schwester von Yales bereits zu Beginn des Buches verstorbenem besten Freund, führen uns durch die damaligen Geschehnisse. In einem zweiten Erzählstrang in dieser Zeit wird die Kunstszene in Chicago beleuchtet und wir erleben mit Yale Höhen und Tiefen bei einem Austellungsprojekt, das ihm sehr am Herzen liegt.
Im Jahr 2015 begleiten wir Fiona bei ihrer Suche nach ihrer Tochter, die vor vielen Jahren den Kontakt zu ihr abgebrochen hat....
Die Geschichte hat mich in jedem Moment mitgenommen. Obwohl nicht in der Ich-Form geschrieben, sondern als personaler Erzähler in der dritten Person, folgte ich vor allem Yale auf Schritt und Tritt, quasi als sein unsichtbarer Freund. Ich freute mich und litt mit ihm und ich hatte Angst um ihn. Ich lebte in Chicago. Kurz gesagt, ich war vollkommen in die Welt der Clique von Yale und Fiona integriert. So konnte ich z.B mitempfinden, was es hieß, zu dieser Zeit in Chicago schwul zu sein. Und mir wurden die Augen geöffnet, welchen Ungerechtigkeiten HIV-Infizierte und bereits Erkrankte in den USA augeliefert waren (aber bestimmt nicht nur dort).
Immer wieder wird einem die Frage entgegengeworfen, was die Diskriminierung eines Familienangehörigen und die Trauer um geliebte Brüder, Freunde, Lebenspartner mit den Menschen macht, was für Folgen daraus entstehen und wie weitreichend sie sein können.
Ein Roman, der sehr, sehr lange nachhallt, gefühlvoll, ergreifend, mitreißend und dabei niemals sentimental. Ein Roman über die Liebe, in all ihren Facetten und über die Kraft der Freundschaft.
In meinen Augen ein Meisterwerk! Unbedingt lesen!!!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
„Sie hatte so viele Schuldgefühle, wenn sie an ihre Freunde zurückdachte – sie wünschte, sie hätte einige von ihnen überredet, sich früher testen zu lassen, wünschte, sie könnte die Zeit zurückdrehen (...)“
2015, Fiona sucht nach …
Mehr
„Sie hatte so viele Schuldgefühle, wenn sie an ihre Freunde zurückdachte – sie wünschte, sie hätte einige von ihnen überredet, sich früher testen zu lassen, wünschte, sie könnte die Zeit zurückdrehen (...)“
2015, Fiona sucht nach ihrer Tochter, schon seit Jahren hatte sie keinen Kontakt mehr zu ihr, jetzt gibt es Hinweise darauf, dass sie sich in Paris aufhalten könnte. Während der Suche quartiert sie sich bei ihren alten Freunden ein, die sie schon in den 80er Jahren kannte, als es in Chicago eine Gruppe von jungen Künstlern gab, vorwiegend Männer und schwul, die nicht nur die Liebe zur Kunst teilten, sondern auch die Angst vor dem noch unbekannten, todbringenden Virus, der nach und nach den Kreis der Freunde dezimierte, unter anderem auch Fionas Bruder Nico und ihren guten Freund Yale. Zwischen Erinnerungen an die damalige Zeit und der Nachforschungen nach Claire muss sich Fiona der Frage stellen, was sie in ihrem Leben richtig und falsch gemacht hat und vor allem, wie sie die Verbindung zu ihrer eigenen Tochter verlieren konnte.
Rebecca Makkais dritter Roman gehörte 2018 zu einem der erfolgreichsten Bücher des Jahres und war unter anderem Finalist für den Pulitzer Prize in der Kategorie Fiction. Es ist eine berauschende Geschichte, die voller Leben und voller Leben in Angst vor dem Tod ist. Viele Figuren existieren nur noch in der Erinnerung und gleichzeitig fällt es jenen, die zeitgleich leben schwer, zueinander zu finden. Auf mehreren Ebenen angesiedelt – 2015 sucht Fiona nach ihrer Tochter in Paris, 1985 lebt die Kunst-Clique in Chicago, Nora erinnert sich an die Zeit der 1920er in Paris im Kreis der großen Maler und Autoren – zeigen sich wiederkehrende Verhaltensweisen und das Leben in Angst wird gespiegelt. Das verbindende Element ist fraglos die Kunst, denn diese überdauert und kann gestern wie heute Emotionen auslösen, Momente konservieren und vergessene Episoden wieder aus den Tiefen des Gedächtnisses hervorbringen.
Sowohl die Nachwehen des 1. Weltkrieges wie auch die Anschläge auf das Bataclan 2015 sind nur die Leinwand, auf der die Handlung und das Lebensgefühl gezeichnet werden. Sie verschwinden unter dem Leben der Figuren, verblassen und bilden nur mehr einen Schatten. Ganz anders sieht die Bedrohung durch das noch unbekannte und damit unkontrollierbare AIDS Virus der 1980er Jahre aus. Dieses lässt sich nicht verdrängen oder übermalen, geradezu übermächtig bestimmt es immer wieder die Gedankenwelt der Figuren und lässt sich nur kurz vergessen, um zu leben.
Eine ausdrucksstarke Erzählung, die mich stark an Donna Tartt oder auch Paul Auster erinnert. „Die Optimisten“ steht durch und durch in der Tradition der Great American Novel, denn Makkai fängt überzeugend den Geist und das Lebensgefühl der 80er Jahre Kunstszene ein. Zwischen einerseits großer Begeisterung für die Malerei oder auch Fotografie und Film und andererseits der lähmenden Angst vor der unheilbaren Immunschwäche, liefern sich Leben und Sterben einen Wettkampf, der jedoch das irdische Dasein überdauert und sowohl in den Werken, der Erinnerung wie auch in den Nachkommen letztlich fortbesteht.
Vielschichtig und komplex, dabei wunderbar erzählt – ein Buch, das tief bewegt.
Weniger
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für