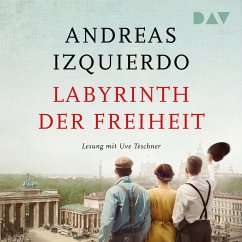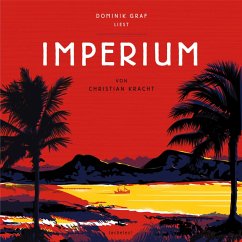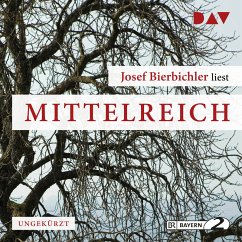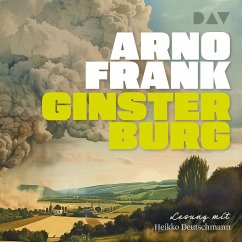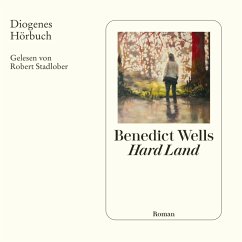Die Toten (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 283 Min.
Sprecher: Mues, Wanja
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
12,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
6 °P sammeln!
Christian Krachts neuer Roman führt uns mitten in die wilden, fiebrigen Jahre der Weimarer Republik, als die Filmkultur ihre frühe Blüte erlebte. In Berlin versucht ein Schweizer Filmregisseur, angestachelt von Siegfried Kracauer und Lotte Eisner, den UFA-Tycoon Hugenberg zur Finanzierung eines Film zu überreden, genauer gesagt: eines Gruselfilms, genauer gesagt: in Japan. Das überschneidet sich mit ebensolchen Plänen im dortigen Kaiserreich, mit denen man dem entstehenden Hollywood-Imperium Paroli bieten will. Pläne, die durch den Nationalsozialismus, der am Himmel von Berlin dämmert,...
Christian Krachts neuer Roman führt uns mitten in die wilden, fiebrigen Jahre der Weimarer Republik, als die Filmkultur ihre frühe Blüte erlebte. In Berlin versucht ein Schweizer Filmregisseur, angestachelt von Siegfried Kracauer und Lotte Eisner, den UFA-Tycoon Hugenberg zur Finanzierung eines Film zu überreden, genauer gesagt: eines Gruselfilms, genauer gesagt: in Japan. Das überschneidet sich mit ebensolchen Plänen im dortigen Kaiserreich, mit denen man dem entstehenden Hollywood-Imperium Paroli bieten will. Pläne, die durch den Nationalsozialismus, der am Himmel von Berlin dämmert, eine völlig neue Wendung bekommen. Ein Roman, der das Geheimnis des Films als Kunstwerk der Moderne genauso feiert wie seine großen Meister – von Charlie Chaplin über Heinz Rühmann bis Fritz Lang.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.




 buecher-magazin.deDas Fiktive und das Faktische, das Historische und das Hippe bilden im Werk des umtriebigen Christian Kracht seit jeher eine unauflösliche Allianz. Jetzt umkreist er beziehungsreich das Thema Film. Die Handlung spielt in den Dreißigerjahren, zum Teil in Deutschland, zum Teil in Japan, um schließlich in Hollywood zu (ver-)enden: Der Schweizer Filmregisseur Emil Nägeli reist nach Nazi-Berlin, um mit dem Propagandaminister einen Filmdeal einzutüten. Der Film soll in Japan gedreht werden, wo Nägelis deutsche Geliebte Ida sich bereits aufhält. Ida aber hat dort eine Affäre mit Nägelis japanischem Gegenstück Amakasu angefangen, eine Affäre so heiß, dass dem armen Emil nur noch bleibt, den Geschlechtsakt heimlich auf Zelluloid zu bannen, um damit Filmgeschichte zu ?schreiben. Während sich eher nebenbei dieses Liebesdreieck entfaltet, geben prominente Figuren der Filmgeschichte Cameo-Auftritte, vor allem Vertreter der sich gerade in ein Emigranten- und ein Angepassten-Segment aufspaltenden deutschen Filmszene der Dreißigerjahre. Auch Chaplin tritt auf: zum einen als er selbst, zum anderen als fiktive Figur, der für die Handlung eine geradezu fatale Rolle zukommt. Und der Tod steht sowohl am Ende als auch am Anfang des Romans, was dann irgendwie wohl auch seinen Titel rechtfertigt.
buecher-magazin.deDas Fiktive und das Faktische, das Historische und das Hippe bilden im Werk des umtriebigen Christian Kracht seit jeher eine unauflösliche Allianz. Jetzt umkreist er beziehungsreich das Thema Film. Die Handlung spielt in den Dreißigerjahren, zum Teil in Deutschland, zum Teil in Japan, um schließlich in Hollywood zu (ver-)enden: Der Schweizer Filmregisseur Emil Nägeli reist nach Nazi-Berlin, um mit dem Propagandaminister einen Filmdeal einzutüten. Der Film soll in Japan gedreht werden, wo Nägelis deutsche Geliebte Ida sich bereits aufhält. Ida aber hat dort eine Affäre mit Nägelis japanischem Gegenstück Amakasu angefangen, eine Affäre so heiß, dass dem armen Emil nur noch bleibt, den Geschlechtsakt heimlich auf Zelluloid zu bannen, um damit Filmgeschichte zu ?schreiben. Während sich eher nebenbei dieses Liebesdreieck entfaltet, geben prominente Figuren der Filmgeschichte Cameo-Auftritte, vor allem Vertreter der sich gerade in ein Emigranten- und ein Angepassten-Segment aufspaltenden deutschen Filmszene der Dreißigerjahre. Auch Chaplin tritt auf: zum einen als er selbst, zum anderen als fiktive Figur, der für die Handlung eine geradezu fatale Rolle zukommt. Und der Tod steht sowohl am Ende als auch am Anfang des Romans, was dann irgendwie wohl auch seinen Titel rechtfertigt.