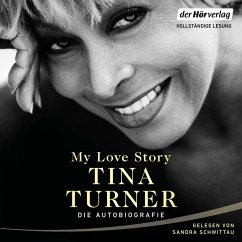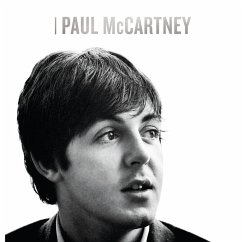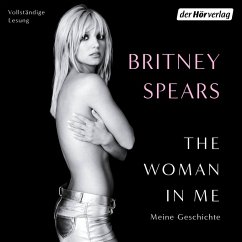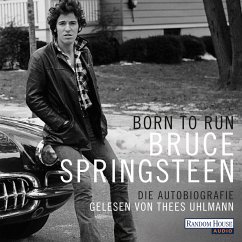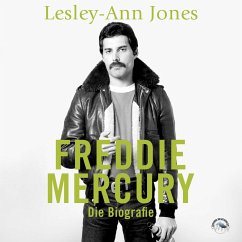Judith Holofernes
Hörbuch-Download MP3
Die Träume anderer Leute (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 592 Min.
Sprecher: Tschirner, Nora

PAYBACK Punkte
9 °P sammeln!





Album, Promotion, Tour. Beinahe zwanzig Jahre lang bestimmt die Dynamik des Musikbetriebs Judith Holofernes' Leben. In dieser Zeit wird sie, mit WIR SIND HELDEN und ihrem Soloprojekt, zu einer der bekanntesten und prägendsten Sängerinnen ihrer Generation. In ihren autobiografischen Texten blickt sie jetzt zurück - und zeigt sich als feinsinnige Erzählerin. Mit großer Klarheit und Zartheit und dem ihr eigenen Witz schreibt Holofernes über Fluch und Segen des frühen Erfolgs der HELDEN; über die Vereinbarkeit von Familie und Frontfrausein; über die öffentliche Wahrnehmung des eigenen K�...
Album, Promotion, Tour. Beinahe zwanzig Jahre lang bestimmt die Dynamik des Musikbetriebs Judith Holofernes' Leben. In dieser Zeit wird sie, mit WIR SIND HELDEN und ihrem Soloprojekt, zu einer der bekanntesten und prägendsten Sängerinnen ihrer Generation. In ihren autobiografischen Texten blickt sie jetzt zurück - und zeigt sich als feinsinnige Erzählerin. Mit großer Klarheit und Zartheit und dem ihr eigenen Witz schreibt Holofernes über Fluch und Segen des frühen Erfolgs der HELDEN; über die Vereinbarkeit von Familie und Frontfrausein; über die öffentliche Wahrnehmung des eigenen Körpers, das Aufwachsen mit ihrer lesbischen Mutter in Freiburg; über die tiefen Einschnitte in ihrem Leben, die Krisen, den Schmerz. Immer wieder geht es auch um die Musikbranche, um das Verhältnis zu ihren Fans, die undankbarsten Konzerte der Welt, aber auch um die starren Mechanismen des Betriebs und den Sexismus. Und um den deutschen Pop, der heute vom Schlager so oft nicht mehr zu unterscheiden ist. Eindrücklich zeigt Judith Holofernes in DIE TRÄUME ANDERER LEUTE, wie sie sich nach und nach aus den kommerziellen Zwängen und der Enge des Musikbetriebs befreit hat. Wie sie zu der Künstlerin wurde, die sie so lange sein wollte - und damit ihr Leben zurückbekam. GUTEN TAG.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Judith Holofernes, ehemals Frontfrau und Texterin der Band Wir sind Helden , hat seit dem Helden-Aus zwei Soloalben und ein Buch mit Tiergedichten veröffentlicht. Seit ihrem Rücktritt vom Musikbusiness 2019 ist sie crowdbasierte Künstlerin, unterstützt durch ihre Community auf der Plattform Patreon. In ihrem Podcast 'Salon Holofernes' spricht sie mit anderen Künstler:innen über ihre kreative Arbeit. 2022 erschien ihr Buch 'Die Träume anderer Leute', das mehrere Wochen auf der SPIEGEL-Bestsellerliste stand.
Produktdetails
- Verlag: Lübbe Audio
- Gesamtlaufzeit: 592 Min.
- Erscheinungstermin: 8. September 2022
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783754005415
- Artikelnr.: 65311472
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
In Judith Holofernes' "Die Träume anderer Leute" kann Rezensentin Elena Witzeck nachvollziehen, wie das ist, als junge Frau in einer Männerdomäne, der Musik, Erfolg zu haben, älter zu werden, Kinder und Krankheiten zu bekommen. Die Sängerin der Band "Wir sind Helden" spare dabei nicht an den Schwierigkeiten, die Comebacks, musikalische Veränderung und auch das Äußere betreffen. Die "Angst vor Grausamkeit", vor der ständigen Negativbewertung, begleite Holofernes dabei besonders und regt Witzeck auch zur Selbstreflexion an, was ihre eigene journalistische Arbeit und den Umgang mit Musikerinnen betrifft. Darüber hinaus lobt sie die meist sehr gelungene Sprache und auch den unterhaltenden Anteil dieser Memoiren.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.11.2022
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.11.2022Vorsicht vor dem harmlosesten Punk von Berlin
Wir müssen nur wollen: Judith Holofernes erzählt von ihrer Zeit in der Popindustrie und der Befürchtung, nie wieder cool zu sein.
Von Elena Witzeck
Auf ihren Konzerten erzählte Judith Holofernes Geschichten. Wer damals in der Provinz groß wurde, kannte Bands wie Tomte und Kettkar auf der Bühne, Männer in Lederjacken, schweigsame Männer mit Gitarren. Dass da eine Frau stand, breitbeinig, und Instrumente spielte, die sie, ganz Punk, nur mäßig beherrschte, dass sie in aller Ruhe von Freundinnen erzählte, die sich in sie verliebt hatten, weil, ist die Grenze zwischen Freundschaft und Liebe nicht ein Mysterium, war euphorisierend. So viel zu den frühen
Wir müssen nur wollen: Judith Holofernes erzählt von ihrer Zeit in der Popindustrie und der Befürchtung, nie wieder cool zu sein.
Von Elena Witzeck
Auf ihren Konzerten erzählte Judith Holofernes Geschichten. Wer damals in der Provinz groß wurde, kannte Bands wie Tomte und Kettkar auf der Bühne, Männer in Lederjacken, schweigsame Männer mit Gitarren. Dass da eine Frau stand, breitbeinig, und Instrumente spielte, die sie, ganz Punk, nur mäßig beherrschte, dass sie in aller Ruhe von Freundinnen erzählte, die sich in sie verliebt hatten, weil, ist die Grenze zwischen Freundschaft und Liebe nicht ein Mysterium, war euphorisierend. So viel zu den frühen
Mehr anzeigen
2000ern.
Zehn Jahre später war Judith Holofernes Mitte dreißig, und ihre Band Wir sind Helden trennte sich, selbst noch jung und sehr erfolgreich. Sie hatte zwei Kinder, mit denen sie tourte, und eine ausgewachsene Depression. Seite fünfzig von "Die Träume anderer Leute", und es ist vorbei mit den Helden. Von hier an geht es darum, wie sich die Popkarriere einer Frau über die Jahre verändert. Mit Kindern. Mit dem Alter. Eine Vertiefung ihrer Blogbeiträge, zusammengehalten von der Frage: Wir kommt man würdevoll aus der Sache raus?
Bekanntermaßen ist das Popbusiness kein gemütliches. Wenige Künstler sprechen darüber, jedenfalls nicht so, dass man es draußen verstehen würde. Manchmal klingt es larmoyant, manchmal unehrlich. In Deutschland noch dazu bestürzend unglamourös.
Judith Holofernes hat die richtigen Worte, das ist seit Heldenzeiten klar, seit den lyrischen, erschöpften Texten auf ihrem Album "Bring mich nach Hause". Bei der Sache mit Holofernes gibt es nur ein Problem. Alle glauben sie zu kennen, als Freundin, nahbar selbst in ihrer Bereitschaft zur Rebellion, der "harmloseste Punk von Berlin". Was will sie noch offenbaren? Muss man es wissen, will man es?
Als Judith Holofernes nach ihrem ersten Abschied zurück auf die Bühne kam, tat sie es mit Hochglanzbildern, Blumenschmuck und blondem Haar. Ihre Fans fühlten sich betrogen. Aber jedes Comeback hat seine eigene Dynamik. Davon, dass die Plattenfirma spontan entschied, das Album acht Wochen früher zu veröffentlichen, lässt sich jetzt lesen und davon, wie es dazu kam, dass auf einmal immer mehr Anfragen von Eltern- und Frauenzeitschriften kamen. Wie man ihr empfahl, die Gespräche über das Muttersein dankend anzunehmen, und sie dabei das Gefühl hatte, einen Dienst an der Menschheit zu tun. Bis es auf einmal hieß, sie habe sich aus ihrer Zielgruppe herausbewegt. Warum nur, wird sie dann von ihrem eigenen Team gefragt, werden deine Konzerte nicht mehr voll? "Ich hatte mich um mein glorioses arschcooles Comeback gebracht", schreibt Holofernes. "Ich würde nie wieder cool sein."
Und zugleich war Holofernes klug genug, alles zu durchschauen: "So ein Deal ist eine saubere Transaktion. Die Plattenfirma investiert einen Haufen Geld und Arbeit, um die Künstlerin bis in den hintersten Winkel der Republik sichtbar zu machen. Die Künstlerin verpflichtet sich im Gegenzug, diesen Aufwand wert zu sein. (...) Ein Produkt zu sein, das sich vermarkten lohnt." Nur dass am Ende das Produkt im Kerker sitzt.
Einmal leitete ihr Manager ihr eine Studie über ihre Bekanntheit weiter. Es stellte sich heraus, dass die Fans mit keiner ihrer Verfremdungen etwas anfangen konnten. Sie mochten Judith Holofernes eben ganz natürlich. Alles, was neu aussah, war unter kommerziellen Gesichtspunkten ein Flop. Um daraus auszubrechen, brauchte es eine amerikanische Feministin, die schon sehr viel Erfahrung im Untergraben von Erwartungen hatte, siehe Instagram, und in die ausnahmsweise Holofernes sich verlieben konnte: Amanda Palmer.
Die frühe Holofernes sah sich als Junge unter Jungen, und so trat sie auf mit ihrer Band. Und nun schreibt diese Frau über Schönheitsideale, schreibt darüber, wie sie begann, mit ihren Kameraleuten abzusprechen, von welcher Seite sie gefilmt werden soll, schreibt von der Angst vor Demütigung, Entblößung, Vernichtung. Und schließlich von der Frage, welcher Rockstar man sein will, wenn man älter wird. Patti Smith, die launische Joni Mitchell? Marianne Faithfull, der man rund um die Uhr ihr Gewicht auf die Nase band? "Sagte ich schon, dass ich Angst vor Grausamkeit hatte?" Und sie schien damit als Künstlerin nicht die Einzige zu sein. "Dazu schienen die meisten von ihnen etwa sechs Stunden am Tag Yoga zu machen, als Entschuldigung für die Dreistigkeit, immer noch da zu sein."
Aber der größte Verrat ihrer Karriere war für Holofernes der an der Konsumkritik, den Verweigerungspraktiken, der Antileistungsethik, die sie in ihren frühen Songs besang und die so viele feierten. Sie war überall: "Müssen nur wollen", "Die Konkurrenz", "Guten Tag", "Soundso". Sie war es, schreibt Holofernes, "die ironischerweise unseren Erfolg und unsere zwölf Jahre andauernde, durchgängige Geschäftigkeit besiegelt hatte".
Warum also ein solches Buch außer zur Selbsterkundung? Weil es nicht immer, aber oft genug das hält, was ein Holofernes-Produkt verspricht. Lyrische, hintersinnige Sätze: "Ich hörte zu und dehnte den Muskel meines Herzens, bis sich die ersten Risse zeigten." Und Unterhaltung, zum Glück. Einen feinen Spott, wenn es etwa um die dadaistischen Gesprächsverläufe des Managers geht.
Ansonsten ist "Die Träume anderer Leute" kein einfacher Stoff, auch und gerade für Journalisten nicht, weil man sich natürlich ständig fragt, wie viel man selbst bei der Projektion von Themen, beim Transfer der Kunst auf Künstler falsch macht. Weil eine Figur, die so viel Widersprüchliches in sich trägt, Angst und Mut, Auf und Ab, Eigensinn und Bescheidenheit und Produktivität, von der deutschen Popindustrie beinah zermalmt wurde, der Industrie, die bei einer Preisverleihung Helge Schneider zusammen mit Placebo nominiert und die Grenze zwischen Pop und Schlager dümmlich grinsend verwischt. Ebenjene, die eine freundliche Sängerin von nebenan in ihrem Buch sehr befriedigend dekonstruiert.
Judith Holofernes: "Die Träume anderer Leute".
Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2022. 416 S., geb., 24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Zehn Jahre später war Judith Holofernes Mitte dreißig, und ihre Band Wir sind Helden trennte sich, selbst noch jung und sehr erfolgreich. Sie hatte zwei Kinder, mit denen sie tourte, und eine ausgewachsene Depression. Seite fünfzig von "Die Träume anderer Leute", und es ist vorbei mit den Helden. Von hier an geht es darum, wie sich die Popkarriere einer Frau über die Jahre verändert. Mit Kindern. Mit dem Alter. Eine Vertiefung ihrer Blogbeiträge, zusammengehalten von der Frage: Wir kommt man würdevoll aus der Sache raus?
Bekanntermaßen ist das Popbusiness kein gemütliches. Wenige Künstler sprechen darüber, jedenfalls nicht so, dass man es draußen verstehen würde. Manchmal klingt es larmoyant, manchmal unehrlich. In Deutschland noch dazu bestürzend unglamourös.
Judith Holofernes hat die richtigen Worte, das ist seit Heldenzeiten klar, seit den lyrischen, erschöpften Texten auf ihrem Album "Bring mich nach Hause". Bei der Sache mit Holofernes gibt es nur ein Problem. Alle glauben sie zu kennen, als Freundin, nahbar selbst in ihrer Bereitschaft zur Rebellion, der "harmloseste Punk von Berlin". Was will sie noch offenbaren? Muss man es wissen, will man es?
Als Judith Holofernes nach ihrem ersten Abschied zurück auf die Bühne kam, tat sie es mit Hochglanzbildern, Blumenschmuck und blondem Haar. Ihre Fans fühlten sich betrogen. Aber jedes Comeback hat seine eigene Dynamik. Davon, dass die Plattenfirma spontan entschied, das Album acht Wochen früher zu veröffentlichen, lässt sich jetzt lesen und davon, wie es dazu kam, dass auf einmal immer mehr Anfragen von Eltern- und Frauenzeitschriften kamen. Wie man ihr empfahl, die Gespräche über das Muttersein dankend anzunehmen, und sie dabei das Gefühl hatte, einen Dienst an der Menschheit zu tun. Bis es auf einmal hieß, sie habe sich aus ihrer Zielgruppe herausbewegt. Warum nur, wird sie dann von ihrem eigenen Team gefragt, werden deine Konzerte nicht mehr voll? "Ich hatte mich um mein glorioses arschcooles Comeback gebracht", schreibt Holofernes. "Ich würde nie wieder cool sein."
Und zugleich war Holofernes klug genug, alles zu durchschauen: "So ein Deal ist eine saubere Transaktion. Die Plattenfirma investiert einen Haufen Geld und Arbeit, um die Künstlerin bis in den hintersten Winkel der Republik sichtbar zu machen. Die Künstlerin verpflichtet sich im Gegenzug, diesen Aufwand wert zu sein. (...) Ein Produkt zu sein, das sich vermarkten lohnt." Nur dass am Ende das Produkt im Kerker sitzt.
Einmal leitete ihr Manager ihr eine Studie über ihre Bekanntheit weiter. Es stellte sich heraus, dass die Fans mit keiner ihrer Verfremdungen etwas anfangen konnten. Sie mochten Judith Holofernes eben ganz natürlich. Alles, was neu aussah, war unter kommerziellen Gesichtspunkten ein Flop. Um daraus auszubrechen, brauchte es eine amerikanische Feministin, die schon sehr viel Erfahrung im Untergraben von Erwartungen hatte, siehe Instagram, und in die ausnahmsweise Holofernes sich verlieben konnte: Amanda Palmer.
Die frühe Holofernes sah sich als Junge unter Jungen, und so trat sie auf mit ihrer Band. Und nun schreibt diese Frau über Schönheitsideale, schreibt darüber, wie sie begann, mit ihren Kameraleuten abzusprechen, von welcher Seite sie gefilmt werden soll, schreibt von der Angst vor Demütigung, Entblößung, Vernichtung. Und schließlich von der Frage, welcher Rockstar man sein will, wenn man älter wird. Patti Smith, die launische Joni Mitchell? Marianne Faithfull, der man rund um die Uhr ihr Gewicht auf die Nase band? "Sagte ich schon, dass ich Angst vor Grausamkeit hatte?" Und sie schien damit als Künstlerin nicht die Einzige zu sein. "Dazu schienen die meisten von ihnen etwa sechs Stunden am Tag Yoga zu machen, als Entschuldigung für die Dreistigkeit, immer noch da zu sein."
Aber der größte Verrat ihrer Karriere war für Holofernes der an der Konsumkritik, den Verweigerungspraktiken, der Antileistungsethik, die sie in ihren frühen Songs besang und die so viele feierten. Sie war überall: "Müssen nur wollen", "Die Konkurrenz", "Guten Tag", "Soundso". Sie war es, schreibt Holofernes, "die ironischerweise unseren Erfolg und unsere zwölf Jahre andauernde, durchgängige Geschäftigkeit besiegelt hatte".
Warum also ein solches Buch außer zur Selbsterkundung? Weil es nicht immer, aber oft genug das hält, was ein Holofernes-Produkt verspricht. Lyrische, hintersinnige Sätze: "Ich hörte zu und dehnte den Muskel meines Herzens, bis sich die ersten Risse zeigten." Und Unterhaltung, zum Glück. Einen feinen Spott, wenn es etwa um die dadaistischen Gesprächsverläufe des Managers geht.
Ansonsten ist "Die Träume anderer Leute" kein einfacher Stoff, auch und gerade für Journalisten nicht, weil man sich natürlich ständig fragt, wie viel man selbst bei der Projektion von Themen, beim Transfer der Kunst auf Künstler falsch macht. Weil eine Figur, die so viel Widersprüchliches in sich trägt, Angst und Mut, Auf und Ab, Eigensinn und Bescheidenheit und Produktivität, von der deutschen Popindustrie beinah zermalmt wurde, der Industrie, die bei einer Preisverleihung Helge Schneider zusammen mit Placebo nominiert und die Grenze zwischen Pop und Schlager dümmlich grinsend verwischt. Ebenjene, die eine freundliche Sängerin von nebenan in ihrem Buch sehr befriedigend dekonstruiert.
Judith Holofernes: "Die Träume anderer Leute".
Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2022. 416 S., geb., 24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
»[Holofernes erzählt] auf eine Weise, die berührt, die einen zum Lachen und Weinen bringen kann. Ein außergewöhnlich gut geschriebenes Buch.« Matthias Kugler SWR 3 20221201
Vorsicht vor dem harmlosesten Punk von Berlin
Wir müssen nur wollen: Judith Holofernes erzählt von ihrer Zeit in der Popindustrie und der Befürchtung, nie wieder cool zu sein.
Von Elena Witzeck
Auf ihren Konzerten erzählte Judith Holofernes Geschichten. Wer damals in der Provinz groß wurde, kannte Bands wie Tomte und Kettkar auf der Bühne, Männer in Lederjacken, schweigsame Männer mit Gitarren. Dass da eine Frau stand, breitbeinig, und Instrumente spielte, die sie, ganz Punk, nur mäßig beherrschte, dass sie in aller Ruhe von Freundinnen erzählte, die sich in sie verliebt hatten, weil, ist die Grenze zwischen Freundschaft und Liebe nicht ein Mysterium, war euphorisierend. So viel zu den frühen
Wir müssen nur wollen: Judith Holofernes erzählt von ihrer Zeit in der Popindustrie und der Befürchtung, nie wieder cool zu sein.
Von Elena Witzeck
Auf ihren Konzerten erzählte Judith Holofernes Geschichten. Wer damals in der Provinz groß wurde, kannte Bands wie Tomte und Kettkar auf der Bühne, Männer in Lederjacken, schweigsame Männer mit Gitarren. Dass da eine Frau stand, breitbeinig, und Instrumente spielte, die sie, ganz Punk, nur mäßig beherrschte, dass sie in aller Ruhe von Freundinnen erzählte, die sich in sie verliebt hatten, weil, ist die Grenze zwischen Freundschaft und Liebe nicht ein Mysterium, war euphorisierend. So viel zu den frühen
Mehr anzeigen
2000ern.
Zehn Jahre später war Judith Holofernes Mitte dreißig, und ihre Band Wir sind Helden trennte sich, selbst noch jung und sehr erfolgreich. Sie hatte zwei Kinder, mit denen sie tourte, und eine ausgewachsene Depression. Seite fünfzig von "Die Träume anderer Leute", und es ist vorbei mit den Helden. Von hier an geht es darum, wie sich die Popkarriere einer Frau über die Jahre verändert. Mit Kindern. Mit dem Alter. Eine Vertiefung ihrer Blogbeiträge, zusammengehalten von der Frage: Wir kommt man würdevoll aus der Sache raus?
Bekanntermaßen ist das Popbusiness kein gemütliches. Wenige Künstler sprechen darüber, jedenfalls nicht so, dass man es draußen verstehen würde. Manchmal klingt es larmoyant, manchmal unehrlich. In Deutschland noch dazu bestürzend unglamourös.
Judith Holofernes hat die richtigen Worte, das ist seit Heldenzeiten klar, seit den lyrischen, erschöpften Texten auf ihrem Album "Bring mich nach Hause". Bei der Sache mit Holofernes gibt es nur ein Problem. Alle glauben sie zu kennen, als Freundin, nahbar selbst in ihrer Bereitschaft zur Rebellion, der "harmloseste Punk von Berlin". Was will sie noch offenbaren? Muss man es wissen, will man es?
Als Judith Holofernes nach ihrem ersten Abschied zurück auf die Bühne kam, tat sie es mit Hochglanzbildern, Blumenschmuck und blondem Haar. Ihre Fans fühlten sich betrogen. Aber jedes Comeback hat seine eigene Dynamik. Davon, dass die Plattenfirma spontan entschied, das Album acht Wochen früher zu veröffentlichen, lässt sich jetzt lesen und davon, wie es dazu kam, dass auf einmal immer mehr Anfragen von Eltern- und Frauenzeitschriften kamen. Wie man ihr empfahl, die Gespräche über das Muttersein dankend anzunehmen, und sie dabei das Gefühl hatte, einen Dienst an der Menschheit zu tun. Bis es auf einmal hieß, sie habe sich aus ihrer Zielgruppe herausbewegt. Warum nur, wird sie dann von ihrem eigenen Team gefragt, werden deine Konzerte nicht mehr voll? "Ich hatte mich um mein glorioses arschcooles Comeback gebracht", schreibt Holofernes. "Ich würde nie wieder cool sein."
Und zugleich war Holofernes klug genug, alles zu durchschauen: "So ein Deal ist eine saubere Transaktion. Die Plattenfirma investiert einen Haufen Geld und Arbeit, um die Künstlerin bis in den hintersten Winkel der Republik sichtbar zu machen. Die Künstlerin verpflichtet sich im Gegenzug, diesen Aufwand wert zu sein. (...) Ein Produkt zu sein, das sich vermarkten lohnt." Nur dass am Ende das Produkt im Kerker sitzt.
Einmal leitete ihr Manager ihr eine Studie über ihre Bekanntheit weiter. Es stellte sich heraus, dass die Fans mit keiner ihrer Verfremdungen etwas anfangen konnten. Sie mochten Judith Holofernes eben ganz natürlich. Alles, was neu aussah, war unter kommerziellen Gesichtspunkten ein Flop. Um daraus auszubrechen, brauchte es eine amerikanische Feministin, die schon sehr viel Erfahrung im Untergraben von Erwartungen hatte, siehe Instagram, und in die ausnahmsweise Holofernes sich verlieben konnte: Amanda Palmer.
Die frühe Holofernes sah sich als Junge unter Jungen, und so trat sie auf mit ihrer Band. Und nun schreibt diese Frau über Schönheitsideale, schreibt darüber, wie sie begann, mit ihren Kameraleuten abzusprechen, von welcher Seite sie gefilmt werden soll, schreibt von der Angst vor Demütigung, Entblößung, Vernichtung. Und schließlich von der Frage, welcher Rockstar man sein will, wenn man älter wird. Patti Smith, die launische Joni Mitchell? Marianne Faithfull, der man rund um die Uhr ihr Gewicht auf die Nase band? "Sagte ich schon, dass ich Angst vor Grausamkeit hatte?" Und sie schien damit als Künstlerin nicht die Einzige zu sein. "Dazu schienen die meisten von ihnen etwa sechs Stunden am Tag Yoga zu machen, als Entschuldigung für die Dreistigkeit, immer noch da zu sein."
Aber der größte Verrat ihrer Karriere war für Holofernes der an der Konsumkritik, den Verweigerungspraktiken, der Antileistungsethik, die sie in ihren frühen Songs besang und die so viele feierten. Sie war überall: "Müssen nur wollen", "Die Konkurrenz", "Guten Tag", "Soundso". Sie war es, schreibt Holofernes, "die ironischerweise unseren Erfolg und unsere zwölf Jahre andauernde, durchgängige Geschäftigkeit besiegelt hatte".
Warum also ein solches Buch außer zur Selbsterkundung? Weil es nicht immer, aber oft genug das hält, was ein Holofernes-Produkt verspricht. Lyrische, hintersinnige Sätze: "Ich hörte zu und dehnte den Muskel meines Herzens, bis sich die ersten Risse zeigten." Und Unterhaltung, zum Glück. Einen feinen Spott, wenn es etwa um die dadaistischen Gesprächsverläufe des Managers geht.
Ansonsten ist "Die Träume anderer Leute" kein einfacher Stoff, auch und gerade für Journalisten nicht, weil man sich natürlich ständig fragt, wie viel man selbst bei der Projektion von Themen, beim Transfer der Kunst auf Künstler falsch macht. Weil eine Figur, die so viel Widersprüchliches in sich trägt, Angst und Mut, Auf und Ab, Eigensinn und Bescheidenheit und Produktivität, von der deutschen Popindustrie beinah zermalmt wurde, der Industrie, die bei einer Preisverleihung Helge Schneider zusammen mit Placebo nominiert und die Grenze zwischen Pop und Schlager dümmlich grinsend verwischt. Ebenjene, die eine freundliche Sängerin von nebenan in ihrem Buch sehr befriedigend dekonstruiert.
Judith Holofernes: "Die Träume anderer Leute".
Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2022. 416 S., geb., 24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Zehn Jahre später war Judith Holofernes Mitte dreißig, und ihre Band Wir sind Helden trennte sich, selbst noch jung und sehr erfolgreich. Sie hatte zwei Kinder, mit denen sie tourte, und eine ausgewachsene Depression. Seite fünfzig von "Die Träume anderer Leute", und es ist vorbei mit den Helden. Von hier an geht es darum, wie sich die Popkarriere einer Frau über die Jahre verändert. Mit Kindern. Mit dem Alter. Eine Vertiefung ihrer Blogbeiträge, zusammengehalten von der Frage: Wir kommt man würdevoll aus der Sache raus?
Bekanntermaßen ist das Popbusiness kein gemütliches. Wenige Künstler sprechen darüber, jedenfalls nicht so, dass man es draußen verstehen würde. Manchmal klingt es larmoyant, manchmal unehrlich. In Deutschland noch dazu bestürzend unglamourös.
Judith Holofernes hat die richtigen Worte, das ist seit Heldenzeiten klar, seit den lyrischen, erschöpften Texten auf ihrem Album "Bring mich nach Hause". Bei der Sache mit Holofernes gibt es nur ein Problem. Alle glauben sie zu kennen, als Freundin, nahbar selbst in ihrer Bereitschaft zur Rebellion, der "harmloseste Punk von Berlin". Was will sie noch offenbaren? Muss man es wissen, will man es?
Als Judith Holofernes nach ihrem ersten Abschied zurück auf die Bühne kam, tat sie es mit Hochglanzbildern, Blumenschmuck und blondem Haar. Ihre Fans fühlten sich betrogen. Aber jedes Comeback hat seine eigene Dynamik. Davon, dass die Plattenfirma spontan entschied, das Album acht Wochen früher zu veröffentlichen, lässt sich jetzt lesen und davon, wie es dazu kam, dass auf einmal immer mehr Anfragen von Eltern- und Frauenzeitschriften kamen. Wie man ihr empfahl, die Gespräche über das Muttersein dankend anzunehmen, und sie dabei das Gefühl hatte, einen Dienst an der Menschheit zu tun. Bis es auf einmal hieß, sie habe sich aus ihrer Zielgruppe herausbewegt. Warum nur, wird sie dann von ihrem eigenen Team gefragt, werden deine Konzerte nicht mehr voll? "Ich hatte mich um mein glorioses arschcooles Comeback gebracht", schreibt Holofernes. "Ich würde nie wieder cool sein."
Und zugleich war Holofernes klug genug, alles zu durchschauen: "So ein Deal ist eine saubere Transaktion. Die Plattenfirma investiert einen Haufen Geld und Arbeit, um die Künstlerin bis in den hintersten Winkel der Republik sichtbar zu machen. Die Künstlerin verpflichtet sich im Gegenzug, diesen Aufwand wert zu sein. (...) Ein Produkt zu sein, das sich vermarkten lohnt." Nur dass am Ende das Produkt im Kerker sitzt.
Einmal leitete ihr Manager ihr eine Studie über ihre Bekanntheit weiter. Es stellte sich heraus, dass die Fans mit keiner ihrer Verfremdungen etwas anfangen konnten. Sie mochten Judith Holofernes eben ganz natürlich. Alles, was neu aussah, war unter kommerziellen Gesichtspunkten ein Flop. Um daraus auszubrechen, brauchte es eine amerikanische Feministin, die schon sehr viel Erfahrung im Untergraben von Erwartungen hatte, siehe Instagram, und in die ausnahmsweise Holofernes sich verlieben konnte: Amanda Palmer.
Die frühe Holofernes sah sich als Junge unter Jungen, und so trat sie auf mit ihrer Band. Und nun schreibt diese Frau über Schönheitsideale, schreibt darüber, wie sie begann, mit ihren Kameraleuten abzusprechen, von welcher Seite sie gefilmt werden soll, schreibt von der Angst vor Demütigung, Entblößung, Vernichtung. Und schließlich von der Frage, welcher Rockstar man sein will, wenn man älter wird. Patti Smith, die launische Joni Mitchell? Marianne Faithfull, der man rund um die Uhr ihr Gewicht auf die Nase band? "Sagte ich schon, dass ich Angst vor Grausamkeit hatte?" Und sie schien damit als Künstlerin nicht die Einzige zu sein. "Dazu schienen die meisten von ihnen etwa sechs Stunden am Tag Yoga zu machen, als Entschuldigung für die Dreistigkeit, immer noch da zu sein."
Aber der größte Verrat ihrer Karriere war für Holofernes der an der Konsumkritik, den Verweigerungspraktiken, der Antileistungsethik, die sie in ihren frühen Songs besang und die so viele feierten. Sie war überall: "Müssen nur wollen", "Die Konkurrenz", "Guten Tag", "Soundso". Sie war es, schreibt Holofernes, "die ironischerweise unseren Erfolg und unsere zwölf Jahre andauernde, durchgängige Geschäftigkeit besiegelt hatte".
Warum also ein solches Buch außer zur Selbsterkundung? Weil es nicht immer, aber oft genug das hält, was ein Holofernes-Produkt verspricht. Lyrische, hintersinnige Sätze: "Ich hörte zu und dehnte den Muskel meines Herzens, bis sich die ersten Risse zeigten." Und Unterhaltung, zum Glück. Einen feinen Spott, wenn es etwa um die dadaistischen Gesprächsverläufe des Managers geht.
Ansonsten ist "Die Träume anderer Leute" kein einfacher Stoff, auch und gerade für Journalisten nicht, weil man sich natürlich ständig fragt, wie viel man selbst bei der Projektion von Themen, beim Transfer der Kunst auf Künstler falsch macht. Weil eine Figur, die so viel Widersprüchliches in sich trägt, Angst und Mut, Auf und Ab, Eigensinn und Bescheidenheit und Produktivität, von der deutschen Popindustrie beinah zermalmt wurde, der Industrie, die bei einer Preisverleihung Helge Schneider zusammen mit Placebo nominiert und die Grenze zwischen Pop und Schlager dümmlich grinsend verwischt. Ebenjene, die eine freundliche Sängerin von nebenan in ihrem Buch sehr befriedigend dekonstruiert.
Judith Holofernes: "Die Träume anderer Leute".
Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2022. 416 S., geb., 24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Gebundenes Buch
Einmal Popstar und zurück
Eins vorweg: Ein klassisches „Wir sind Helden“-Fangirl war ich nie. Ich mochte ihre Lieder ganz gern, habe die Band einmal live gesehen, aber das war´s dann auch schon. Dennoch wollte ich Judith Holofernes‘ Buch „Die Träume …
Mehr
Einmal Popstar und zurück
Eins vorweg: Ein klassisches „Wir sind Helden“-Fangirl war ich nie. Ich mochte ihre Lieder ganz gern, habe die Band einmal live gesehen, aber das war´s dann auch schon. Dennoch wollte ich Judith Holofernes‘ Buch „Die Träume anderer Leute“ unbedingt lesen, da ich eine Schwäche für Musiker-Biografien habe.
Einen passenderen Titel als den gleichnamigen „Wir sind Helden“-Song aus dem Jahr 2010 hätte deren ehemalige Frontfrau für ihr Buch nicht wählen können. Sie beschreibt darin die kreative Enge in den Mühlen der Musikindustrie, in der Verkaufszahlen alles sind und der Künstler nicht mehr ist als ein Produkt. Judith Holofernes legt in "Die Träume anderer Leute" den Schwerpunkt aber nicht auf die schillernden Momente ihrer Karriere mit den Helden, sondern auf die Zeit danach. 2012 trennten sich die Wege der Band und die Musikerin stand nun vor der schwierigen Aufgabe, sich neu zu erfinden. An kreativen Ideen mangelte es ihr nicht, aber eines stand für sie fest: Sie wollte nicht länger die Träume anderer Leute träumen.
Zu Beginn war es ein wenig schwierig, mich an den Schreibstil von Judith Holofernes zu gewöhnen. In manchen Passagen wirkte der hektisch und ein bisschen überdreht. Aber einmal im Flow, machte es mir immer mehr Spaß, dieses Buch zu lesen und ihr zuzuhören. Ja, zuzuhören – und das bei einem Printbuch! Denn mit der Zeit kommt es einem tatsächlich so vor, als würde man neben der erzählenden Judith Holofernes auf dem Sofa sitzen. Sie spart dabei nicht an Wortwitz und verfügt über einen schier unerschöpflichen Wortschatz – langweilig wird es also nie.
Die Musikerin zeigt ihre verletzliche Seite und gewährt Einblicke in ihr Familienleben, das so gar nicht rockstarmäßig, sondern erschreckend normal ist. Ganz offen beschreibt Judith Holofernes, wie sie schließlich krank wird, nicht mehr funktioniert und erst nach einer Weile wieder auf die Beine kommt.
Besonders liebenswert an „Die Träume anderer Leute“ ist, wie herrlich uneitel die Autorin über sich selbst schreibt.
„Ich sehe an schlechten Tagen aus wie die verwirrte Lieblingstante von Boy George.“
(Seite 182)
Neben allem Hadern und Zweifeln, wie sie sich eine neue Karriere aufbauen kann, ohne dabei immer auf die Frontfrau von „Wir sind Helden“ reduziert zu werden, kommt Judith Holofernes eins zum Glück nie abhanden: Ihr Humor.
Ergo: Definitiv lesenswert für alle Musikinteressierten und Künstler!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Cover:
Das Cover hat mich fasziniert. Es ergreift und irritiert zugleich. Es zeigt die Gedanken und Träume die aus einem herausquellen. Farblich und optisch finde ich es sehr gut umgesetzt.
Meinung:
Eine bewegende Biografie über die Sängerin, die mit Wir sind Helden …
Mehr
Cover:
Das Cover hat mich fasziniert. Es ergreift und irritiert zugleich. Es zeigt die Gedanken und Träume die aus einem herausquellen. Farblich und optisch finde ich es sehr gut umgesetzt.
Meinung:
Eine bewegende Biografie über die Sängerin, die mit Wir sind Helden durchstartete und versucht ihr Leben zurück zu bekommen. Kein einfacher Weg.
Inhaltlich möchte ich hier nicht zu viel verraten und halte mich daher mit weiteren Details dazu zurück.
Der Schreibstil ist angenehm und lässt sich gut und flüssig lesen. Man kommt schnell in die Gedanken, Emotionen und Erlebnisse der Autorin hinein. Gut hat mir hier auch die Gliederung und Unterteilung gefallen. Nich nur die Überschriften sind gut und passend gewählt, auch die Jahresangaben sind hilfreich zur Einordnung der Erlebnisse und Geschehnisse.
Eine bewegende Biografie mit einigen Höhen und Tiefen, die Einblicke in sehr private Szenarien gibt und dabei zart und authentisch rüberkommt. Man merkt, dass der frühe Erfolg mit Wir sind Helden, nicht nur Segen, sondern gleichzeitig auch Fluch wahr. Erleben mit, wie Zweifel entstehen, Veränderungen eintreten und man versucht sein Leben zu normalisieren, den kommerziellen Zwängen zu entkommen und einfach zu leben.
Ich konnte mich hier gut hinein finden und fand es sehr berührend und bewegend zu lesen. Man lernt die Autorin von einer sehr privaten Seite kennen und kommt dabei auch selbst zum Nachdenken und Überlegen.
Fazit:
Eine bewegende Biografie, die private Einblicke ermöglicht und selbst zum Nachdenken anregt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
In ihrer Autobiografie „Die Träume anderer Leute“ erzählt Judith Holofernes ungeschönt und ehrlich ihre Geschichte. Vom Erfolg mit „Wir sind Helden“ über ihre Indie-Müßiggang bis zur Solo-Künstlerin, ein steiniger Weg zum eigenen …
Mehr
In ihrer Autobiografie „Die Träume anderer Leute“ erzählt Judith Holofernes ungeschönt und ehrlich ihre Geschichte. Vom Erfolg mit „Wir sind Helden“ über ihre Indie-Müßiggang bis zur Solo-Künstlerin, ein steiniger Weg zum eigenen Ich.
„Dabei hatte ich, noch bevor unser Sohn geboren wurde, alles bis ins Kleinste geplant, angetrieben vom zwanghaften Drang, so schnell wie möglich wieder an die Arbeit zu gehen. Ich würde funktionieren. Aber wie! Kinder hin oder her, ich würde das tüchtige fleißige Mädchen sein, an dem ich so lange gearbeitet hatte. Eine, die gelobt wird, die unkompliziert ist, keine Allüren hat.“
2017, sechs Jahre nach dem Ende von „Wir sind Helden“ gewährt Judith Holofernes Einblicke in ihre Gedankenwelt, lässt „Wir sind Helden“ kurz in Rückblicken und Abschied aufleben und zeigt auf, welche Probleme ihr der Neustart danach bereitet hat. Sie öffnet auf 406 Seiten ihre Gedankenwelt für den Leser, erzählt von Selbstzweifeln, den Widrigkeiten des Musikgeschäfts, Erfolgsdruck, Krankheiten, Familie und vielem mehr. Im Vordergrund steht ihre Liebe zur Musik und der Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit als Künstlerin. „Heute, da ich diese Zeilen schreibe, habe ich ein sehr viel freundlicheres Verhältnis zu meinem Körper. Ich bin inzwischen überzeugt, dass die einzige Rettung darin liegt, zu möglichst großer emotionaler Freiheit zu kommen. Immer weniger Panzer zu brauchen gegen die Bescheuertheit der Welt. Darum kümmere ich mich, und das soll genügen.“ Das Tourleben mit Familie forderte seinen Tribut und das Bandglück eine schwere Entscheidung. Wie sollte es danach weitergehen? Die Künstlerin musste sich neu erfinden, und die Familie sich auf neue Art zusammenraufen. Dem Herzen folgen, war die Devise. Ein handgemachtes Indie-Album und eine Tour später, fühlte sich vieles richtig und manches doch wieder falsch an. Auch wenn sie sich als Musikerin bestätigt und Zuhause fühlte, war sie noch nicht bei sich angekommen. Immer wieder mussten die Dinge durchdacht werden, und dann spielte der Körper nicht mehr mit. Alarmzeichen, die nicht gleich richtig gedeutet wurden. Eine Leidenszeit und dann das entscheidende Licht am Ende des Tunnels. „Mit Sing meinen Song –Das Tauschkonzert“ und der Reise nach Südafrika kehrt an einem besonderen Ort das Glück zurück. Mehr und mehr zeigt sich eine andere Art von Weg, die der Kunst mehr Zeit einräumt. Der Epilog gibt Einblicke ins Heute und hat weise Ratschläge parat.
Das Cover ist kreativ und untermalt den Titel auf künstlerische Weise. Die Autobiografie „Die Träume anderer Leute“ ist anders als erwartet und gewährt viel Nähe zum Menschen Judith Holofernes und zur vielseitigen, Grenzen überwindenden Künstlerin, die sie im Herzen immer sein wollte. Sie ist Musikerin, Autorin, Podcasterin und hat sich nach vielen Widrigkeiten selbst gefunden.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
"Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück (J. Holofernes)
Als Judith Holofernes zusammen mit ihrer Band "Wir sind Helden" die Textzeilen " Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück" in die Welt der Pop-Songs hinaus schmettert, ahnt sie nicht, dass …
Mehr
"Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück (J. Holofernes)
Als Judith Holofernes zusammen mit ihrer Band "Wir sind Helden" die Textzeilen " Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück" in die Welt der Pop-Songs hinaus schmettert, ahnt sie nicht, dass es genau diese Worte sind, die sie zum Umdenken bewegen.
Der große Erfolg der "Helden" ist bahnbrechend und die teilweise rotzig-frechen Songtexte sind einfach anders. Auch sie erzählen Geschichten, denen man zuhören muss, um sie zu verstehen. Wer sich die Mühe macht, einmal hinter den Melodien die Menschen zu sehen, die für die Musik verantwortlich sind, der kann unglaublich viel von ihrem Innersten entdecken.
Doch als es mit den "Helden" vorbei ist, beginnt für Judith Holofernes das, was sich ein Hamsterrad nennt. Sie rennt und rennt, dreht und dreht immer weiter, stößt neue Soloprojekte an und folgt dabei Vorgaben, die andere aus ihrem Umfeld machen. Dabei vergisst sie wirklich sich selbst und verliert sich aus den Augen. Ihr Leben fühlt sich für sie selbst fremd und ferngesteuert an.
Die Folge davon ist, dass sie 10 Jahre und einige bittere und dunkle Erfahrungen braucht, um endgültig die Reißleine zu ziehen, um endlich die Judith zu werden, die sie sein möchte.
Es sind schmerzhafte Erinnerungen, die im Rückblick zwar immer noch weh tun, aber manchmal muss man über Scherben gehen und sich blutige Füße holen, bevor der Rückweg aus der Krise bis hin zur Verwirklichung eines Traumes möglich ist.
Holofernes nimmt kein Blatt vor den Mund, ist ehrlich zu sich selbst, zeigt unglaublich intime Einblicke in ihre Gefühl-, Gedanken- und Familienwelt und tritt den Beweis an, dass Erfolg eben nicht unbedingt glücklich macht, sondern immer den schmalen Grat zwischen Fluch und Segen beschreitet.
Ein Buch der leisen Töne, stummen Schreie und ganz viel Licht, das ein lang geträumtes Märchen wahr werden lässt. Hier erzählt eine einfühlsame Judith Holofernes von ganz persönlichen Wunden, Narben und Erkenntnissen, die so wahrscheinlich niemand hinter der witzig-schrägen Fassade der früheren "Heldin" vermutet hätte.
Absolut empfehlenswert !
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für