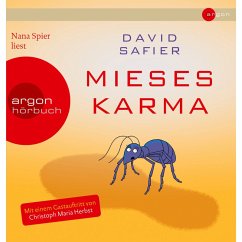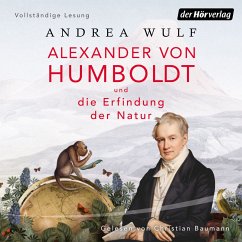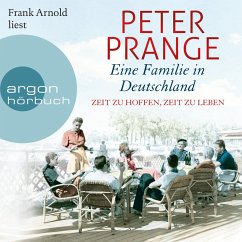Daniel Kehlmann
Hörbuch-Download MP3
Die Vermessung der Welt (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 519 Min.
Sprecher: Noethen, Ulrich

PAYBACK Punkte
7 °P sammeln!





Gegen Ende des 18. Jahrhunderts machen sich zwei junge Deutsche an die Vermessung der Welt. Der eine, Alexander von Humboldt, kämpft sich durch Urwald und Steppe, befährt den Orinoko, kostet Gifte, zählt Kopfläuse, kriecht in Erdlöcher, besteigt Vulkane und begegnet Seeungeheuern und Menschenfressern. Der andere, der Mathematiker und Astronom Carl Friedrich Gauß, der sein Leben nicht ohne Frauen verbringen kann und doch in der Hochzeitsnacht aus dem Bett springt, um eine Formel zu notieren - er beweist auch im heimischen Göttingen, dass der Raum sich krümmt. Alt, berühmt und ein wenig...
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts machen sich zwei junge Deutsche an die Vermessung der Welt. Der eine, Alexander von Humboldt, kämpft sich durch Urwald und Steppe, befährt den Orinoko, kostet Gifte, zählt Kopfläuse, kriecht in Erdlöcher, besteigt Vulkane und begegnet Seeungeheuern und Menschenfressern. Der andere, der Mathematiker und Astronom Carl Friedrich Gauß, der sein Leben nicht ohne Frauen verbringen kann und doch in der Hochzeitsnacht aus dem Bett springt, um eine Formel zu notieren - er beweist auch im heimischen Göttingen, dass der Raum sich krümmt. Alt, berühmt und ein wenig sonderbar geworden, treffen sich die beiden 1828 in Berlin.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Daniel Kehlmann, 1975 in München geboren, wurde für sein Werk unter anderem mit dem Candide-Preis, dem Per-Olov-Enquist-Preis, dem Kleist-Preis, dem Thomas-Mann-Preis und dem Friedrich-Hölderlin-Preis ausgezeichnet. Sein Roman Die Vermessung der Weltist eines der erfolgreichsten deutschen Bücher des 21. Jahrhunderts, auch der Roman Tyllstand monatelang auf den Bestsellerlisten und gelangte auf die Shortlist des International Booker Prize. Lichtspiel machte international Furore, v. a. in den USA. Daniel Kehlmann lebt in Berlin und New York.

Produktdetails
- Verlag: argon
- Gesamtlaufzeit: 519 Min.
- Erscheinungstermin: 22. Juni 2017
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783732415588
- Artikelnr.: 48471712
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Hubert Spiegel ist von diesem Roman so "subtil, intelligent und witzig" unterhalten worden, wie er es mit deutschsprachiger Literatur nur selten erlebt hat. Doch das ist seinen begeisterten Ausführungen zufolge nur einer der vielen lobenswerten Punkte an Daniel Kehlmanns Roman über die Brüder Humboldt und den Mathematiker Friedrich Gauß. Kehlmann gehe zum Beispiel der Frage nach, wann das glanzvolle Projekt der Aufklärung in die "Entzauberung der Welt" umgeschlagen sei. Das Schöne an Kehlmanns Ansatz ist für den Rezensenten, dass er sich als Leser "mit einem Lächeln" auf diese Frage gestoßen sieht. Neben hoher Kunstfertigkeit bescheinigt Spiegel dem Autor außerdem ein humoristisches Talent. Zudem beeindruckt ihn, wie elegant Kehlmann dem Nicht-Naturwissenschaftler die mathematische Fragestellung von Gauss verständlich zu machen versteht, wie er seine Figuren zeichne und die Dialoge führe. Nur eines vermisst der Rezensent, und zwar das "Ungebärdige" großer Kunst, was immer das auch heißen mag.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Ein großes Buch, ein genialer Streich. Frankfurter Rundschau
Broschiertes Buch
Kehlmann schaffte den Leser zu fesseln, mit seinem
Buch, welches knapp 300 Seiten stark ist.
Es ist zwar kurz, enthält aber dennoch die Arbeiten von
Humboldt und Gauß, die unsere Welt verändert haben. Weiterhin erfährt man Hintergründe, wie wer sie geprägt hat,
vor …
Mehr
Kehlmann schaffte den Leser zu fesseln, mit seinem
Buch, welches knapp 300 Seiten stark ist.
Es ist zwar kurz, enthält aber dennoch die Arbeiten von
Humboldt und Gauß, die unsere Welt verändert haben. Weiterhin erfährt man Hintergründe, wie wer sie geprägt hat,
vor wem sie Respekt hatten, wer ihre Begleiter waren, wie sie zu einander standen und wie ihre familäre Situation aus sah.<br />Dies erzählt Kehlmann auf spannende Weise, vor einem historischen
Hintergrund. Dadurch das die Geschichte abwechselnd erzählt wird, bekommt der Leser einen guten Einblick in das Leben der beiden bedeutenden Männer.
Das Buch von Daniel Kehrmann hat mir persönlich gut gefallen.
Kehlmann verwendet in dem gesamten Buch nur indriekt Rede,
auch wird die ganze Geschichte aus der Perspektive eines Erzählers
erzählt, was mir persönlich gefällt. Alles in allem finde ich das Buch gut und würde es weiter empfehlen.
Zum Schluss ein, wie ich finde, passendes Zitat:
"Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Zukunft nicht getsalten!"
Weniger
Antworten 6 von 6 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 6 von 6 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Die Vermessung der Welt habe ich mir eigentlich nur auf Empfehlung meines ehemaligen Deutschlehrers gekauft um eben aktuelle Literatur zu genießen. Als ich dann erfahren habe, dass es um den Mathematiker Gauss geht (dessen Rechenwege ich in der Schule verflucht habe) und um einen Forscher …
Mehr
Die Vermessung der Welt habe ich mir eigentlich nur auf Empfehlung meines ehemaligen Deutschlehrers gekauft um eben aktuelle Literatur zu genießen. Als ich dann erfahren habe, dass es um den Mathematiker Gauss geht (dessen Rechenwege ich in der Schule verflucht habe) und um einen Forscher namens Humboldt, war ich irgendwie nicht mehr so interessiert... Allerdings habe ich es dann aus Neugier angefangen zu lesen und dann auch nicht mehr aus der Hand legen können! Schon in den ersten Seiten schafft Kehlmann es einen zu fesseln, indem er Gauss, das Genie, als menschlichen Versager outet und zwar in überspitzt sarkastischer Darstellung, dass man jetzt nicht weiß, ob diese Tatsache zum lachen oder zum weinen ist. Die Schwächen von Genies wie Humboldt und Gauss werden gnadenlos aufgedeckt und bilden einen schönen Kontrast zu ausbreitenden Entdeckungen und Erkenntnissen, die man teilweise sowieso nicht verstehen kann, weil das Fachwissen nicht genug ausgebildet ist.
Also ich habe mich beim Lesen köstlich amüsiert und kann diesen Roman nur weiterempfehlen. Allerdings sollte man eine Schwäche für Ironie und Sarkasmus haben und Kehlmanns Aussagen nicht allzu Ernst nehmen, sondern sollte ihnen mit Humor entgegensehen können. Ich persönlich finde, dass die Figuren, also die Darstellung zweier bedeutender Aufklärer der Wissenschaft gar nicht so bedeutend ist, sondern der Schwerpunkt eher auf ihr Verhalten, die sprachliche Umsetzung Kehlmanns und die Botschaft des Romans, also primär das Altern zu legen ist.
Weniger
Antworten 10 von 14 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 10 von 14 finden diese Rezension hilfreich
Daniel Kehlmanns Bestseller "Die Vermessung der Welt" ist eine fiktive Doppelbiografie über die wissenschaftlichen Größen Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauß. Die beiden eigentlich grundverschiedenen Männer verbindet die Neugier, die Welt zu entdecken …
Mehr
Daniel Kehlmanns Bestseller "Die Vermessung der Welt" ist eine fiktive Doppelbiografie über die wissenschaftlichen Größen Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauß. Die beiden eigentlich grundverschiedenen Männer verbindet die Neugier, die Welt zu entdecken und zu verstehen und Grenzen zu überschreiten. Aber sie gehen sehr unterschiedliche Wege: Während der Universalgelehrte Humboldt in die Steppe, den Dschungel und die Berge auszieht, um die Welt zu vermessen, zieht es der geniale Mathematiker Gauß vor, zu Hause zu bleiben, um sie zu berechnen. Kehlmann setzt den Werdegang der beiden Protagonisten in vielen Episoden aus ihrem Leben hervorragend in Szene und zeichnet ein sehr humorvolles Bild der doch etwas verschrobenen Wissenschaftler. Sein stets ironischer Ton und auch der Stil der indirekten Rede haben mir sehr gut gefallen. Nur die Zusammenführung der beiden Lebensläufe – Gauß und Humboldt treffen im Alter aufeinander – ist leider nicht so gut geglückt. Für mich sind die Kapitel, in denen dieses Treffen beschrieben wird, die schwächsten des Buches. Trotzdem ist "Die Vermessung der Welt" ein herausragender Roman, der zu Recht zu den Verkaufsschlagern der letzten zehn Jahre zählt.
Weniger
Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Indirekt direkt ins Schwarze - Nachdem Kehlmann mit seinem Werk „Ich und Kaminski“ schon auf sich aufmerksam gemacht hatte, schaffte er den totalen Durchbruch mit seinem Werk „Die Vermessung der Welt“. Nachdem Mattias Gerwald mit seinem Werk „Der Entdecker“ den …
Mehr
Indirekt direkt ins Schwarze - Nachdem Kehlmann mit seinem Werk „Ich und Kaminski“ schon auf sich aufmerksam gemacht hatte, schaffte er den totalen Durchbruch mit seinem Werk „Die Vermessung der Welt“. Nachdem Mattias Gerwald mit seinem Werk „Der Entdecker“ den Durchbruch nicht gelang, schaffte es Kehlmann auf eine andere Art und Weise das Werk zu einem der größten Romane zu machen, die seit der Jahrhundertwende erschienen sind. Er bringt auf zwei verschiedene Ebenen, die eine physisch, die andere räumlich, zwei der berühmtesten Theoretiker namens Gauß und Humboldt zueinander. Nach anfänglichem zögern, aufgrund der nicht gerade anziehenden Wahl des Titels, aus dem man zunächst schließen würde, dass dieses Buch auf langweiligen, trockenen Formeln bzw. Stoff basieren würde, merkt man doch relativ schnell, dass dieses so nicht ist. Kehlmann bringt dieses Erforschen von Formeln, aber auch von Hügeln, Flüssen, Vulkanen etc., auf einer sehr lustige und interessante Weise herüber, sodass man immer mehr gefallen an dem Buch bekommt.
Gauß wird als eine mürrische, launische und nicht nach sozialen Kontakten suchende Person dargestellt. Er sucht nicht die Abenteuer und schon gar nicht legt er Wert sich auf Kongressen zu zeigen. Seine Umwelt ist ihm relativ egal auch erkennbar an der Verabscheuung seinem Sohn Eugen gegenüber. Am liebsten genießt er seine Ruhe an seinem Schreibtisch. Während Gauß lieber zu Hause sitzt und verschiedene Formeln aus dem Ärmel zaubert, zieht Humboldt durch die ganze Welt. Er ist also genau das Gegenstück zu Gauß, Humboldt sucht die Gefahr und das Abenteuer und versucht Erfahrungen am eigenen Leibe auszuprobieren. Natürlich tätigt er diese Reisen nicht alleine, sondern er hat einen treuen Diener, Bonpland.<br />Zu diesem ist aber Humboldt auch immer recht angebunden. Beide haben einen zwanghaften Drang zum Faktischen und die Ablehnung zum Fiktiven. So unterschiedlich beide doch sind, haben sie gewisse Ähnlichkeiten. Beide sind sozialunfähig. Haben kaum Kontakt zu Menschen, sie besitzen keine Innerlichkeit, sondern bleiben an der Außenfläche. Diese Verknüpfung der beiden Personen, bringt eine besondere Würze in den Roman.
Gauß stammt aus einer armen Gegend und hat sich alleine nach oben gearbeitet. Er ist ein Rationalist und Pessimist. Er hält und will nichts von den Menschen wissen. Gauß hat kaum menschliche Bindungen, was sich auch in seinem Umgang mit dem Sohn widerspiegelt. Sein Sohn ist genau das Gegenteil. Eugen hat soziale Kompetenz und sucht als Beispiel Amerika aus politischen Gründen und nicht aus Entdeckungsgründen auf. Er will so gesehen die Welt von innen Erleben. Gauß hat nur Zahlen im Kopf. Er lebt nur für sich, ist aber kein Egoist, er sucht halt einfach nur das Denken, im Gegensatz zu Humboldt theoretisch orientiert. Humboldt meistert jede Hürde die ihm in den Weg kommt, sei es ein fast sinkendes Schiff oder die Erforschung von tiefen Vulkanen. Er kann nicht an einem Hügel vorbeigehen, ohne dass er ihn näher erforscht hat. Humboldt ist praktisch orientiert.
Das Buch wurde zum meistverkauften Roman 2006 erklärt und meiner Meinung nach auch zu Recht. Obwohl ich anfangs dachte, dass das Buch eher trocken und uninteressant wäre, wurde ich vom Gegenteil überzeugt. Die sehr beispielhaften, interessanten Erklärungen in dem Buch vermitteln einem auf gute Art und Weise die Themen des Buches.
Ich würde jedem, der Interesse an Mathe und Naturwissenschaften hat, empfehlen, dieses Buch einmal zu lesen und es wäre besonders für Jugendlich mal eine Abwechslung zum typischen „Jugendroman“.
Weniger
Antworten 5 von 7 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 5 von 7 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Dieses Buch beschreibt höchst unterhaltsam das Leben zweier Deutscher gegen Ende des 18. Jahrhunderts, die beide auf ihre Art ein Stück Geschichte geschrieben haben. Alexander von Humbold der Entdecker und Erforscher neuer Welten vermisst die Welt einerseits und andererseits Carl Friedrich …
Mehr
Dieses Buch beschreibt höchst unterhaltsam das Leben zweier Deutscher gegen Ende des 18. Jahrhunderts, die beide auf ihre Art ein Stück Geschichte geschrieben haben. Alexander von Humbold der Entdecker und Erforscher neuer Welten vermisst die Welt einerseits und andererseits Carl Friedrich Gauß, der Wunderknabe und geniale Mathematiker. Beide werden sehr menschlich sowohl mit ihren Wünschen und Träumen als auch mit ihren Schwächen dargestellt. Man fiebert mit dem Weltreisenden, der bis an das Ende seiner Kräfte geht genauso mit wie mit dem Genie, das einfach nicht so langsam denken kann wie sein Lehrer.<br />Mir hat das Buch vor allem wegen seiner lebendigen Charakterisierung der handelnden Personen gefallen. Besonders faszinierend fand ich die Person Carl Friedrich Gauß. Auszüge und Beschreibungen seines Lebens haben mich beim Lesen immer ganz besonders erfreut. Die pragmatische Herangehensweise an die alltäglichen Dinge des Lebes, die extreme Unlust Reisen anzutreten und andere Sorgen eines Genies sind äußerst amüsant beschrieben.
Weniger
Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Daniel Kehlmanns Bestseller "Die Vermessung der Welt" ist eine fiktive Doppelbiografie über die wissenschaftlichen Größen Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauß. Die beiden eigentlich grundverschiedenen Männer verbindet die Neugier, die Welt zu entdecken …
Mehr
Daniel Kehlmanns Bestseller "Die Vermessung der Welt" ist eine fiktive Doppelbiografie über die wissenschaftlichen Größen Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauß. Die beiden eigentlich grundverschiedenen Männer verbindet die Neugier, die Welt zu entdecken und zu verstehen und Grenzen zu überschreiten. Aber sie gehen sehr unterschiedliche Wege: Während der Universalgelehrte Humboldt in die Steppe, den Dschungel und die Berge auszieht, um die Welt zu vermessen, zieht es der geniale Mathematiker Gauß vor, zu Hause zu bleiben, um sie zu berechnen. Kehlmann setzt den Werdegang der beiden Protagonisten in vielen Episoden aus ihrem Leben hervorragend in Szene und zeichnet ein sehr humorvolles Bild der doch etwas verschrobenen Wissenschaftler. Sein stets ironischer Ton und auch der Stil der indirekten Rede haben mir sehr gut gefallen. Nur die Zusammenführung der beiden Lebensläufe – Gauß und Humboldt treffen im Alter aufeinander – ist leider nicht so gut geglückt. Für mich sind die Kapitel, in denen dieses Treffen beschrieben wird, die schwächsten des Buches. Trotzdem ist "Die Vermessung der Welt" ein herausragender Roman, der zu Recht zu den Verkaufsschlagern der letzten zehn Jahre zählt.
Weniger
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Deutschland 1928: Carl Friedrich Gauß (1777–1855), der „Fürsten der Mathematik“, soll nach Berlin zur 17. Tagung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte reisen und dort Alexander von Humboldt (1769–1859) besuchen.
Eingebettet in diese …
Mehr
Deutschland 1928: Carl Friedrich Gauß (1777–1855), der „Fürsten der Mathematik“, soll nach Berlin zur 17. Tagung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte reisen und dort Alexander von Humboldt (1769–1859) besuchen.
Eingebettet in diese Rahmenhandlung wird die Karriere der beiden Wissenschaftler von der Kindheit bis zu ihrem Karrierehöhepunkt in sich abwechselnden Kapiteln erzählt, dabei handelt es sich jedoch um fiktive Biografien der beiden Wissenschaftler, die sich zwar an Fakten orientieren, deren erzählte Handlungen so wohl nicht passiert sind.
Der Erzählstil ist bissig ironisch. Das wird noch dadurch übersteigert, dass die komplette Geschichte wie ein wissenschaftlicher Bericht in indirekter Rede verfasst ist, vordergründig also Sachlichkeit vorgibt in Wirklichkeit aber sehr treffend über wissenschaftliche Archetypen und ihre Verschrobenheit und Dünkel, wie sie auch heute noch an den Universitäten existieren, herzieht.
In diesem Buch beschreibt der Autor aber auch, wie heutige Intellektuelle die Welt oft frustriert betrachten „In diesem Moment begriff er, dass niemand den Verstand benutzen wollte. Menschen wollten Ruhe. Sie wollten essen und schlafen, und sie wollten, dass man nett zu ihnen war. Denken wollten sie nicht.“ (S. 55)
Schwer zu sagen, was ich von dem Buch halte. Einerseits sind die beschriebenen Episoden jede für sich sehr witzig, ironisch und unterhaltsam. Professoren, die die Welt um sich herum vergessen, Weltfremd sind und mitten in der Hochzeitsnacht aufspringen um eine Formel zu notieren, ja diese Menschen gibt es noch zur Genüge, diese Karikatur ist sehr gelungen.
Als Roman jedoch hat das Buch so seine Probleme. Zum einen springt es einfach von der Rahmenhandlung in die beiden Nebenstränge der fiktiven Biographien, und dann wieder zurück. Das wirkt unfertig, der Bezug fehlt, so wie der Bezug zwischen den beiden Biographien fehlt. Das Buch macht den Eindruck als wäre es aus zwei kurzen Geschichten zusammengestellt worden: Humboldts ironische Biographie und Gauß ironische Biographie. Um diese beiden zusammenzuhalten wurde drum herum der Besuch von Gauß bei Humboldt drapiert, der diese beiden Geschichten wie ein Buchdeckel zusammenhält. Jede der drei Geschichten für sich ist sehr gut gelungen aber das Zusammenspiel lässt irgendwie ein wenig zu wünschen übrig.
Insgesamt jedoch wunderbare Unterhaltungen für Menschen, die täglich mit Menschen wie Gauß und Humboldt zu tun haben, ja viele Wissenschaftler sind wirklich so wie in diesem Buch beschrieben.
Weniger
Antworten 6 von 10 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 6 von 10 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch Es hat Spaß gemacht, das Leben von zwei bedeutenden Wissenschaftlern auf so eine humorvolle Weise zu lesen. Absolut zu empfehlen!!
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Ein sehr ausführliches Werk in welchem der Protagonist auf knapp 400 Seiten einen vollständigen Überblick des aktuellen Standes der modernen Wissenschaft abliefert.
Es wird in einer für Laien verständlichen Weise geschrieben, zwar nüchtern und sachlich, dabei ohne …
Mehr
Ein sehr ausführliches Werk in welchem der Protagonist auf knapp 400 Seiten einen vollständigen Überblick des aktuellen Standes der modernen Wissenschaft abliefert.
Es wird in einer für Laien verständlichen Weise geschrieben, zwar nüchtern und sachlich, dabei ohne größere Längen und nicht an Spannung verlierend.
Der Titel ist etwas irreführend, wissenschaftliche bzw. philosophische Erklärungsversuche nach dem Sinn und den Ursachen unserer Existenz respektive der Frage nach Gott kommen zu kurz.
Ob Kapitel über Krebs und Aids, Genetik, Kontinentalverschiebungen, Ozonschicht oder Wetterprognosen hier wirklich Sinn machen mag jeder Leser für sich selbst beantworten.
Ein Großteil des Buches widmet sich dann aber doch der Astronomie bzw. Kosmologie.
Wer aber schon einige Werke kennt ( Hawking, Gribbin , Davies, o.ä.) wird hier nichts Neues finden.
Aber trotzdem im Ganzen ein umfassendes und empfehlenswertes Buch.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Ein moderner Klassiker
Dieser Welterfolg wird dieses Jahr 15. Und von meinem Nachttisch verschwindet ein Buch, das ich immer schon mal lesen wollte.
Kehlmann hat mit diesem Werk ein neues Genre geschaffen: Den ironisierenden historischen Roman. Im ganzen Text geht es nicht um eine historische …
Mehr
Ein moderner Klassiker
Dieser Welterfolg wird dieses Jahr 15. Und von meinem Nachttisch verschwindet ein Buch, das ich immer schon mal lesen wollte.
Kehlmann hat mit diesem Werk ein neues Genre geschaffen: Den ironisierenden historischen Roman. Im ganzen Text geht es nicht um eine historische Darstellung wie es gewesen sein könnte, der Autor schreibt auf Pointe und das gelingt.
Die beiden Wissenschaftler des 18. und 19. Jahrhundert werden komisch dargestellt, weil sie Dinge machen, die in ihrer Zeit unüblich sind. Während Humboldt mit Frauen nichts anfangen kann, kann Gauß ohne sie nicht leben. Die Biographen beider werden in Brennpunkten erleuchtet, wobei die durchaus witzige Südamerikareise Humboldts ausführlicher ist. Im Kontrast dazu wird gegen Ende des Buches auch noch von Humboldts Russlandreise erzählt, bei der unser Held keine Schritt mehr alleine machen darf und deswegen auf Messungen verzichten muss.
Rahmenhandlung ist ihr Treffen in Berlin, wobei der Autor hier Eugens erzwungene Ausreise nach Nordamerika erdichtet. Historisch ist aber die schlechte Beziehung zwischen Gauß und seinem Sohn Eugen. Natürlich 5 Sterne.
Lieblingszitat: Humboldt zitiert Goethe: „Oberhalb aller Berggipfel sei es still, in den Bäumen kein Wind zu fühlen, auch die Vögel seien ruhig, und bald werde man tot sein.“ (S.128)
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für