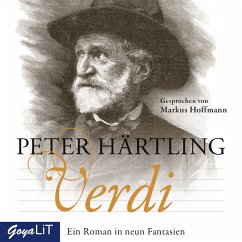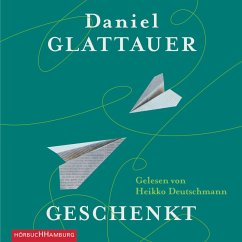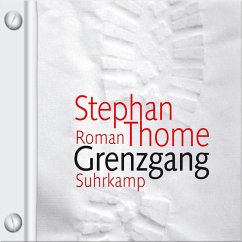Martin Walser
Hörbuch-Download MP3
Ein fliehendes Pferd (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 218 Min.
Sprecher: Walser, Martin

PAYBACK Punkte
6 °P sammeln!





Der Urlaub droht zum Desaster zu werden. Das unverhoffte Auftauchen eines ehemaligen Schulkollegen, eines dynamisch gebliebenen Buchautors und seiner Vorzeigefrau, bringt die Grundfesten einer einschlafenden Ehe zum Erzittern. Ein Zusammentreffen der beiden unterschiedlichen Paare wird zum tragisch-komischen Seelen-Striptease. Doch bei einer Segelpartie auf dem aufgewühlten Bodensee fallen alle Masken ... Martin Walser erschafft mit dem ängstlichen Halm, dem tollkühnen Buch, der attraktiven Hel und der unscheinbaren Sabine ein lebendiges Stimmkonzert. Virtuos gelingt es ihm, den Hörern den...
Der Urlaub droht zum Desaster zu werden. Das unverhoffte Auftauchen eines ehemaligen Schulkollegen, eines dynamisch gebliebenen Buchautors und seiner Vorzeigefrau, bringt die Grundfesten einer einschlafenden Ehe zum Erzittern. Ein Zusammentreffen der beiden unterschiedlichen Paare wird zum tragisch-komischen Seelen-Striptease. Doch bei einer Segelpartie auf dem aufgewühlten Bodensee fallen alle Masken ... Martin Walser erschafft mit dem ängstlichen Halm, dem tollkühnen Buch, der attraktiven Hel und der unscheinbaren Sabine ein lebendiges Stimmkonzert. Virtuos gelingt es ihm, den Hörern den Atem zu rauben. (Laufzeit: 3h 38)
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Martin Walser (1927–2023) wurde ab 1953 regelmäßig zu den Tagungen der Gruppe 47 eingeladen. Sein erster Roman »Ehen in Philippsburg« erschien mit großem Erfolg 1957. 1998 erhielt er den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels mit der Begründung, er sei ein Schriftsteller, der in seinem Werk »die deutschen Wirklichkeiten der zweiten Jahrhunderthälfte beschreibend, kommentierend und eingreifend begleitet hat.« Wichtige Werke (Auswahl): »Finks Krieg« (1996), »Ohne einander« (1993), »Die Verteidigung der Kindheit« (1991), darüber hinaus zahlreiche Bände mit Erzählungen, Aufsätzen, Essays, Gedichten und Stücken.Preise (Auswahl): Friedrich-Hölderlin-Preis (1996), Grazer Literaturpreis (1994), Ricarda-Huch-Preis (1990), Großes Bundesverdienstkreuz (1987).

© Philippe Matsas/Opale
Produktdetails
- Verlag: Der Hörverlag
- Gesamtlaufzeit: 218 Min.
- Erscheinungstermin: 8. August 2007
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783844503753
- Artikelnr.: 33587193
»Walser zeigt sich in diesem unterhaltsamen Klassiker als brillianter Differenzierungskünstler, als virtuoser Beobachter und sprachmächtiger Ironiker.« rbb kultur 20230904
Broschiertes Buch
Ein ehemaliger DDR- Klassiker - jetzt 2009 als Neuauflage. Ausserdem gibt es das Buch "Ein fliehendes Pferd" von Martin Walser selbst gelesen auch als Hörbuch (3 Cd´s) .
2007 wurde es bereits verfilmt (Katja Riemann als Sabine in der Hauptrolle - siehe neues Titelbild -) …
Mehr
Ein ehemaliger DDR- Klassiker - jetzt 2009 als Neuauflage. Ausserdem gibt es das Buch "Ein fliehendes Pferd" von Martin Walser selbst gelesen auch als Hörbuch (3 Cd´s) .
2007 wurde es bereits verfilmt (Katja Riemann als Sabine in der Hauptrolle - siehe neues Titelbild -)
Besonders beeindruckend und hervorzuheben ist diese bedeutungsvolle Szene:
Der unverhoffte Moment der Übereinkunft zwischen den Beiden, denn nur dieses einzige Mal bewundert Helmut seinen Jugendfreund Klaus ohne Vorbehalt: Von einer Wanderung zurückkehrend, stürmt ihnen ein Pferd entgegen. Der Bauer konnte es nicht zurückhalten. Doch als das Pferd schließlich am Wiesenrand stehenbleibt, nähert sich ihm Klaus von der Seite und springt auf, noch ehe es davongaloppiert ist. Klaus erklärt es mit den Worten:
"Einem fliehenden Pferd kannst du dich nicht in den Weg stellen. Es muß das Gefühl haben, sein Weg bleibt frei.
Und: ein fliehendes Pferd läßt nicht mit sich reden."
Weniger
Antworten 4 von 6 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 4 von 6 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Helmut und Klaus kennen sich aus ihrer Jugendzeit und treffen sich zufällig im Urlaub. Während Helmut die Lust am Leben und die Liebe an seiner Frau verloren hat, strotzt Klaus mit seiner jungen Frau nur so vor Lebensfreude. Als die beiden Ehepaare einen Ausflug auf einem Segelboot …
Mehr
Helmut und Klaus kennen sich aus ihrer Jugendzeit und treffen sich zufällig im Urlaub. Während Helmut die Lust am Leben und die Liebe an seiner Frau verloren hat, strotzt Klaus mit seiner jungen Frau nur so vor Lebensfreude. Als die beiden Ehepaare einen Ausflug auf einem Segelboot unternehmen, kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden.
"Ein fliehendes Pferd" ist ein schlecht geschriebenes Buch mit höchst gewagten pornografischen Stellen. Für mich besitzt dieses Buch keine Aussage und ich frage mich, warum ich diesen Roman in der Schule lesen musste.
Da der Inhalt und die Aussage des Buches für mich reiner Quatsch waren und sexuelle Szenen im Vordergrund standen gebe ich dem ganzen nur 1 Stern und bin der Meinung, dass so ein Buch nichts in der Schule zu suchen hat.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
unterhaltsame Tragödie zur Midlifekrise
Was machst du, wenn du in der Sauna bist und merkst, dass du deine Lektüre vergessen hast? Du gehst ans Regal und schaust, was da so steht. Und ich fand ein kleines Bändchen, für ohne Brille groß genug geschrieben und nicht …
Mehr
unterhaltsame Tragödie zur Midlifekrise
Was machst du, wenn du in der Sauna bist und merkst, dass du deine Lektüre vergessen hast? Du gehst ans Regal und schaust, was da so steht. Und ich fand ein kleines Bändchen, für ohne Brille groß genug geschrieben und nicht vergilbt, vom berühmten Martin Walser.
Nun lese ich also vom drögen Lehrer Helmut, der als „Bodenspecht“ verschrien ist, weil er den Mädels nicht auf die Rundungen schauen will, und seiner Frau Sabine, die in ihrem Urlaub am Bodensee – wo sonst? – den Journalisten Klaus Buch und seine Freundin Hel oder Helene treffen.
Helmut und Klaus sind alte Schulfreunde und Klaus erzählt gerne, wie sie gemeinsam gerubbelt haben und Helmut wegen zu langer Vorhaut sein Saft ins Gesicht gespritzt hat. Da bleibt Helmut nur die Möglichkeit zu scholzen und am lautesten über die Geschichte zu lachen.
Obwohl die Freundschaft nicht ungetrübt ist, verabreden sich die Pärchen zu einer Wanderung, bei der Helmut ein fliehendes Pferd zähmt und auch sonst den großen Zampano raushängen lässt.
Am nächsten Tag verabreden sich die Männer zu einem Segelturn. Es kommt Sturm auf und der seeerfahrene Klaus geht über Bord, der ängstliche Helmut wird dagegen mit dem Boot an Land gespült.
Die trauernde Witwe Hel erzählt darauf, dass Klaus immer nur den Großen gespielt hätte und in Wahrheit Tag und Nacht gearbeitet hätte und mit Helmut auf die Bahamas auswandern wollte. Die Novelle endet mit dem Abbruch des Urlaubs von Helmut und Sabine, die nun nach Südfrankreich fahren wollen.
Das Büchlein ist in zwei Tagen gut zu schaffen. Es bietet gute Unterhaltung, thematisiert die übertriebene Selbstdarstellung der Männer. Als Schullektüre würde ich es aber nicht lesen, da die Altherrenerotik keine Jugendliche vom Herd holen wird und auch die Frauenfiguren nicht mehr als Beiwerk sind. Das Ende hätte auch spannender sein können. Dennoch volle 4 Sterne.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Allegorie auf die Spaßgesellschaft
Zwei Jahre nach dem vernichtenden Verriss seines Romans «Jenseits der Liebe» durch Marcel Reich-Ranicki in der FAZ erschien 1978 Martin Walsers Novelle «Ein fliehendes Pferd» - und wurde vom selben Großkritiker im gleichen …
Mehr
Allegorie auf die Spaßgesellschaft
Zwei Jahre nach dem vernichtenden Verriss seines Romans «Jenseits der Liebe» durch Marcel Reich-Ranicki in der FAZ erschien 1978 Martin Walsers Novelle «Ein fliehendes Pferd» - und wurde vom selben Großkritiker im gleichen Blatt als «ein Glanzstück deutscher Prosa» überschwänglich gefeiert. Die in nur zwei Wochen niedergeschriebene Novelle erreichte als Bestseller eine Auflage von einer Million Exemplaren, sie stellte einen Wendepunkt seines literarischen Schaffens dar, die dem damals bereits etablierten Schriftsteller last, but not least, auch finanzielle Sicherheit brachte. Das Feuilleton beurteilte das Buch damals überwiegend positiv, ist die Lektüre dieses frühen Werkes aus dem inzwischen recht umfangreichen Œuvre Walsers also lohnenswert?
In dem kammerspielartigen Plot wird von zwei Ehepaaren mittleren Alters erzählt, die bei einem Urlaub am Bodensee (wo sonst?) zufällig aufeinander treffen, der Gymnasiallehrer Helmut Halm und der Journalist Klaus Buch waren einst Schulkameraden. Sie sind vom Naturell her völlig unterschiedlich, ihre Lebenswege verliefen folglich auch in ganz verschiedenen Bahnen. Während der eher behäbige, desillusionierte Helmut mit seiner ähnlich gearteten Frau Sabine unauffällig und zurückgezogen lebt, führt der sportlich gestählte, gesundheitsbewusste Klaus mit seiner deutlich jüngeren, attraktiven zweiten Frau Helene ein offensichtlich aufregendes, bewegtes Leben, jagt dem Erfolg und gesellschaftlicher Anerkennung hinterher. Sehr zum Missvergnügen von Helmut arrangiert Klaus nun eifrig verschiedene gemeinsame Unternehmungen, in deren Verlauf die Kluft zwischen dem verklemmten Spießbürgertum von Helmut und Sabine und der überbordenden Lebenslust von Klaus und Helene immer deutlicher wird.
Bei einer gemeinsamen Wanderung kommt es zu dem titelgebenden Ereignis mit Symbolkraft, als es Klaus durch richtiges Verhalten gelingt, ein auf sie zu galoppierendes, durchgehendes Pferd einzufangen. «Einem fliehenden Pferd kannst du dich nicht in den Weg stellen. Es muss das Gefühl haben, sein Weg bleibt frei.» Bei einem Segeltörn ohne die Frauen versucht Klaus später, seinen Freund zum gemeinsamen Auswandern auf die Bahamas zu überreden, um dort ein neues, aufregenderes Leben zu beginnen. Als überraschend ein schwerer Sturm aufzieht, geht der segelerfahrene Klaus über Bord, Helmut wird in dem nun steuerlosen Boot hilflos an Land getrieben, Klaus bleibt verschwunden. In ihrer Verzweiflung enthüllt Helene später in der Ferienwohnung von Helmut und Sabine die wahren Lebensumstände von Klaus, der in Wahrheit ein Versager war und sich gerade aus der Begegnung mit Helmut die Rettung aus all seiner Hoffnungslosigkeit versprochen hatte.
Walser stellt die Sicht Helmuts in den Mittelpunkt und gewährt dem Leser damit tiefe Einblicke in das Innenleben seines eher drögen Protagonisten. Ihren Reiz erhält die Geschichte aber insbesondere aus der Gegenüberstellung der konträren Lebensentwürfe, die ja beide keineswegs widerspruchsfrei sind, sondern nur Schein erzeugen, keine Realität. Der Autor zeigt also nur auf, was ist, ohne werten zu wollen, wobei es unsere Gesellschaft ist, die sich da widerspiegelt. Sprachlich ist die Novelle leicht lesbar geschrieben, nicht gerade wortgewaltig oder stilistisch kreativ also, aber mit stimmigen Dialogen, das stets überschaubare Geschehen wird zudem ganz unkompliziert chronologisch erzählt. Man muss das wohl als Abkehr des Autors von der anspruchsvolleren Literatur zur reinen Unterhaltung interpretieren, in der selbst gewisse Action-Momente nicht fehlen und Sex Walser-typisch ebenfalls eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Diese entlarvende, sozialkritische Allegorie auf eine erfolgsgeile Spaßgesellschaft ohne jeden tieferen Lebenssinn endet zwar ziemlich trivial, sie lässt dem Leser aber genügend Raum für eigene Reflexionen, für seine eigene Standortbestimmung irgendwo zwischen den beiden Extremen, die Martin Walser hier aufzeigt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für