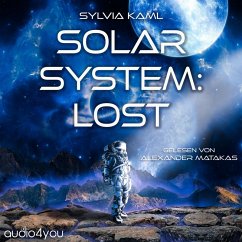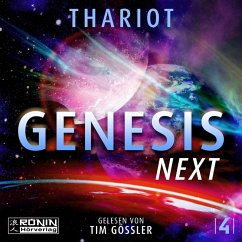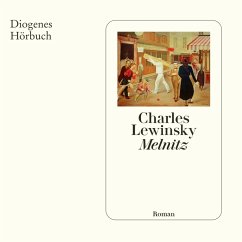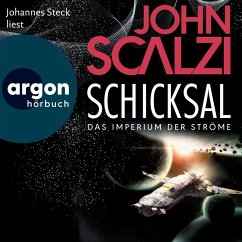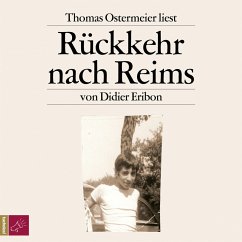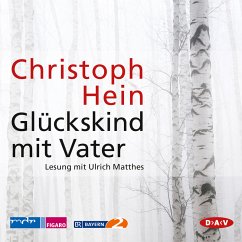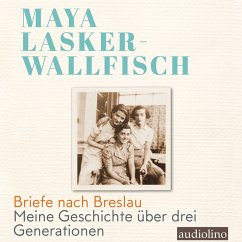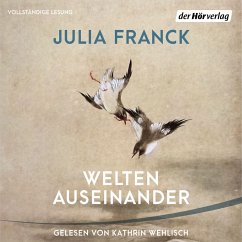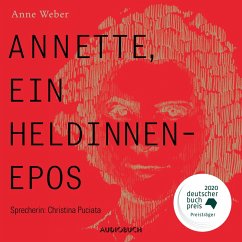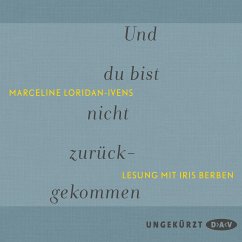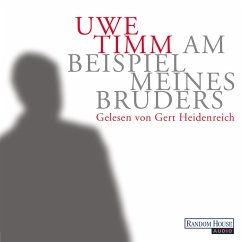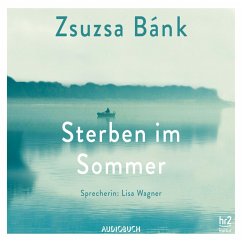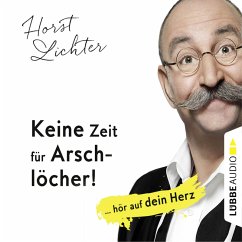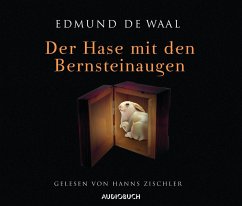Wohnung und zu seiner Mutter zu gelangen.
Die Mutter war nicht zum ersten Mal gestürzt und hatte es nicht mehr geschafft, dem Sohn die Tür zu öffnen. Und da es schon so oft geschehen war, wiesen die Feuerwehrleute Eribon darauf hin, dass sie für solche Fälle nicht zuständig seien und ihren Einsatz beim nächsten Mal in Rechnung stellen müssten. Eribon hatte dann noch erfahren, dass es für so einen Einsatz einen Namen - "Aufstehhilfe nach Sturz" - und einen Pauschalpreis gibt. Auf die Erwähnung dieser Tatsache folgte dann seine Versicherung, es gehe ihm weder um Ironie noch um Kritik, er bewundere die Einsatzbereitschaft und Effizienz der Feuerwehrleute.
Notwendig bleibt seine Bemerkung trotzdem, denn in dem Milieu der Pariser Großstadtintellektuellen, aus dem Eribon zu seiner Mutter in die Provinz gereist war, sind Ironie, Kritik und der von ihm nicht erwähnte Zynismus habituelle Verhaltensweisen im Umgang mit Menschen und Dingen, sie gehören gewissermaßen zum Zugangscode für diese Kreise. Und Eribon ist in Frankreich ein öffentlicher Intellektueller, der im Fernsehen auftritt und auch aus Homestorys über seine Freunde in Magazinen bekannt ist.
Auch hierzulande ist Eribon mit dem unverhofften Erfolg des 2016 auf Deutsch erschienenen Vorgängerbuchs "Rückkehr nach Reims" zum Bestsellerautor und zu einem Protagonisten dessen geworden, was man autofiktionales Schreiben nennt. Wie wenig dieser zum Etikett gewordene Begriff jedoch in der Lage ist, die Resultate von Eribons Schreibvorgang zu erfassen, lässt sich an "Eine Arbeiterin" immerhin zeigen. Immerhin deshalb, weil es einfach unangemessen scheint, der würdevollen Schönheit dieses Textes mit einem routinierten Lob auf den Leib zu rücken.
Was in dem Buch geschieht, ist eine permanente Transformation. Die persönliche Geschichte von Eribons Mutter wird in eine allgemeine, unpersönliche Form verwandelt, deren erstes Anliegen es ist, für Menschen zu sprechen, die durch das Alter bewegungs- und sprachlos geworden sind und dadurch ihre Rechte nicht mehr formulieren und beanspruchen können. Deshalb ist auch der Titel "Eine Arbeiterin" programmatisch. Das Buch handelt aber auch von Revisionen im besten Sinn, von Neueinstellungen des Blickes auf die gleichen Menschen und Dinge im Laufe der Zeit und unter veränderten Bedingungen.
Ging es in der "Rückkehr nach Reims" vor allem um die Scham, die einen begabten homosexuellen jungen Menschen über seine Herkunft aus der Arbeiterklasse bedrückt, wenn er den Weg in die Pariser Wissenschaftler- und Intellektuellenwelt geschafft hat, so ist beim Anblick der alten Mutter die Scham eine grundsätzliche geworden. Als Eribon zusammen mit seinen Brüdern der Mutter die Notwendigkeit des Umzugs in ein Seniorenheim für Menschen mit eingeschränkter Mobilität mit dem Satz "Du musst vernünftig sein, es geht nicht anders" klarzumachen versucht, fällt ihm auf, wie sehr er als junger Student diesen moralischen Stoizismus der Vernunft an René Descartes verachtete und bekämpft hatte. Sich vernünftig in die Verhältnisse zu fügen, sich, wie der Philosoph lehrt, den Wunsch, frei zu sein, zu verbieten, wenn man im Gefängnis sitzt, erschien dem jungen Eribon als Negation jedes politischen Denkens und Handelns. Jetzt aber hatte er seiner Mutter genau jenen Grundsatz Descartes' nahegebracht, wohl wissend, dass das Altersheim ihr Gefängnis sein würde.
Wie hier bettet der Soziologe Eribon die persönliche Situation der Mutter immer so unaufdringlich in allgemeine Lehren ein, dass man bestimmt eines nicht verliert: den Glauben an die aufklärerische Wirkung von Wissenschaft und Kunst. Wenn er zum Beispiel die Einschränkungen der Sozialkontakte, die der Umzug ins Wohnheim für die Mutter mit sich bringt, beschreibt und auf die schwere Arbeit der Altenpflegerinnen und deren schlechte Bezahlung aufmerksam macht, verweist er auf Erving Goffmans Begriff der "Territorien des Selbst" und Ken Loachs Film "Sorry We Missed You", in dem eine der Hauptfiguren als Altenpflegerin arbeitet.
Und als ihm klar wird, dass mit dem Tod der Mutter vor allem die genealogischen Kenntnisse über Generationen der eigenen Familie aus seinem Leben verschwinden werden, ist der Verweis auf Simone de Beauvoirs Buch "Das Alter" folgerichtig. Denn wer sonst als Beauvoir hätte darauf verweisen sollen, dass die Erinnerungsarbeit in den Familien die Arbeit der Frauen ist, und zwar nicht nur, weil sie in der Regel älter werden als die Männer.
Didier Eribon: "Eine Arbeiterin". Aus dem Französischen von Sonja Finck. Suhrkamp Verlag, 272 Seiten, 25 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
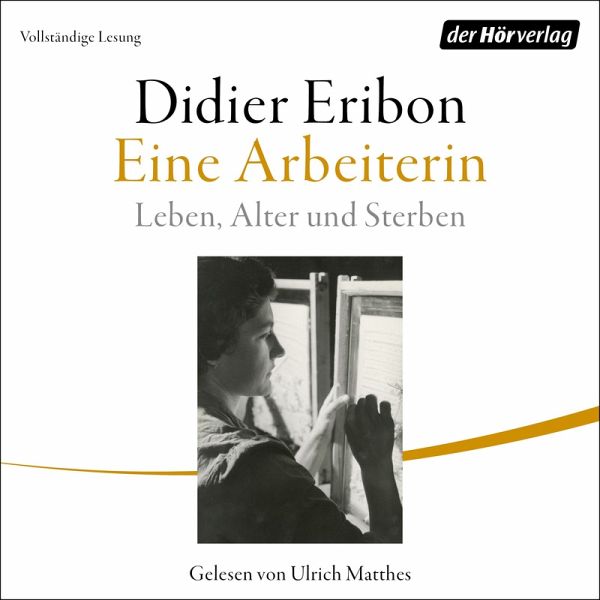





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.03.2024
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.03.2024