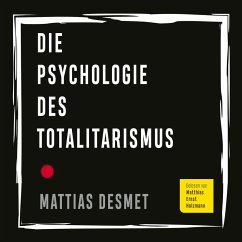Entstellt (MP3-Download)
Über Märchen, Behinderung und Teilhabe Gekürzte Lesung. 430 Min.
Sprecher: Blomeyer, Anna Amalie / Übersetzer: Haubold, Josefine
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
10,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
5 °P sammeln!
Die Märchen und Geschichten, die wir als Kinder erzählt bekommen, prägen unsere Wahrnehmung der Welt. Was aber passiert, wenn man sich eher mit dem Biest identifiziert als mit der Schönen? Wenn jede hässliche, entstellte, behinderte Märchenfigur als böse gilt, verhöhnt und bestraft wird – wie kann sich das Biest dann jemals ein Happy End erhoffen?
Amanda Leduc untersucht Märchen in Text und Film, von den Brüdern Grimm über Hans Christian Andersen bis zu Walt Disney und »Game of Thrones«. In den Geschichten erkennt man das Gute stets an seiner Schönheit und das Böse an se...
Die Märchen und Geschichten, die wir als Kinder erzählt bekommen, prägen unsere Wahrnehmung der Welt. Was aber passiert, wenn man sich eher mit dem Biest identifiziert als mit der Schönen? Wenn jede hässliche, entstellte, behinderte Märchenfigur als böse gilt, verhöhnt und bestraft wird – wie kann sich das Biest dann jemals ein Happy End erhoffen?
Amanda Leduc untersucht Märchen in Text und Film, von den Brüdern Grimm über Hans Christian Andersen bis zu Walt Disney und »Game of Thrones«. In den Geschichten erkennt man das Gute stets an seiner Schönheit und das Böse an seinem entstellten Körper. Behinderung dient als Metapher für Minderwertigkeit und Schlechtigkeit, als etwas, das es zu überwinden gilt, das dem Glück im Wege steht und bestenfalls Mitleid verdient. Stets ist es das Individuum, das sich verändern und anpassen muss, nicht die Gesellschaft. Diese Narrative, so zeigt Leduc, spiegeln sich in der gesellschaftlichen Wirklichkeit, in unserem Umgang mit Behinderung.
Mitreißend und voller Empathie verbindet sie eine kulturtheoretische Analyse der Figuren und Stoffe mit persönlichen Erfahrungen aus ihrem Leben mit Zerebralparese. Sie nimmt die Gesellschaft in die Pflicht und fordert Raum für neue Geschichten, die Behinderung sichtbar machen und als gleichwertige Lebensrealität anerkennen: »Was passiert mit der Geschichte, wenn wir einander die Hand reichen?«
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.