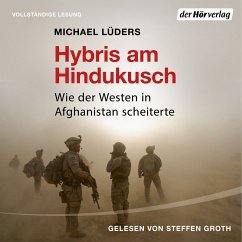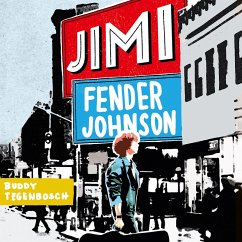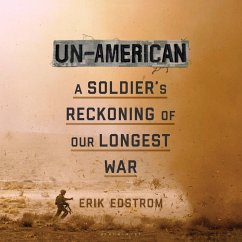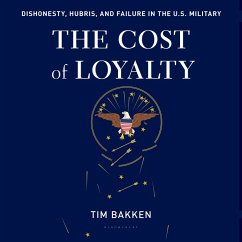Jonathan Safran Foer
Hörbuch-Download MP3
Extrem laut und unglaublich nah (MP3-Download)
Gekürzte Lesung. 451 Min.
Sprecher: Khuon, Alexander / Redaktion: Verlag, Argon

PAYBACK Punkte
4 °P sammeln!





Oskar ist neun, er ist Erfinder, Pazifist, Schmuckdesigner und Tamburinspieler - und er hat eine Menge Fragen, auf die er dringend eine Antwort braucht. Wieso gab es den Anschlag vom 11. September? Warum musste sein Vater eines der Opfer sein? Oskar läuft durch New York, immer auf der Suche nach Antworten und nach etwas, dass ihn von den vielen Gedanken in seinem Kopf ablenkt. Safran Foer raubt mit seinem Tempo, seiner Sprachgewalt und seinem halsbrecherischen Witz dem Hörer den Atem. Und er lässt einen verstehen, dass manchmal nur Phantasie hilft, den Irrsinn der Welt zu ertragen.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Jonathan Safran Foer gehört zu den profiliertesten amerikanischen Autoren der Gegenwart. Seine Romane 'Alles ist erleuchtet', 'Extrem laut und unglaublich nah' und 'Hier bin ich' wurden mehrfach ausgezeichnet und in 36 Sprachen übersetzt. Sein Sachbuch 'Tiere essen' war ebenfalls ein internationaler Bestseller. Foer lebt in Brooklyn, New York. Henning Ahrens, geb. 1964 in Peine. Aufgewachsen als Sohn eines Landwirts in Niedersachsen. Studium von Anglistik, mittlerer und neuerer Geschichte sowie Kunstgeschichte in Göttingen, London und Kiel; Abschluss mit einer Doktorarbeit über die lebensphilosophischen Schriften des englischen Schriftstellers John Cowper Powys. Nach insgesamt 13 Jahren in Kiel lebte er 12 Jahre auf dem niedersächsischen Land, in einem Dorf in der Nähe Braunschweigs, seit 2013 in Frankfurt/M. Er hat zwei Söhne. Übersetzungen (Auswahl) - Walter Kirn, Mr. Bingham sammelt Meilen [Up in the Air] (Kiepenheuer & Witsch 2003) - Jonathan Safran Foer, Extrem laut und unglaublich nah (Kiepenheuer & Witsch 2005) - Hugo Hamilton, Die redselige Insel (Luchterhand 2007) - Sarah Shun-Lien Bynum, Madeleine schläft (S. Fischer 2007) - Sarah Shun-Lien Bynum, Komplize. Erzählung. In: Neue Rundschau (2/2007) - Hanif Kureishi, Das sag ich dir (S. Fischer 2008) - Saul Bellow, Die Abenteuer des Augie March (Kiepenheuer & Witsch 2008) - Chris Killen, Das Vogelzimmer (Kiepenheuer & Witsch 2009) - John Griesamer, Herzschlag (Arche 2009) - Thomas Mann, Essays VI, 1945-1950 (S. Fischer 2009) (Übersetzung nur auf Englisch vorhandener Reden und Briefe) - Ellen Hopkins, Crank. Versroman (Carlsen 2010) - Adam Thirlwell, Flüchtig (S. Fischer 2010) - Adam Thirlwell, Samuel Fischer in der Zukunft. Erzählung. In: Neue Rundschau (3/2011) - Hanif Kureishi, Mein Ohr an deinem Herzen (S. Fischer 2011) - Helen Cross, Ohne mich (dtv 2011) - Trent Reedy, Inshallah: Worte im Sand (Aufbau 2011) - Katherine Rundell, Zu Hause redet das Gras (Carlsen 2012) - Margaret Wild & Ron Brooks, Der Traum des Tasmanischen Tigers (Bilderbuch, Carlsen 2012) - Nick Hayes, Die Ballade von Seemann und Albatros. Graphic Novel (marebuchverlag 2012) - Agatha Christie, Nikotin (Fischer Taschenbuch Verlag 2012) - Leigh Bardugo, Grischa: Goldene Flammen (Carlsen 2012) - Leigh Bardugo, Die Hexe von Duwa (Carlsen 2012) - Patrick McGuinness, Die Abschaffung des Zufalls (Zsolnay 2012) - Peter Dickinson, Abschied von Opa (Carlsen 2012) - Chris van Allsburg, Die Geheimnisse von Harris Burdick (Bilderbuch, Carlsen 2012) - Khaled Hosseini, Traumsammler (S. Fischer 2013) - Der beste Tag aller Zeiten. Weitgereiste Gedichte (mit anderen Übersetzern; Carlsen 2013) - Alexia Casale, Die Nacht gehört dem Drachen (Carlsen 2013) - Nicola Davies, Mein erstes großes Buch von der Natur (Aladin 2013) - George MacDonald, Der goldene Schlüssel (Aladin 2014) - Katja Eichinger, Amerikanisches Solo (Metrolit 2014) - Jonathan Safran Foer, Hier bin ich (Kiepenheuer & Witsch 2016) Werke und Literaturprojekte ¿ Lieblied was kommt. Gedichte (DVA 1998) ¿ Stoppelbrand. Gedichte (DVA 2000) ¿ Lauf Jäger Lauf. Roman (S. Fischer 2002) ¿ Langsamer Walzer. Roman (S. Fischer 2004) ¿ Tiertage. Roman (S. Fischer 2007) ¿ Kein Schlaf in Sicht. Gedichte (S. Fischer 2008) ¿ Provinzlexikon. (Knaus 2009) ¿ Der Eiserne König. Roman (Fischer Jugendbuch 2011; unter dem Pseudonym 'John Henry Eagle') ¿ Robin Hood: Der Überraschungsangriff. Jugendbuch (Fischer KJB 2013) ¿ Zorro: Der Rächer der Armen. Jugendbuch (Fischer KJB 2013) Auszeichnungen 1997 Wolfgang-Weyrauch-Förderpreis 2001 Friedrich-Hebbel-Preis 2002 Förderpreis des Landes Niedersachsen 2004 Jahresstipendium des Landes Niedersachsen 2009 Nicolas-Born-Preis

Produktdetails
- Verlag: argon
- Gesamtlaufzeit: 451 Min.
- Erscheinungstermin: 23. August 2012
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783732402793
- Artikelnr.: 42956986
"Jonathan Safran Foers zweiter Roman erfüllt all unsere Erwartungen. Er ist ehrgeizig, brillant, geheimnisvoll und vor allem in der Schilderung des verwaisten Oskar zutiefst bewegend. Eine ungewöhnliche Leistung." Salman Rushdie
"Jonathan Safran Foer ist eine ungewöhnliche neue Stimme - virtuos, visionär, naiv, urkomisch und herzzerreißend." The Village Voice
"Temperamentvoll, eindringlich und wunderbar unterhaltsam bringt Foer den Leser dazu, die Welt mit all ihrem Grauen und all ihren Möglichkeiten aus der Perspektive eines Kindes neu zu sehen." National Post
"Jonathan Safran Foer ist eine ungewöhnliche neue Stimme - virtuos, visionär, naiv, urkomisch und herzzerreißend." The Village Voice
"Temperamentvoll, eindringlich und wunderbar unterhaltsam bringt Foer den Leser dazu, die Welt mit all ihrem Grauen und all ihren Möglichkeiten aus der Perspektive eines Kindes neu zu sehen." National Post
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Anhänger der realistischen Literatur sollten den zweiten Roman von Jonathan Safran Foer lieber gleich wieder aus der Hand legen, meint Rezensent Georg Diez. Denn Foer beschwört in bekannter Manier nicht nur den Schrecken des 11. September, sondern den "der gesamten Welt", und präsentiert ihn in der Sprache eines kleinen Jungen. Dieser hat seinen Vater in den Trümmern des World Trade Centers verloren und kämpft nun gegen die "große Tragödie seines Lebens". Das Schicksal des Jungen vernetzt der Autor mit zahlreichen anderen Geschichten vom Suchen - das Hauptmotiv, wie der Rezensent herausfindet. In seiner "kindlichen" Lust am Sammeln von Begebenheiten und Eindrücken liege die Schönheit, aber auch "ein Teil der Probleme". Gelegentlich wirken die Menschen und Schicksale nämlich wie "ausgedachte Wesen". Dafür aber findet die Sprache Foers - von Übersetzer Henning Ahrens "flüssig" übertragen - die volle Zustimmung des Kritikers. Die "Lust an Dialogen" und die Freude an der "krummen" Sprache machen Foers neues Buch zu einer "brillanten" Erzählung, die "so sentimental ist, wie unsere Zeit es verlangt."
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Sein erster Roman war eine Sensation, der zweite ist noch besser. Ein nahezu beängstigend schönes, sentimentales und schlaues Buch...ebenso eingängig wie stimmig wie unvergeßlich.« Welt am Sonntag
Gebundenes Buch
Oscar Schell hat ein tiefes Trauma erlebt. Der hochintelligente, zu Beginn des Romans 9 Jahre alte, Junge hat seinen Vater am 11. September 2001 bei den Anschlägen auf das WTC verloren. Der Verlust lastet so schwer auf ihm, dass man zwischendurch Angst hat, er könnte vollkommen abrutschen …
Mehr
Oscar Schell hat ein tiefes Trauma erlebt. Der hochintelligente, zu Beginn des Romans 9 Jahre alte, Junge hat seinen Vater am 11. September 2001 bei den Anschlägen auf das WTC verloren. Der Verlust lastet so schwer auf ihm, dass man zwischendurch Angst hat, er könnte vollkommen abrutschen und wahnsinnig werden. Aber Oscar findet seine ganz eigenen Wege und seine ganz eigenen Menschen, die ihm helfen, den Verlust zu begreifen und zu verarbeiten.
Sein Weg beginnt mit dem Fund eines Schlüssels in den Sachen seines Vaters und seine Suche nach dem Schloss, das zu diesem Schlüssel passt führt ihn durch ganz New York und langsam aber sicher immer weiter zu sich selbst, zu seinem Vater und zu den Tragödien seiner Familie, die weit vor seiner Geburt ihren Anfang nahmen und sich dem Leser erst ganz Stück für Stück offenbaren.
Parallel zu Oscars Erzählung erfährt man mit Hilfe seiner deutschen Großeltern von deren Traumata, der Bombardierung Dresdens im 2. Weltkrieg und warum der Großvater vor 40 Jahren seine Frau und damit seinen ungeborenen Sohn und alles, was es für ihn noch an Familie gab, verlassen hat und langsam, ganz langsam schlüsselt sich auf, warum er seit fast 50 Jahren kein einziges Wort mehr gesprochen hat.
Ob Oscar am Ende die Antworten findet, die er sich vom Fund des Schlosses erhofft, oder ob er sie ganz woanders findet? Am Ende wird man klüger sein… oder auch nicht.<br />Jonathan Safran Foer hat hier ein ganz einzigartiges Werk geschaffen und mit dem Mut eines Wahnsinnigen eine Geschichte niedergeschrieben, die genau so ist, wie ihr Titel: Extrem laut und unglaublich nah! Der ein oder andere wird diese Geschichte als eine zu den leisen gehörenden beschreiben, aber ich finde, dass gerade in ihren leisen Tönen das Laute geradezu herausschreit.
Dieses Buch ist für Menschen, die das Ungewöhnliche lieben, die abseits vom Mainstream ihr Leseglück in Romanen suchen, die einfach anders sind. Die bereit sind ganz tief in die Geschichte und die Psyche von Menschen abzutauchen. Dieses Buch ist ein Juwel und ich würde mich wünschen, mehr Autoren würden sich trauen, so zu schreiben.
Weniger
Antworten 9 von 9 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 9 von 9 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
in dem buch geht es um oskar der zusammen mit seiner mutter und seinem kater, buckminster in einer new yorker wohnung lebt. oskar's vater starb beim anschlag auf das worls trade center am 11. september. seit dem ist es seine "raisons d'être" auf die menschen die er liebt aufzupassen. …
Mehr
in dem buch geht es um oskar der zusammen mit seiner mutter und seinem kater, buckminster in einer new yorker wohnung lebt. oskar's vater starb beim anschlag auf das worls trade center am 11. september. seit dem ist es seine "raisons d'être" auf die menschen die er liebt aufzupassen. oskar ist kein gewöhnlicher 9jähriger wie man schon nach wenigen seiten merkt. er ist auf eine liebenswürdige art und weise anders. zum beispiel die ausergewühnlich phantasievollen erfindungen die er quasi rund um die uhr hat. der junge hat es nicht leicht; er versucht allen anforderungen gerecht zu werden, er möchte seine mutter glücklich machen und seine großmutter und hat dabei keine zeit selber richtig über seinen schweren verlust zu kommen. so vegetiert er vor sich hin bis er eines tages einen geheimnissvollen schlüssel in einem mit dem wort:BLACK beschrifteten umschlag findet. verzweifelt wie er ist hält oskar dies für ien zeichen seines vaters und so macht er sich, gemeinsam mit seinem alten nachbarn und neunen bekannten Abe Black, auf den ominösen BLACK zu finden.
Die Metaphorik dieser Suche ist offensichtlich, vielleicht zu offensichtlich: Das Schloss als Erklärung für den sinnlosen Tod des Vaters. Der Schlüssel als Schlüssel zum Geheimnis von Leben und Tod. Es überrascht kaum, dass Oskar das passende Schloss am Ende zwar findet, aber das Rätsel der menschlichen Existenz nicht lösen kann. Schlauer als zuvor ist er natürlich trotzdem. Schließlich wissen wir alle, dass die Suche das eigentlich Ziel ist.<br />das buch hat mir sehr gefallen. es war schön zu lesen; es gab einige fotos oder andere bilder die das lesen sehr interessant machen. oskar wächst einem sehr ans herz und oft wünscht man sich einfach ins buch eingreifen zu könne zB wenn oskar sich wiedereinmal einen blauen fleck verpasst, und ihn in den arm zu nehmen.
ich empfehle das buch an alle die, die nichts über den 11.september aber etwas über die hinterbliebenen wissen möchte.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Keine brav herunter geschriebene Prosa
Dies ist zweifellos der gelungene Roman eines kreativen jungen Autors, über den an vielen Stellen schon viel Kluges geschrieben steht. So viel, dass einem begeisterten Leser wie mir eigentlich nur übrig bliebe, ein paar bissige Kommentare zu den …
Mehr
Keine brav herunter geschriebene Prosa
Dies ist zweifellos der gelungene Roman eines kreativen jungen Autors, über den an vielen Stellen schon viel Kluges geschrieben steht. So viel, dass einem begeisterten Leser wie mir eigentlich nur übrig bliebe, ein paar bissige Kommentare zu den auffallend wenigen negativen Rezensionen zu schreiben, das Meiste ist schon gesagt. Es wird dabei aber häufig der Fehler gemacht, einen solchen Roman nach Gesetzen der Logik zu analysieren, wo es hier doch eindeutig um Irrationales geht, das wird einem ja schon nach wenigen Sätzen klar. Ein neunjähriger Protagonist ist zwar nicht völlig neu, und wenn der dann, wie die Figur bei Grass, auch noch Oskar heißt, ist doch eindeutig eine ganz andere, eine besondere Perspektive gegeben, da muss halt auch der Rezensent mal über seinen Schatten springen.
Denn genau diese Sicht eines neunmalklugen Jungen macht das Buch zu einer äußerst vergnüglichen Lektüre, ich hab mich lange nicht mehr so gut amüsiert, so oft laut aufgelacht. Der Autor brennt ein Feuerwerk an skurrilen Einfällen ab, und äußerst witzige Wortspiele, aber auch die ganz subtilen Beziehungen zwischen den teils urkomischen Gestalten lassen einen immer wieder schmunzeln. Besonders berührend fand ich die Odyssee zu den verschiedenen ‚Blacks’, wie schön könnte das Leben sein, geht es einem da durch den Kopf, wenn wir uns alle so ungezwungen geben, so freundlich aufeinander zugehen würden wie diese vielen Namensträger, die Oskar da unverdrossen aufgesucht hat.
Und all das spielt vor todernstem Hintergrund, 9/11 insbesondere, aber auch Dresden und Hiroshima, ohne dass es jemals unangemessen wirkt. Es muss erlaubt sein, die Welt eben auch mal aus einer herzerfrischend anderen Perspektive zu sehen, selbst wenn es so makaber wird wie im Daumenkino am Schluss des Buches, bei dem einem das Lachen im Halse stecken bleibt. Diesen extremen, ungewöhnlichen Spagat zwischen Tragödie und Komödie hat Jonathan Safran Foer in einer fulminanten Sprache und mit ausgefallenen typografischen Verzierungen versehen grandios bewältigt. Endlich mal keine brav herunter geschriebene Prosa, die allen Konventionen folgt, sondern ein unbekümmert anderer Stil, der die Literatur bereichert und damit ganz besonders auch denjenigen, der sich darauf einzulassen vermag als Leser. Er wird fürstlich belohnt!
Weniger
Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Oskar, ein neunjähriger Junge aus New York ist aufgeweckt,neugierig und klein. Und eigentlich auch zufrieden und glücklich.Sein Vater und er sind ganz besonders: sie forschen und Oskars Vater stellt Oskar oft Rätsel. Doch eines Tages, am 11.September , stirbt sein Vater bei den …
Mehr
Oskar, ein neunjähriger Junge aus New York ist aufgeweckt,neugierig und klein. Und eigentlich auch zufrieden und glücklich.Sein Vater und er sind ganz besonders: sie forschen und Oskars Vater stellt Oskar oft Rätsel. Doch eines Tages, am 11.September , stirbt sein Vater bei den Terroranschlägen auf das World Trade Center.
Niemand konnte sich verabschieden.
Während sich seine Mutter immer mehr zurückzieht und verschließt, sucht eer einen Weg mit Verlust seines geliebten Vaters umzugehen. Oskar glaubt nur das, was er auch sieht. Auf seiner Suche nach Dingen von seinem Vater findet er einen Schlüssel im Schrank seine Vaters. Er muss dieses letzte Rätsel lösen und den Grund für den Tod seines Vaters finden.
Auf der unendlcih scheinenden Suche nach dem passendem Schloss, erlebt Oskar viele Dinge.
Ein großes Abenteuer durch ganz New York.
Wird er das Geheimnis lüften? Was ist das Geheimnis? Und wohin führt ihn der Schlüssel?<br />Mir gefällt dieses Buch sehr. Es ist sehr spannend und trauriges Buch, was mit vielen Mitteln gestaltet wird.(Bilder des Anschlags,..)
Das Buch ist sehr anspreche jeder kennt die Bilder des 11.Septembers und kann sich vorstelwie schrecklich es ist jemanden dabei verloren zu haben. Durch den Schreibstil kann sich der Leser hervorragend in Oskar hineinversetzen. Die Spannung ist groß.Ich empfehle dieses Buch ab einem Alter von ca 15 Jahren, da es ,auch wenn es spannend geschrieben ist, oft etwas schwer zu lesen ist. Trotzdem fesselt die Geschichte den Leser.
Ein tolles Buch!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Der US-amerikanische Erfolgsautor Jonathan Safran Foer zeigt in diesem Werk weder Scheu vor großen Themen noch vor literarischen Zitaten großer Romane.
Sein Protagonist Oskar Schell erinnert nicht nur durch die für Amerika unübliche Schreibweise an seinen Namensvetter Oskar …
Mehr
Der US-amerikanische Erfolgsautor Jonathan Safran Foer zeigt in diesem Werk weder Scheu vor großen Themen noch vor literarischen Zitaten großer Romane.
Sein Protagonist Oskar Schell erinnert nicht nur durch die für Amerika unübliche Schreibweise an seinen Namensvetter Oskar Mazerath aus Günter Grass´ Blechtrommel. Beide Jungs kommen recht altklug daher und haben ein bisweilen nervtötendes Musikinstrument auf ihren Streifzügen dabei, bei Matzerath ist es die titelgebende Blechtrommel, Foer bedient sich eines Tambourins. Oskar Schell ist durch den Tod seines Vaters traumatisiert, der beim Anschlag auf die New Yorker Twin Towers ums Leben kam. Zu seinen Lebzeiten stellte der Vater Oskar gerne verzwickte Rätselaufgaben, und nun meint er in seinen Hinterlassenschaften ein letztes gefunden zu haben. Auf der Suche nach Lösung begibt er sich auf eine wundersame Wanderung durch New York, er glaubt eine Person Namens Black kann ihm helfen, nur gibt es davon leider Tausende. Seine Begegnungen mit unterschiedlichsten Charakteren erinnern mich an Paul Austers New-York-Trilogie, auch dort spielt der Familienname Black eine gewichtige Rolle und auch Austers Figuren sind stets Suchende.
Jedoch nehme ich Auster seine erdachten Personen ab, bei Foer tue ich mich hier oft schwer. Fast bin ich geneigt, manches als Traumsequenz der blühenden Fantasie des Jungen zu lesen, aber so ist es nicht geschrieben.
Ein weiterer Kritikpunkt gilt den verschiedenen Erzählebenen. Denn Foer belässt es nicht dabei, die Geschichte des traumatisierten Oskars auszuführen. Nein, es muss noch mehr Drama her, und das kommt in Form von Oskars Großvater, der die Luftangriffe auf Dresden während des Zweiten Weltkriegs miterleben musste und dadurch seelisch so verletzt wurde, dass er nach und nach verstummte. Seine Ehe basiert auf skurrilen Verboten und Reglements, zuoberst dem des Nicht-Darüber-Sprechen-Könnens. Und auch damit nicht genug, nein, Foer zaubert aus seiner Autoren-Pandora-Büchse auch noch schnell den Atombombenabwurf über Hiroshima. Ehrlich gesagt weiß ich nicht wieso. Ja, Hiroshima, Dresden und New York haben Gemeinsamkeiten, in all diesen Städten mussten durch zuvor unvorstellbare, brutale, von Menschen verursachte Gewaltakte große Teile der Bevölkerung sterben und viele der Überlebenden wurden stark traumatisiert. Aber mir fehlt die historische Einordnung, ich finde es nicht in Ordnung, diese drei geschichtlichen Ereignisse ohne großen Kommentar nebeneinander zu stellen.
Die für ein Paperback ungewöhnlich gute Ausstattung mit zahlreichen, teils sogar farbigen Abbildungen hätte eine positive Erwähnung verdient - wäre da nicht am Ende das unsägliche Daumenkino eines vom brennenden World Trade Center stürzenden Menschen. Man kann die letzten Seiten des Buches zwischen den Fingern schnell vor- und zurückblättern und so die Person wahlweise in den Tod stürzen oder wieder nach oben in die Luft fliegen lassen. Das mag man als progressiv und experimentell bezeichnen, ich finde es pietätlos den Opfern der Terroranschläge gegenüber und potenziell verletzend für deren Angehörige.
Ich kann diesen Roman daher nur bedingt empfehlen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Dieses buch kann man nicht mit simplen Worten beschreiben, denn ist eine Art an sich. Es ist ungewöhnlich und mit nichts anderem zu vergleichen.
Es ist traurig, witzig, intilligent, außergewöhnlich, einzigartig und wunderschön. man muss sich an den außergewöhnlichen …
Mehr
Dieses buch kann man nicht mit simplen Worten beschreiben, denn ist eine Art an sich. Es ist ungewöhnlich und mit nichts anderem zu vergleichen.
Es ist traurig, witzig, intilligent, außergewöhnlich, einzigartig und wunderschön. man muss sich an den außergewöhnlichen anderen stil gewöhnen und ihn akzeptieren, aber wenn man das hat, kommt man in den genuß eines wirklich aufregenden und unvergesslichen buches, es ist einzigartig und wirklich wunderschön traurig.
Weniger
Antworten 5 von 10 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 5 von 10 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch War ja skeptisch, aber ich muss sagen, dass das Buch echt gut ist.
Ein wenig verwirrend am Anfang, aber man kommt schnell rein und
es fesselt. Kann das Buch schlecht weg legen... :-)
Antworten 1 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für