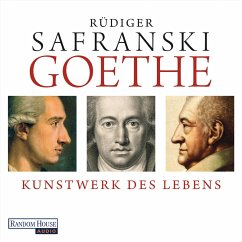Ein neuer Blick auf Leben und Werk des letzten Universalgenies. Das Goethe-Hörbuch für unsere Zeit: Rüdiger Safranski führt uns Goethe in neuem Licht vor und macht uns zu Zeitgenossen dieses Genies und Menschen, dessen Lebensspanne das verspielte Rokoko, die klassisch-romantische Zeit und die Nüchternheit des Eisenbahnzeitalters umgreift. Mit seinem Namen hat man später eine ganze Epoche bezeichnet: die Goethezeit.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Hinreißend... Es ist Rüdiger Safranski gelungen, den Leser wieder ganz verliebt in Goethe zu machen. Ijoma Mangold Die Zeit

Rüdiger Safranskis Biographie ist beeindruckend. Aber er verkennt Goethes hellsichtige Visionen über eine Moderne jenseits des Kapitalismus
Von Sahra Wagenknecht
Wer in einer Zeit, in der die deutsche Sprache in Twitternachrichten verkümmert und das Denken sich oft genug diesem Stil angepasst hat, einer Zeit, in der "Faust II" in den meisten Gymnasien nur noch am Rande Erwähnung findet und viele Theater den Weimarer Klassiker ganz aus ihrem Spielplan gestrichen haben - wer in einer solchen Zeit mit einem Buch über Goethe an die Spitze der Bestsellerlisten stürmt, muss schon etwas Außergewöhnliches vorgelegt haben.
Außergewöhnlich ist Safranskis "Goethe" gleich in mehrfacher Hinsicht. Zum einen lässt das Buch das Leben des großen Dichters äußerst lebendig und anschaulich Revue passieren, akribisch recherchiert und genau geschildert anhand von Goethes eigenen Briefen und Tagebuchnotizen sowie den Zeugnissen von Zeitgenossen - Neidern wie Verehrern, Freunden wie Feinden. Safranski erzählt Hunderte kleine Episoden und verfolgt doch eine große Linie. Und diese über 700 Seiten belegte große Linie ist das Aufregende an diesem Buch.
Bereits der Titel stellt klar, worauf Safranski hinauswill: "Goethe. Kunstwerk des Lebens". Es geht ihm nicht einfach um die Lebensumstände eines Mannes, dem wir die wahrscheinlich schönsten Verse verdanken, die je in deutscher Sprache gedichtet wurden, sondern es geht um einen "Meister des Lebens", um ein "Beispiel für ein gelungenes Leben", um einen, der es als seine Lebensaufgabe begriffen hat, der zu werden, der er war.
Goethes Leben, so die Kernthese, ist selbst ein "Werk", und zwar eines, das sich hinter Goethes literarischen Werken nicht verstecken muss. Mit dieser Sichtweise stellt sich Safranski souverän gegen einige tausend Buch- und Zeitschriftenseiten, die seit Goethes Tod mit Meinungsäußerungen gegenteiligen Inhalts über Goethes Leben und Charakter bedruckt wurden. Vielleicht liegt es daran, dass Beispiele echter menschlicher Größe in unserer Zeit in Literatur, Wirtschaft wie Politik so rar geworden sind, weshalb wir dazu neigen, unzweifelhafte Größe in früheren Jahrhunderten mit Skepsis zu betrachten. Wer seine Umwelt allzu weit überragt, wird schnell verdächtigt, auf irgendeinem geheimen Sockel zu stehen, und nicht wenige fühlen sich berufen, ihn oder sie von diesem vermeintlichen Podest herunterzuzerren.
Trümmer des Lebens
Auch an Goethe wurde viel gezerrt. Da seine Literatur schwer anzugreifen war, arbeitete man sich bevorzugt am Menschen Goethe ab. Er erschien wahlweise als kleinkarierter Pedant oder als vom Leben verwöhnter Egoist, als Antidemokrat und politischer Opportunist, der nicht davor zurückschreckte, alte Freunde zu verraten, in neueren Versionen gern auch als selbstsüchtiger Macho, der seine Frauen schlecht behandelt hat. Im gutwilligen Fall laufen solche Erzählungen auf die Plattitüde hinaus, dass Goethe, trotz seiner literarischen Meisterleistungen, eben auch "nur ein Mensch" gewesen sei.
Safranski stellt dieser Kleinmacherei die sympathische These entgegen, dass Goethes Größe nicht zuletzt darin besteht, dass er es tatsächlich geschafft hat, ein Mensch zu sein und als solcher zu leben: selbstbestimmt, souverän, in Würde. Er war ein Mensch, gerade weil er ein Leben lang darum gerungen hat, sich zu dem zu machen, der er war. Das war harte Arbeit und keineswegs selbstverständlich.
Das Buch zeigt, wie Goethe sich mindestens zwei Mal in seinem Leben fast verloren hatte: in seinen frühen Jahren, als das junge Genie seine Fähigkeit entdeckte, mit spielerischer Leichtigkeit wunderbare Verse zu Papier zu bringen, als er der bestaunte Mittelpunkt jeder Geselligkeit war, auch bereits als Erfolgsautor galt, aber die reale Welt noch kaum an sich herangelassen hatte. Goethe wird später über die "demütige Selbstgefälligkeit" jener Jahre sprechen. Wäre er diesen Weg weitergegangen, wäre er vielleicht ein besserer Lenz geworden und heute vermutlich so vergessen wie dieser. Und zum zweiten Mal in den Jahren vor seiner Flucht nach Italien, als Goethe sich in zahllosen Ämtern am Weimarer Hof zerrieb und zwischen Rekrutenaushebungen und Konflikten in der Wegebaukommission vergeblich versuchte, die Iphigenie zum Reden zu bringen. Zu dieser Zeit musste er sein schriftstellerisches Lebenswerk als Trümmerberg von Fragmenten wahrnehmen, an deren Abschluss unter den gegebenen Bedingungen nicht zu denken war. Goethe hat in beiden Fällen, wie auch in allen anderen, die ihn aus der Bahn - seiner Lebensbahn - zu werfen drohten, wieder zu sich zurückgefunden.
Safranski bügelt nicht glatt. Er schönt nicht. Worum er sich bemüht, sollte das Anliegen jedes ehrlichen Biographen sein: ein gerechtes Bild von Goethes Leben zu zeichnen und es aus sich heraus zu verstehen, statt dem Dichter, mit der Brille des 20. oder 21. Jahrhunderts auf der Nase, rechthaberisch Kopfnoten zu erteilen. Dieses Bemühen um historische Gerechtigkeit durchzieht das Buch wohltuend übrigens auch bei der Charakterisierung anderer wichtiger Personen in Goethes Umfeld, etwa der des Herzogs Karl-August.
Aber bei Goethe selbst geht es um mehr als um Gerechtigkeit. Klassische Literatur, ja alle klassische Kunst ist, wie Peter Hacks es einmal ausgedrückt hat, Anthropodizee: Sie ist ein Hohelied auf den freien, vernunftgeleiteten, souveränen, leidenschaftlichen, liebenden, würdevollen Menschen. Auf diesem Niveau bewegt sich allerdings auch ihr Anspruch an den Menschen. Dass ein Schriftsteller, der sich im Hinblick auf sein eigenes Leben unsouverän und würdelos verhält, als Autor die Kraft zu klassischer Größe aufbringt, ist zumindest unwahrscheinlich. Goethe hat an sich und sein Leben einfach die gleichen hohen Ansprüche gestellt, die seine Werke gegenüber jedem Menschen erheben. Der Zusammenhang liegt auf der Hand, aber endlich spricht es einmal jemand aus.
Natürlich ist die klassische Anthropodizee nicht mit der weltfremden Annahme zu verwechseln, alle Menschen seien edel, hilfreich und gut. Es geht um grundsätzliche Weltbejahung und Lebensliebe. Es geht darum, trotz aller Bestialität und aller Verbrechen, deren Menschen sich im Laufe der Geschichte fähig gezeigt, und trotz der Erniedrigung, die sie allzu bereitwillig erduldet haben, trotz der ungezählten Beispiele von Kleinheit und Niedertracht im menschlichen Miteinander nicht der Versuchung einer zynisch-pessimistischen Weltsicht zu erliegen.
In Goethes Werk steht Mephisto für diesen rein negativen und damit letztlich anti-humanen Skeptizismus. Während Faust nach Wissen, Selbstbestätigung, Lebensgenuss und Kreativität hungert, will Mephisto ihn "mit Lust . . . Staub fressen" lassen. Mephisto hat seine Hände im Spiel, als die klassische Kunstwelt am Ende des Helena-Aktes an der Gegenwart zerschellt. Er leistet regen Beistand, als der Unternehmer Faust gegenüber seinen Arbeitern zum Menschenschinder wird ("Menschenopfer mussten bluten"). Er dirigiert die "drei gewaltigen Gesellen" Habebald, Haltefest und Eilebeute, deren Raubzügen Faust seinen Weltbesitz verdankt. Und Mephisto ist es auch, der Faust schließlich zum Verbrecher macht, indem er seinen maßlosen Expansionsdrang, dem die menschliche Idylle von Philemon und Baucis im Wege steht, mit mörderischer Konsequenz vollstreckt. Dass am Ende trotz allem nicht Mephisto triumphiert, sondern Fausts Seele gerettet wird - da ist es eben wieder, das Urvertrauen des Klassikers Goethe in den Menschen und eine menschliche Zukunft.
Hier allerdings sind wir an einem Punkt, an dem Safranskis Erzählung zu glatt wirkt. Das Goethesche Urvertrauen war Produkt eines lebenslangen Ringens und alles andere als unerschütterbar. Safranski erwähnt, dass Goethe das beginnende Maschinenzeitalter mit Argwohn betrachtet habe und die Industriereligion, nach der sich alles im Hinblick auf seinen ökonomischen Nutzen zu bewähren hat, ablehnte. Der Biograph führt an, dass Goethe die Beschleunigung aller Lebensumstände als "veloziferisch" (aus velocitas und Luzifer) empfand und sich daher in seiner Zeit zunehmend unwohl fühlte. Safranski zitiert den schönen Satz aus Goethes Plotin-Kritik, dass "das belebende und ordnende Prinzip in der Erscheinung dergestalt bedrängt, dass es sich kaum zu retten weiß", und interpretiert das wie folgt: "Die Bedrängnis am gesellschaftlichen Ort ist die durch Neid, Konkurrenz, Missbilligung, Gleichgültigkeit, hektische Betriebsamkeit und . . . durch Gerede verursachte." Meines Erachtens steckte mehr hinter Goethes Leiden an seiner Gegenwart.
Die Maschinen als solche störten Goethe keineswegs. Es gibt nicht wenige Äußerungen, in denen er sich von den neuen Technologien, der Dampfkraft und dem in Aussicht stehenden Eisenbahnbau, geradezu fasziniert zeigt. Das verwundert nicht. Armut ist die elementarste Entwürdigung, die einem Menschen angetan werden kann. Wer sich dem klassischen Humanismus verpflichtet fühlt, kann Technologien, die die Produktivität und damit den Reichtum der Gesellschaft um ein Vielfaches zu steigern versprechen, schwer ablehnen. Dass Goethe Armut als ernste Infragestellung des klassischen Humanitätsgedankens empfand, zeigt sein bekannter Brief an Charlotte von Stein: "Hier will das Drama gar nicht fort, es ist verflucht, der König von Tauris soll reden als wenn kein Strumpfwirker in Apolde hungerte."
Was Goethes Unbehagen verursachte, waren nicht die Telegraphen und nicht die Dampfmaschine. Es war die sich ankündigende Diktatur der Märkte und des Profits, die der Dichter als existentielle Bedrohung empfand. Wenn Marx über die kapitalistische Ordnung schreibt, sie habe "kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übrig gelassen als das nackte Interesse, die gefühllose ,bare Zahlung' . . . Sie hat die persönliche Würde in den Tauschwert aufgelöst und an die Stelle der zahllosen verbrieften und wohlerworbenen Freiheiten die eine gewissenlose Handelsfreiheit gesetzt", trifft er ziemlich genau den Grund, aus dem Goethe mit seiner Epoche haderte.
Goethe hat die drohende Zerstörung von Kultur, Zivilisation und Humanität in einer durchkommerzialisierten Gesellschaft bereits lange vor Marx mit verblüffender Klarheit vorhergesehen. Ihm graute vor Verhältnissen, in denen sich alles rechnen muss. Eine gesellschaftliche Ordnung, die die wertvollsten Eigenschaften des Menschen - Liebesfähigkeit, Sehnsucht nach menschlichen Bindungen, nach Harmonie und Schönheit - verkümmern lässt und seine schlechtesten - Habsucht, Egoismus, soziale Ignoranz - gnadenlos kultiviert, musste Goethe als Affront gegen den Kerngedanken seiner Literatur empfinden. Der Homo oeconomicus, der Mensch als von niederen Instinkten angetriebener roboterhafter Nutzenoptimierer, ist die fundamentalste Infragestellung des klassischen Menschenbildes, die sich denken lässt.
Wo nur noch ökonomische Effizienz und erzielbare Rendite entscheiden, hat der Mensch seine Souveränität aufgegeben. Er ist jetzt da, wohin Mephisto ihn haben wollte, er frisst Staub und lässt sich einreden, er hätte ein Festmahl vor sich. Der ordoliberale Denker Alexander Rüstow wird später von der antiaufklärerischen "Wirtschaftstheologie" des Laissez-faire-Liberalismus sprechen: Eine Gesellschaft, die sich von den Märkten und den Interessen der Wirtschaftsmächtigen regieren lässt, hat sich vom Anspruch der Aufklärung auf vernunftgeleitete Gestaltung verabschiedet.
Goethe traute dem Kapitalismus wohl auch nicht zu, dass er die Armut beseitigen würde. Immerhin war das damalige England ein lebendiges Beispiel dafür, dass zu den Folgen der industriellen Revolution nicht nur ein bis dahin ungekannter Reichtum gehörte, sondern auch ein geschichtlich beispielloses Ausmaß an Verarmung und Entwurzelung. Wenn Hegel in seiner Rechtsphilosophie ernüchtert feststellt, "dass bei dem Übermaße des Reichtums die bürgerliche Gesellschaft nicht reich genug ist, . . . dem Übermaße der Armut . . . zu steuern", wenn er über im Rahmen dieser Ordnung unvermeidliche Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrisen spricht, dann wird dieser Zusammengang auch Goethe nicht entgangen sein. Hegel plädiert daher vehement für eine "mit Bewusstsein vorgenommene Regulierung" von Gewerbe und Handel, vor allem aber der "großen Industriezweige".
Das waren die großen Fragen, über die Goethe vor allem in den letzten Jahrzehnten seines Lebens nachdachte. Wahrscheinlich waren sie auch der Grund, weshalb er 1826 begann, regelmäßig die saint-simonistische Zeitung "Le Globe" zu lesen. Wenn Safranski über Goethe schreibt "Er war für freien Grundbesitz, ohne feudale Privilegien, und für die Freiheit des Gewerbes. Darauf beschränkten sich seine politisch-gesellschaftlichen Wünsche und Vorstellungen", scheint mir das etwas zu schlicht zu sein. Wenn Goethe die unter demokratischem Label firmierende patriotische Bewegung seiner Zeit ebenso ablehnte wie gestärkte Parlamentsrechte gegenüber den Fürsten, etwa durch ein Steuerbewilligungsrecht der Landstände, heißt das nicht, dass er ein Antidemokrat war. Vielleicht war es eher so, dass er ein reales Mehr an Demokratie, also eine bessere Repräsentanz der Interessen der Bevölkerungsmehrheit, in solchen Bewegungen und Reformen beim besten Willen nicht erkennen konnte.
Wes Geistes Kind die deutschnationalen "Befreiungskrieger" waren, zeigte sich spätestens 1817, als sie ihre Feierlichkeiten zum Jahrestag des Sieges über Napoleon auf der Wartburg mit der ersten Bücherverbrennung der deutschen Geschichte krönten. Dass Goethe, der die französische Kultur liebte und nationalistische Borniertheit verachtete, sich von solchen Literaturbanausen mit Grausen abwandte, sollte nachvollziehbar sein.
Auch mit den "demokratischen Einrichtungen" im politischen System sah es nicht gut aus. Selbst in Frankreich hatte sich die Republik als nicht überlebensfähig erwiesen. Aus dem Zustand äußerster politischer Instabilität gab es zur Jahrhundertwende realistisch nur zwei Auswege: die monarchistische Restauration - oder Napoleons Kaiserreich, das immerhin die wichtigsten politischen Errungenschaften der Revolution verteidigte. In dem in unzählige Fürstentümer zerstückelten Deutschland, wo im Jahr 1800 gut 75 Prozent der Bevölkerung weder lesen noch schreiben konnten, war eine republikanische Staatsform schon gar nicht denkbar. Das Steuerbewilligungsrecht der Landstände bedeutete keine Einschränkung des Absolutismus durch die Demokratie, sondern durch die wirtschaftlich Starken, also durch Großgrundbesitzer, Fabrikanten und Banker. Dass das die Lebensverhältnisse der Bevölkerungsmehrheit eher zu verschlechtern drohte, hatte Goethe aus der englischen Geschichte gelernt.
Im Grunde kreiste Goethes wie auch Hegels politisches Denken um ein Problem, das - nach einem Jahrhundert des bornierten Laissez-faire-Liberalismus - die ökonomische Schule des Ordoliberalismus wieder aufgegriffen und ins Zentrum ihrer Gesellschaftstheorie gestellt hat: das Problem der Verhinderung wirtschaftlicher Macht. Die Korruption, Bestechlichkeit und Käuflichkeit der Politik im englischen Parlament war für Hegel ein publizistisches Dauerthema. Goethes und Hegels politischer Lösungsvorschlag für dieses Problem war aus der damaligen Zeit geboren und kann heute nicht mehr überzeugen. Aber man sollte ihnen nicht Demokratiefeindlichkeit unterstellen, weil sie bereits hundertfünfzig Jahre vor dem Ordoliberalismus "das Problem der wirtschaftlichen Macht" als "die andere Seite des Problems der Freiheit in der modernen industrialisierten Welt" erkannt hatten, um es in den Worten von Walter Eucken auszudrücken.
Natürlich hatte Goethe Angst, die Zukunft des Menschen könnte tatsächlich so aussehen wie die erschreckenden Teilwelten der "Wanderjahre". Safranski beschreibt sie sehr schön: Brauchbarkeit und Nützlichkeit treten an die Stelle von Schönheit und Genuss, Lustgärten und Parks werden durch Gemüsebeete und Fruchtbäume ersetzt, Theater gleich ganz eingespart, der Mensch wird nicht mehr gebildet, sondern nur noch mit Blick auf seine ökonomische Verwertbarkeit ausgebildet. Das war für Goethe keine Sozialutopie, sondern eine Horrorvision, allerdings leider keine unrealistische, wie er ahnte und wir heute wissen.
Das Thema hatte Goethe schon 1807 beschäftigt. Die Welt des Prometheus wird in der "Pandora" bereits in der Bühnenanweisung als überaus unwohnlich beschrieben: "alles roh und derb, . . . ohne alle Symmetrie", die Behausungen "mit Toren und Gattern verschlossen". Natur ist nur noch Rohstoff, Prometheus' Arbeiter sind begeistert, wie die Erde "sich quälen lässt", sie kümmert die Geschichte nicht und sie denken nicht über ihre Zukunft nach, ihr Leben ist Arbeit, sie sind "die Nützenden".
In einer solchen Welt wollte Goethe nicht leben. Die Annahme, dass ihr nicht nur die nahe, sondern auch die ferne Zukunft gehören könnte, hätte seiner Kunst den Boden entzogen. In den "Wanderjahren" sprengt die ernüchternde Prosa die Romanform. In der "Pandora" stehen Epimetheus und die "muntern Luftgeburten" aus Pandoras Krug für jene Werte, die sich nicht auf Märkten handeln lassen. Sie leben allerdings fast nur noch in der Erinnerung. Das Stück sollte mit Pandoras Wiederkehr enden, ausgeführt wird sie nicht. Von den Spätwerken endet eigentlich nur der "Faust" klar und eindeutig: mit der Blamage Mephistos und Fausts Seelenrettung.
Sein Urvertrauen
Safranski findet, wie viele Rezensenten vor ihm, "Fausts" Ende "erbärmlich". Das ist eine der wenigen Werkinterpretationen in seinem Buch, die mir schlecht begründet scheinen. Faust entwirft in seinem großen Schlussmonolog eine Zukunftsgesellschaft, die nicht mehr von Arbeitssklaven oder nützlichkeitsfanatischen Homines oeconomici, sondern von freien und souveränen Menschen bevölkert wird. Mit Blick auf diese Zukunftshoffnung genießt er "seinen höchsten Augenblick". Ausgangspunkt von Fausts Überlegungen und deren Begleitmusik sind die Spatenklänge der Lemuren, die an Fausts Grab arbeiten, während der Erblindete glaubt, sein Dammbauprojekt würde vorangetrieben. Die Szene ist grotesk, vielleicht auch tragisch, aber erbärmlich? Fausts letzte Worte sind eine Liebeserklärung an die Menschheit, während Halbtote unter Mephistos Oberbefehl damit beschäftigt sind, sein Grab zu schaufeln. Vielleicht hat der alte Goethe seine Lebensumstände genau so grotesk empfunden?
Bekanntlich war er um keinen Preis bereit, "Faust II" zu Lebzeiten zu veröffentlichen. Er fürchtete, seine "redlichen, lange verfolgten Bemühungen um dieses seltsame Gebräu würden schlecht belohnt und an den Strand getrieben, wie ein Wrack in Trümmern daliegen und von dem Dünenschutt der Stunden zunächst überschüttet werden". Denn: "Verwirrende Lehre zu verwirrtem Handel waltet über die Welt." "Faust" ist Goethes Liebeserklärung an die Menschheit, aber offenbar hörte er die Spaten der banausischen Lemuren bereits so laut klappern, dass er wenig Hoffnung hatte, die Botschaft könne ihren Adressaten erreichen. Er erwartete vielmehr, das große Werk würde "zunächst" unter dem "Dünenschutt der Stunden" begraben - bis der Mensch irgendwann vielleicht, unter besseren gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, zu sich zurückfindet. Und hat Goethe mit dieser düsteren Ahnung nicht Recht behalten, bis heute?
Wirklich "erbärmlich" endet übrigens Mephisto. Der Menschenverächter wird in dem Augenblick, als er sich Fausts Seele schnappen will, ausgerechnet von der schönsten aller menschlichen Leidenschaften, von dem Gefühl der Liebe, überwältigt. Das währt natürlich nicht lange, aber es genügt, um den Engeln Gelegenheit zu geben, mit Fausts Seele gen Himmel zu fliegen. Mephisto verflucht sich und seine "Torheit" und steht ziemlich belämmert da.
Hegels Ästhetik endet mit dem Ende der Kunst; er geht resigniert davon aus, dass der grauen Nützlichkeitsprosa die Zukunft gehört. Goethe wollte nicht resignieren. Er hatte sein "Urvertrauen" wiedergefunden. Aber wir sollten anerkennen, dass es nun wirklich keine Banalität war, bereits am Beginn des 19. Jahrhunderts über eine Moderne jenseits des Kapitalismus nachzudenken.
Rüdiger Safranski: "Goethe - Kunstwerk des Lebens". Hanser, 27,90 Euro
Sahra Wagenknecht ist stellvertretende Vorsitzende der Fraktion der Linken im Deutschen Bundestag.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Diese Lesung beeindruckt durch das Wechselspiel des bekannten Hörbuchsprechers Frank Arnold, der die Lebensgeschichte erzählt, mit dem Autoren, der die kürzeren Zwischenbetrachtungen vorträgt."