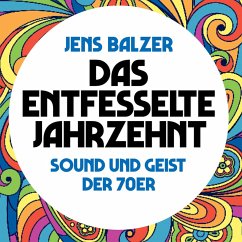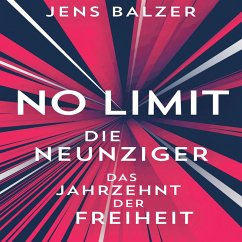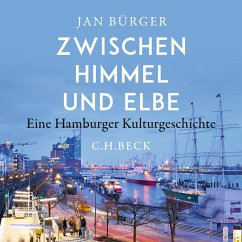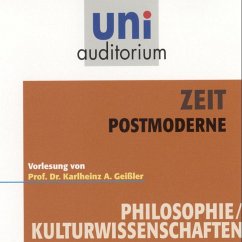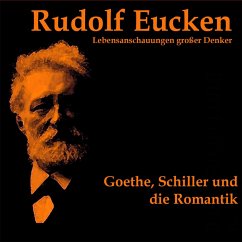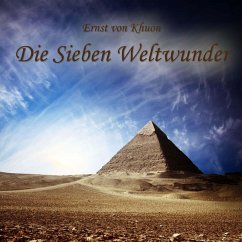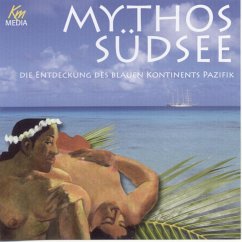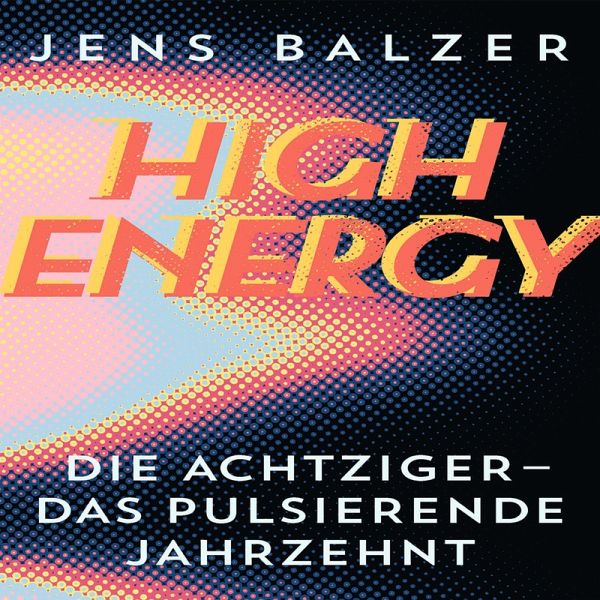
High Energy (MP3-Download)
Die Achtziger - das pulsierende Jahrzehnt Ungekürzte Lesung. 695 Min.
Sprecher: Dunkelberg, Sebastian
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
22,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
11 °P sammeln!
Es sieht nicht alles schlimm aus in den achtziger Jahren. Aber vieles. Es ist das Jahrzehnt der explodierenden Dauerwellen und Pornoschnauzbärte, der aufgepumpten Schulterpolsterjacketts und schrillen Herumprotzerei; in den Achtzigern werden die Yuppies zu Vorreitern einer neuen Egoistenkultur. Doch gleichzeitig herrscht die Angst vor der Apokalypse, vor dem Atomtod und der Umweltzerstörung; die Menschen sehnen sich nach Utopien und Zukunft, nach neuer Gemeinschaft und Wärme. Helmut Kohl lässt die »geistig-moralische Wende« ausrufen, aber Hunderttausende demonstrieren auch für Frieden u...
Es sieht nicht alles schlimm aus in den achtziger Jahren. Aber vieles. Es ist das Jahrzehnt der explodierenden Dauerwellen und Pornoschnauzbärte, der aufgepumpten Schulterpolsterjacketts und schrillen Herumprotzerei; in den Achtzigern werden die Yuppies zu Vorreitern einer neuen Egoistenkultur. Doch gleichzeitig herrscht die Angst vor der Apokalypse, vor dem Atomtod und der Umweltzerstörung; die Menschen sehnen sich nach Utopien und Zukunft, nach neuer Gemeinschaft und Wärme. Helmut Kohl lässt die »geistig-moralische Wende« ausrufen, aber Hunderttausende demonstrieren auch für Frieden und Abrüstung, die Grünen etablieren sich als politische Kraft. Die Popkultur wird zum Schauplatz der feministischen und schwulen Emanzipation, mit dem Hip-Hop erhalten Minderheiten eine Stimme, die bis dahin fast unsichtbar waren. Eine ganze Generation lernt am Commodore 64 das Programmieren und begibt sich auf den Weg in die digitale Gesellschaft. Am Ende des Jahrzehnts fällt die Berliner Mauer, eine Umwälzung, die unsere Welt bis heute prägt.
Jens Balzer bringt die Widersprüche der Achtziger zum Leuchten, ihre befremdlichen Moden und bizarren Lebensstile ebenso wie ihren Revolutionsdrang, in dem die Wurzeln unserer Gegenwart liegen.
Inhalt u.a.:
Schlabberpullis im Deutschen Bundestag: Protestbewegungen und der Marsch durch die Institutionen • Spermavögel tanzen den Bullenpogo: Die Rebellion der Punks gegen rechte und linke Spießer • Und wann gehen Sie wieder zurück in die Türkei? Deutschland auf dem Weg zur multikulturellen Gesellschaft • Schwarzer Kopf, schwarzer Bauch, schwarze Füss: Der erfolgreichste Film des Jahrzehnts und die Welt als Zeichengestöber • Frauen sehen wie Männer aus, die wie Frauen Aussehen: Was Margaret Thatcher mit Modern Talking verbindet • Von glücklichen Patchwork-Familien: Professor Brinkmann und die neue Unübersichtlichkeit der Liebes- und Lebensverhältnisse • Video, Walkman, Computerkultur: Der Beginn des digitalen Zeitalters • Ihr wolltet die sexuelle Befreiung? Hier habt ihr Porno! Der Videorecorder und die mediale Revolution der Wohnzimmer • »'cause this is thriller, thriller night«: Über Michael Jackson, Walkman-Träger und andere Zombies • Ein italienischer Klempner rettet die Welt: Die neue Jugendkultur der Computerspiele • Fickt das System! Die neue Hackerszene und der Computer als Werkzeug der politischen Subversion • Die Seuche, die alles verändert: Aids, die Angst und das Sterben – und eine neue Emanzipation • Wir sind alle Cyborgs: Arnold Schwarzenegger und die Erfindung der Gender Studies • Tödliche Strahlung und nuklearer Winter: Bilder vom nahen Ende der Welt • Fight the Power: Hip-Hop als Kultur der schwarzen Selbstermächtigung und der Wiederaneignung der Geschichte • Mein Vater blutet Geschichte: Neue Formen der Erinnerung und der Holocaust mit Katzen und Mäusen • Orgasmus, Sex on the Beach, Energydrinks: Eine kleine Getränkekunde der Achtziger • War das die »geistig-moralische Wende«? Entfesselte Märkte und der neue Geist des Individualismus
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.