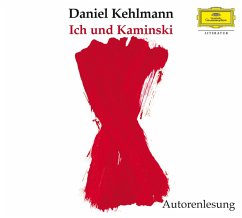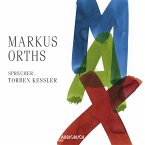Sebastian Zöllner will die Biographie des Malers Manuel Kaminski schreiben. Mit dem Buch über Kaminski hofft Zöllner zum eigenen Durchbruch zu kommen. Schließlich war Kaminski mit Matisse und Picasso befreundet, und in Kunstkreisen wird noch immer die Geschichte von Kaminskis großem Durchbruch erzählt. Nun ist Eile geboten, wenn die Biographie pünktlich zum Ableben des Malers erscheinen soll. Aber als es Zöllner endlich trickreich gelingt, den Maler auf eine tagelange Reise im Auto mitzunehmen, erkennt er, dass er dem Alten, blind oder auch nicht blind, in keiner Weise gewachsen ist.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.

Daniel Kehlmann liest aus dem Roman "Ich und Kaminski"
Nicht oft gibt es einen so unsympathischen Ich-Erzähler, einen, dem man wünscht, seine Unternehmungen mögen schiefgehen. Daniel Kehlmann hat so einen Helden erschaffen: In seinem im Suhrkamp Verlag erschienenen Roman "Ich und Kaminski" beschreibt er die vor keinen Mitteln zurückschreckenden Bemühungen des Kunststudenten Sebastian Zöllner, eine Biographie über den berühmten Maler Kaminski zu schreiben. Mittlerweile lebt Kaminski zurückgezogen in den Alpen, und Zöllner hofft, von dem alten Mann einige Anekdoten exklusiv für sein Buch zu erhalten. Dafür schreckt Zöllner vor nichts zurück: Er besticht die Haushälterin, um mit Kaminski allein zu sein, er durchsucht heimlich dessen Schränke und Schubladen, um mehr über den Maler herauszufinden.
Kehlmann hatte für die Lesung in der Frankfurter Y-Buchhandlung Passagen ausgewählt, die seinen jungen Helden in peinlicher Bedrängnis zeigen. Denn Zöllner, so ehrgeizig und eingebildet wie skrupellos, nimmt seine unangenehme Wirkung auf andere nicht wahr. Aus der falschen Selbsteinschätzung des Protagonisten bezieht der Roman seine Komik: Ständig manövriert sich der Held in die unmöglichsten Situationen, etwa, indem er sich selbst zu einem Essen mit Freunden des Malers einlädt, ohne zu bemerken, wie herzlich unwillkommen er ist. Er spürt nicht, wann er gehen sollte, und die Kaminskis müssen ihn am Abend schon fast hinauswerfen, bis er endlich den Heimweg antritt.
Szenen wie diese riefen im Publikum größte Heiterkeit hervor. Auch Kehlmanns satirische Beschreibung des Kunstbetriebs entfaltete in ihrer Treffsicherheit eine humorvolle Wirkung. Um seinem Ziel, einer Anstellung im ArT-Magazin, näher zu kommen, schleift Zöllner eines Abends den erschöpften Kaminski auf eine Vernissage. Doch aus der erhofften Sensation wird nichts: Zu lange ist Kaminskis Zeit vorbei, die anderen können nichts mehr mit ihm anfangen. Auch der Chefredakteur des ArT-Magazins weiß nicht, welche Bilder Kaminski eigentlich gemalt hat. Kaminski wiederum entpuppt sich als gar nicht gesprächig, den ganzen Abend sagt er nichts anderes, als daß er wieder nach Hause möchte.
"Ich und Kaminski" ist Kehlmanns fünftes Buch, schon drei Romane und einen Erzählband hat der gerade 28 Jahre alte Autor veröffentlicht. Kehlmann hat in Wien Philosophie und Literaturwissenschaft studiert und arbeitet derzeit an seiner Promotion. Wohl daher stehe sein "philosophisches Interesse" im Vordergrund, erläuterte der Autor später: Er entwickele seine Geschichten stets aus einer abstrakten Idee, nicht aus persönlichen Erfahrungen und Nöten. So habe er auch bei seinem jüngsten Roman "Ich und Kaminski" das Ende von Anfang an im Kopf gehabt, erzählte Kehlmann. Daß die unerwartete Läuterung des Helden zum Schluß eine "Gratwanderung" sei, sagte der Autor, sei ihm durchaus bewußt. Die Wendung ins Ernsthafte, der Moment der Erkenntnis am Ende sei ein "gefährliches literarisches Mänover", gab Kehlmann zu: "Aber ich möchte meine Figuren ernst nehmen."
KATHARINA DESCHKA-HOECK
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Schon mehrfach hat Kehlmann den Wissenschafts- und Kunstbetrieb maliziös ins Bild gesetzt, doch noch nie hat er sein satirisches Temperament so vom Zügel gelassen wie hier ... Sein mit Abstand komischstes Buch. Und sein abenteuerlichstes ... So ansteckend lustvoll und hinreißend unglaubwürdig strapaziert die trivialen Genres nur, wer sie um Haupteslänge überragt.« Andreas Nentwich DIE ZEIT