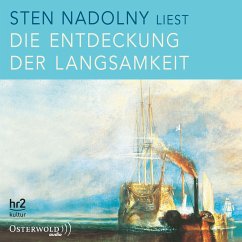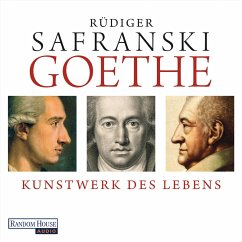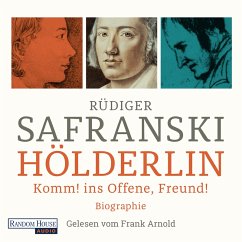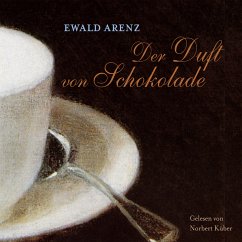Kafka. Um sein Leben schreiben. (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 516 Min.
Sprecher: Arnold, Frank

PAYBACK Punkte
11 °P sammeln!
Rüdiger Safranski über eine Jahrhundertfigur der Weltliteratur Franz Kafka sagte von sich: »Ich habe kein litterarisches Interesse, sondern bestehe aus Litteratur, ich bin nichts anderes und kann nichts anderes sein.« In den ekstatischen Zuständen des Schreibens fühlte sich Kafka erst wirklich lebendig. Da ging ihm eine ungeheure Welt auf. Entstanden ist dabei ein einzigartiges Werk voller Geheimnisse. Kafka ist ein faszinierendes Beispiel dafür, was Schreiben im Extremfall für das Leben bedeuten kann, wie alles ihm untergeordnet wird, welche Tragödien und Augenblicke des Glücks sich...
Rüdiger Safranski über eine Jahrhundertfigur der Weltliteratur Franz Kafka sagte von sich: »Ich habe kein litterarisches Interesse, sondern bestehe aus Litteratur, ich bin nichts anderes und kann nichts anderes sein.« In den ekstatischen Zuständen des Schreibens fühlte sich Kafka erst wirklich lebendig. Da ging ihm eine ungeheure Welt auf. Entstanden ist dabei ein einzigartiges Werk voller Geheimnisse. Kafka ist ein faszinierendes Beispiel dafür, was Schreiben im Extremfall für das Leben bedeuten kann, wie alles ihm untergeordnet wird, welche Tragödien und Augenblicke des Glücks sich daraus ergeben und welche Einsichten sich an dieser existentiellen Grenze auftun. Der 100. Todestag Franz Kafkas im Jahr 2024 ist ein Anlass für Rüdiger Safranski, sich in einem literarisch-biographischen Essay dieser geheimnisvollen Jahrhundertfigur der Weltliteratur zu nähern. Ungekürzte Lesung mit Frank Arnold 8h 36min
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.