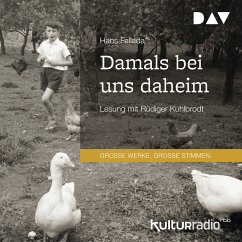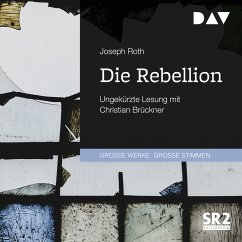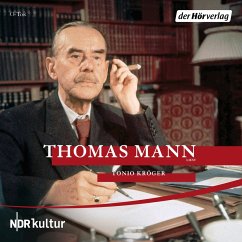Lilly und ihr Sklave (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 396 Min.
Sprecher: Antoni, Jennipher
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
17,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
9 °P sammeln!
Unveröffentlichte Geschichten des Bestsellerautors entdeckt: Erzählungen aus den zwanziger Jahren.Es war der Wendepunkt, bevor er zum Bestsellerautor wurde: Hans Fallada stellte sich 1925 nach Unterschlagungen, mit denen er seine Alkohol- und Morphiumsucht finanzierte, selbst der Polizei. Eine bislang verloren geglaubte Gerichtsakte fördert nun einen unerwarteten literarischen Fund zutage – fünf Geschichten von Fallada, die selbst vor damals tabuisierten Themen nicht haltmachen: Lilly, Marie und Thilde – drei starke Frauen, die sich gegen die vorgezeichneten Lebensmuster auflehnen, wä...
Unveröffentlichte Geschichten des Bestsellerautors entdeckt: Erzählungen aus den zwanziger Jahren.Es war der Wendepunkt, bevor er zum Bestsellerautor wurde: Hans Fallada stellte sich 1925 nach Unterschlagungen, mit denen er seine Alkohol- und Morphiumsucht finanzierte, selbst der Polizei. Eine bislang verloren geglaubte Gerichtsakte fördert nun einen unerwarteten literarischen Fund zutage – fünf Geschichten von Fallada, die selbst vor damals tabuisierten Themen nicht haltmachen: Lilly, Marie und Thilde – drei starke Frauen, die sich gegen die vorgezeichneten Lebensmuster auflehnen, während die beiden Außenseiter Pogg und Robinson auf der Suche nach Liebe und Geborgenheit Zuflucht in einer Gefängniszelle suchen. Bislang gänzlich unveröffentlichte oder nur in Teilen bekannte Geschichten, die Falladas verblüffende Modernität unterstreichen.-
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.