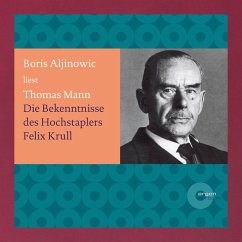Lob (MP3-Download)
Über Literatur Ungekürzte Lesung. 167 Min.
Sprecher: Arnold, Frank
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
14,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
7 °P sammeln!
"Daniel Kehlmann", das war unlängst in der Neuen Zürcher Zeitung zu lesen, "scheint alles zu können." Und es stimmt: Er schreibt mit Verve und Erfolg nicht nur Romane, sondern auch über sie."Lob" versammelt seine jüngsten Texte zur Literatur - Rezensionen, Reden, Essays, aber auch eigene Prosastücke, die von Literatur erzählen und, mal mit Bewunderung, mal mit Nachsicht, von ihren jungen und alten Meistern.
Doch klug und kenntnisreich von Shakespeare, Kleist oder Thomas Mann, von Beckett, Brecht und Bernhard, von Imre Kertész, Max Goldt oder Stephen King reden ist das eine. Das an...
"Daniel Kehlmann", das war unlängst in der Neuen Zürcher Zeitung zu lesen, "scheint alles zu können." Und es stimmt: Er schreibt mit Verve und Erfolg nicht nur Romane, sondern auch über sie."Lob" versammelt seine jüngsten Texte zur Literatur - Rezensionen, Reden, Essays, aber auch eigene Prosastücke, die von Literatur erzählen und, mal mit Bewunderung, mal mit Nachsicht, von ihren jungen und alten Meistern.
Doch klug und kenntnisreich von Shakespeare, Kleist oder Thomas Mann, von Beckett, Brecht und Bernhard, von Imre Kertész, Max Goldt oder Stephen King reden ist das eine. Das andere sind die "sehr ernsten Scherze" über alltägliche wie ästhetische Fragen: Soll man von der wohlgepolsterten Demütigung der ersten Lesereisen berichten? Und zugeben, dass alles, was in Büchern steht, einem sowohl wirklicher als auch wahrer erscheint als die aufdringliche, laute und auch ein wenig Angst einflößende Welt?
Man soll und muss - auch das zeigt dieses Hörbuch.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.