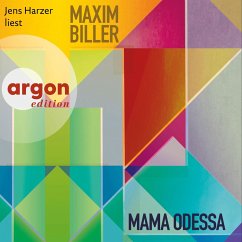Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Diesmal hatte ich mir sogar noch weniger
ausgedacht als davor: Maxim Billers "Mama Odessa" ist die Reflexion eines traurigen
Emigrantenromans.
Ein rotes Sofa, auf dem erst Mutter und Vater sitzen, dann Mutter und Sohn und schließlich der Sohn allein: Dieses vergleichsweise simple, aber wirkungsvolle Motiv von Familienzusammengehörigkeit wie auch deren Auseinandergehen bringt das Thema von Maxim Billers neuem Roman Mama Odessa bereits auf den Punkt. Noch dazu handelt es sich um eine motivische Übernahme, denn das Sofa tauchte bereits im vorherigen Familienroman des Schriftstellers auf: In "Sechs Koffer" (2018) ruht sich der Vater des Erzählers nach der Arbeit auf dem Sofa im Arbeitszimmer aus, er liebt das Sofa. Die Mutter hingegen hat es von Anfang an gehasst, das gilt in "Sechs Koffer" genauso wie nun in "Mama Odessa".
Trotz dieser Analogie liegen auch einige Unterschiede zwischen den beiden Romanen. Während in "Sechs Koffer" die Fluchtgeschichte nach Prag und Hamburg als unmittelbar zurückliegende Erinnerung erzählt wird, liegt sie in "Mama Odessa" ferner, erklingt in den Figuren nur noch als Echo. In gewisser Weise wird der Herkunftsort Odessa für den Erzähler Mischa, seine Mutter und seinen Vater zum Sehnsuchtsort, unerreichbar, aber nach wie vor mit allem Gegenwärtigen verwoben. "Warum war keiner von uns Dreien jemals wieder nach Odessa gefahren, wenn es uns in Deutschland so wenig gefiel?": Darauf sucht Mischa im Erzählen eine Antwort. Neben der Herkunft handelt der Roman somit von einem weiteren Biller-Evergreen, dem - in den Worten des Literaturwissenschaftlers Kai Sina - "meist verkrampften, oft auch verlogenen, in jedem Fall aber komplizierten Zusammenleben von Juden und Nichtjuden in Deutschland".
Der Titel "Mama Odessa" spielt auf beide der zentralen Themen an: Zum einen ist das die bereits geschilderte Beziehung zur Herkunft aus Odessa, in der sich für den Erzähler eine Art Mutter aller Geschichten verbirgt, da sein Schreiben über die Familiengeschichte besonders um diesen Ort kreist. Und zum anderen geht es um die Beziehung Mischas zur eigenen Mutter Aljona Grinbaum, die seit ihrer Kindheit davon träumt, Schriftstellerin zu werden und schließlich im Alter von 68 Jahren ihren ersten Band mit Erzählungen veröffentlicht. Dabei hatte ihr Sohn ihre Erzählungen eher als Notlösung - aufgrund von "immer länger werdenden Telefongesprächen" - an seine Lektorin geschickt, um seiner Mutter über die Scheidung und die Einsamkeit im Alter hinwegzuhelfen: "Statt aber für ein paar Tage zu ihr zu fahren, sie ein bisschen zu trösten und ihre Hand zu streicheln, hatte ich bald eine bessere Idee, wie ich ihr helfen könnte, ohne für eine solche sinnlose Reise Zeit und Konzentration zu opfern."
Nun ist Aljona verstorben, und als Mischa in ihre Wohnung in der Bieberstraße in Hamburg einzieht, findet er in ihrem Arbeitszimmer unveröffentlichte Geschichten und an ihn adressierte Briefe, die seine Mutter nie abgeschickt hat. Mit dem Lesen dieser Dokumente erwachen im Erzähler alte Erinnerungen an die Mutter, den Vater, aber auch die kurze Kindheit in Odessa: den Hof in der Gogolskaja, in dem alle Erwachsenen der jüdischen Nachbarschaft zusammensaßen und redeten, aber auch die Verhöre, zu denen sein Vater teilweise tagelang festgehalten wurde. Dabei ist diese Retrospektive, egal ob die eigene oder die der Mutter, für Mischa mit Schmerz verbunden: "Würden noch mehr von diesen Erinnerungen zu mir zurückkommen, wenn ich über das lange Sterben meiner Mutter weiterschreiben würde? Ja, das glaube ich. Aber will ich das?"
Wie gewohnt erzählt Biller dabei eng an seiner eigenen Lebensrealität entlang, ein Verfahren, zu dem er sich unter anderem in seinen Essays stark selbst bekennt, und das seit dem inzwischen verbotenen Roman "Esra" nicht mehr nur literaturwissenschaftlich, sondern auch vor Gericht diskutiert wurde. Und auch im aktuellen Roman wird thematisiert, wie das Umfeld des Erzählers wütend darauf reagiert, selbst zu Literatur verarbeitet zu werden: "Diesmal hatte ich mir sogar noch weniger ausgedacht als davor, und dafür mochten mich die Leute noch lieber - aber mein Vater redete deswegen kaum noch ein Wort mit mir." Das Schreiben über die eigene Familie und das eigene Leben belastet dabei auch das Verhältnis zwischen Mischa und seiner Mutter; besonders da nun ausgehandelt werden muss, wer von beiden über welche Ereignisse der Familiengeschichte schreiben darf. Als der Erzähler eine Erinnerung der Mutter zum Thema einer seiner Geschichten macht, wirft sie ihm vor: "Das war mein Stoff, verstehst du? Du hast ihn mir geklaut. Du warst doch damals gar nicht dabei und du weißt auch nicht, wie es ist, so krank zu sein."
Dadurch liest sich "Mama Odessa" wie ein klassischer Biller - oder, in den Worten Mischas, wie ein weiterer "trauriger Emigrantenroman", in dessen rührender und zugleich bissiger Sprache die Verletztheit des Erzählers durchschimmert. Auch sein Gespür für das kurzweilige Erzählen stellt Biller abermals unter Beweis, denn jeder der insgesamt 34 Abschnitte ist in sich geschlossen, steht für sich allein. Meist durch einen alten Brief der Mutter oder ein anderes Relikt eingeleitet, taucht Mischa in die Vergangenheit ein und schließt mit einem Fazit oder einem Kommentar dazu. Erinnerung nach Erinnerung wird in dieser Weise ausgeführt; jede einzelne sticht wie eine feine Nadel. Von dem selbst zugefügten Schmerz verspricht sich der Erzähler vielleicht aber doch eine therapeutische Wirkung. EMILIA KRÖGER
Maxim Biller: "Mama Odessa". Roman.
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2023. 240 S., geb., 24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
© Perlentaucher Medien GmbH