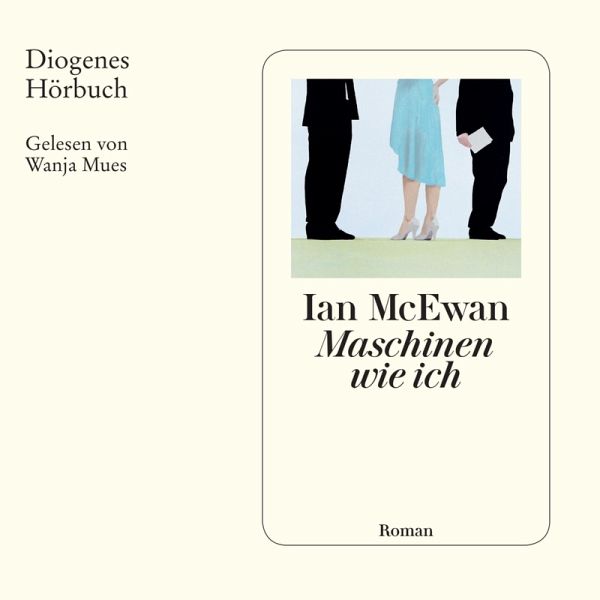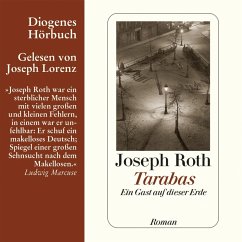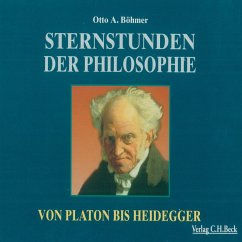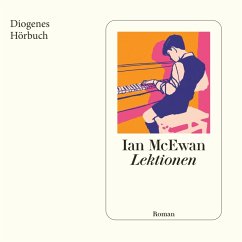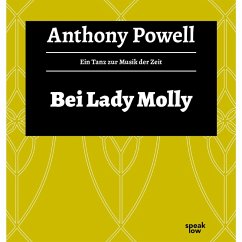Ian McEwan
Hörbuch-Download MP3
Maschinen wie ich (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 676 Min.
Sprecher: Mues, Wanja / Übersetzer: Robben, Bernhard

PAYBACK Punkte
9 °P sammeln!





Charlie ist ein sympathischer Lebenskünstler Anfang 30. Miranda eine clevere Studentin, die mit einem dunklen Geheimnis leben muss. Sie verlieben sich, gerade als Charlie seinen ›Adam‹ geliefert bekommt, einen der ersten lebensechten Androiden. In ihrer Liebesgeschichte gibt es also von Anfang einen Dritten: Adam. Kann eine Maschine denken, leiden, lieben? Adams Gefühle und seine moralischen Prinzipien bringen Charlie und Miranda in ungeahnte – und verhängnisvolle – Situationen.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Ian McEwan, geboren 1948 in Aldershot (Hampshire), lebt bei London. 1998 erhielt er den Booker-Preis und 1999 den Shakespeare-Preis der Alfred-Toepfer-Stiftung. Seit seinem Welterfolg ›Abbitte‹ ist jeder seiner Romane ein Bestseller, viele sind verfilmt, zuletzt ›Am Strand‹ (mit Saoirse Ronan) und ›Kindeswohl‹ (mit Emma Thompson). Ian McEwan ist Mitglied der Royal Society of Literature, der Royal Society of Arts, der American Academy of Arts and Sciences und Träger der Goethe-Medaille.
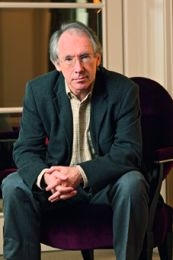
© Bastian Schweitzer / Diogenes Verlag
Produktdetails
- Verlag: Diogenes Verlag
- Gesamtlaufzeit: 676 Min.
- Erscheinungstermin: 26. Juni 2019
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783257693256
- Artikelnr.: 57059329
»Ein so hochliterarischer wie engagierter Zeitdiagnostiker.« Barbara Villiger Heilig / Neue Zürcher Zeitung Neue Zürcher Zeitung
1982 - eine Welt, in der Alan Turing noch lebt und die Gesellschaft mit seiner Kreativität und Intelligenz um viele Erfindungen bereichert bzw. ihnen zum Durchbruch verholfen hat wie beispielsweise autonome Fahrzeuge oder lebensechte Androiden. Einen solchen 'Adam' kauft sich der 32jährige …
Mehr
1982 - eine Welt, in der Alan Turing noch lebt und die Gesellschaft mit seiner Kreativität und Intelligenz um viele Erfindungen bereichert bzw. ihnen zum Durchbruch verholfen hat wie beispielsweise autonome Fahrzeuge oder lebensechte Androiden. Einen solchen 'Adam' kauft sich der 32jährige Charlie ohne zu ahnen, wie sehr sich Adam in sein Leben drängen wird.
Eine tolle Thematik, die angesichts der Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) hochaktuell ist. Ausgangspunkt ist eine Liebesgeschichte, in die der Autor geschickt die Fragen nach Moral, Ethik, Gefühlen und sonstige relevante Problematiken für den Bereich der KI hineinpackt. Zwar hat auch McEwan keine endgültigen Antworten zu bieten (das wäre auch zu viel erwartet), aber er zeigt in beinahe unterhaltender Art und Weise die Schwierigkeiten auf, die sich aus dem Zusammenleben zwischen Mensch und Androiden ergeben können. Doch damit nicht genug: Aus der Liebesgeschichte heraus entwickelt sich eine Rachegeschichte, die die Frage nach Recht und Wahrheit stellt, nach Gerechtigkeit und Gesetz, was sich durch die 'Augen' einer KI völlig anders darstellt als für einen Menschen.
Fast beiläufig, dennoch stets präsent, sind die Zeitläufte in denen dieses Buch spielt. Zeitläufte, die durch die Veränderung einer 'Kleinigkeit' wie beispielsweise dem Weiterleben von Alan Turing, völlig anders ablaufen als wir sie erlebt haben. Zwar entspricht Vieles dem, was wir kennen und teilweise selbst erlebt bzw. mitbekommen haben. Aber Anderes, auch Wesentliches, hat sich in eine völlig andere Richtung entwickelt. Ein Gedankenexperiment, das deutlich macht, wie wenig es bedarf, dass das Leben eine gänzlich andere Bahn nimmt.
Und damit sich auch wirklich niemand langweilt, gibt es noch kleine und größere Exkurse in die unterschiedlichsten Themengebiete: Medizin, IT, Kunst ... Ja, der Autor verfügt über ein profundes Wissen, aus dem er für dieses Buch aus dem Vollen schöpft. Und besitzt zudem die Fähigkeit, kluge Sätze zu schreiben wie "Aber war das nicht Natur? Und zudem ein alter Hut? Männer, die Frauen für eine Naturgewalt hielten? Glich sie also eher einem kontraintuitiven euklidischen Beweis?"
So toll das Thema, so intelligent auch die Ausarbeitung - mir ist das insgesamt von Allem zu viel. Vielleicht bin ich auch nur nicht schlau genug.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Ian McEwan ist mal wieder ein Roman gelungen, der den Leser zum Nachdenken bringt.
Wir stellen uns einfach mal vor: Es sind die 1980erJahre, die Welt, die Ian McEwan uns beschreibt, sieht allerdings anders aus, als unsere reale Vergangenheit. Die Technik der 1980er Jahre ist schon viel …
Mehr
Ian McEwan ist mal wieder ein Roman gelungen, der den Leser zum Nachdenken bringt.
Wir stellen uns einfach mal vor: Es sind die 1980erJahre, die Welt, die Ian McEwan uns beschreibt, sieht allerdings anders aus, als unsere reale Vergangenheit. Die Technik der 1980er Jahre ist schon viel fortgeschrittener, es gibt Handys und selbstfahrende Autos. Und seit neuestem gibt es - wenn auch erst in geringer Stückzahl - Roboter, die wie Menschen aussehen, die denken können, sich wie Menschen bewegen und handeln können. Nur eines unterscheidet sie: sie benötigen Strom. Nachts werden sie ans Stromnetz angeschlossen und werden aufgeladen.
Dem Protagonisten Charlie ist es gelungen einen der raren Roboter zu ergattern. Er häte zwar lieber eine EVA gehabt, aber ist auch mit seinem ADAM zufrieden. Zu der Geschichte gehört aber auch noch Miranda, die im selben Haus wie Charlie wohnt, nur eine Etage höher. Sie und Charlie beginnen eine Beziehung, gerade als auch Adam bei Charlie "einzieht". Auch Adam hat Gefühle, er verlieb sich ebenfalls in Miranda - und da er über ausgezeichnete Recherchekompetenzen verfügt - weiß er auch mehr über sie als Charlie. Miranda verheimlicht etwas aus ihrer Vergangenheit, doch ihre Vergangenheit droht sie nun einzuholen.
Abwechslungsreich und dramtaturgisch fesselnd erzählt uns Ian McEwan eine kunstvoll inszinierte Dreiecks-Geschichte, die so ganz anders ist als alle anderen sonstigen Dreiecksgeschichten, denn ein Part ist nicht menschlich - jedenfalls nicht 100%ig. Zudem hat mir dieser Mix aus Vergangenheit/Zukunft sehr gut gefallen, was wäre, wenn es damals schon diese heutigen technischen Möglichkeiten gegeben hätte, was wäre anders gewesen, hätte sich anders entwickelt. Wo ständen wir heute ?
Zudem macht sich Protagonist Charlie viele (philosphische) Gedanken, nicht alle seine Gedanken sind für mich laienhaften Leser verständlich , aber darauf kommt es auch gar nicht an. Es ist ein Teil des Protagonisten und gehört zu dieser Geschichte, und gibt dem ganzen Tiefgang. Denn der eigentliche Kern dieser Geschichte ist die Moral und ob es eine richtige oder mehrere richtige Entscheidungen gibt, die man in gewissen Situationen treffen muss. Was macht den Menschen so einzigartig? Was unterscheidet ihn von einem Roboter? Gibt es die eine einzige Wahrheit? Wann handeln wir richtig? Wieviel Platz dürfen oder sollten Gefühle bekommen, wenn Entscheidungen gefällt werden müssen? Unterhaltsam und nachdenklich werden diese Fragen im Buch thematisiert.
"Maschinen wie ich" liest sich wie ein Science Ficton, ein Krimi, eine LIebesgeschichte - alles auf einmal. Eine fesselnde Geschichte, die zum Nachdenken anregt über Moral und Wahrheit, Liebe und Leid, über Unterlassung und Verheimlichung, Lüge und Verrat.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für