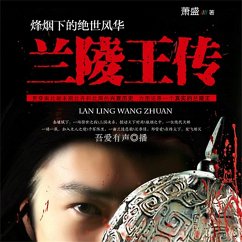Mein Weg (MP3-Download)
Erinnerungen Ungekürzte Lesung. 817 Min.
Sprecher: Wolf, Klaus B.
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
19,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
10 °P sammeln!
Josef Ackermann ist einer der international bekanntesten Topmanager. Berühmt und umstritten. Bankenboss, Krisenmanager, Reizfigur. Nach Studium und Militärzeit legte er eine rasante Karriere bei der SKA hin und wurde als erster Ausländer zum CEO der Deutschen Bank und an die Spitze des Weltbankenverbandes IIF berufen. Mit dem Ziel einer 25%igen Eigenkapitalrendite erregte Ackermann den Zorn von Politikern, Journalisten und Kirchenfürsten. Sein Victory-Zeichen während des Mannesmann-Prozesses sorgte für nationale Empörung. Ackermann ist aber weit mehr als das "kalte Gesicht des Kapitalis...
Josef Ackermann ist einer der international bekanntesten Topmanager. Berühmt und umstritten. Bankenboss, Krisenmanager, Reizfigur. Nach Studium und Militärzeit legte er eine rasante Karriere bei der SKA hin und wurde als erster Ausländer zum CEO der Deutschen Bank und an die Spitze des Weltbankenverbandes IIF berufen. Mit dem Ziel einer 25%igen Eigenkapitalrendite erregte Ackermann den Zorn von Politikern, Journalisten und Kirchenfürsten. Sein Victory-Zeichen während des Mannesmann-Prozesses sorgte für nationale Empörung. Ackermann ist aber weit mehr als das "kalte Gesicht des Kapitalismus". Er war Zeitzeuge der Terroranschläge 9/11, enger Berater von Bundeskanzlerin Merkel, in- und ausländischer Finanzminister und Politikern in den hochdramatischen Wochen der globalen Finanzkrise und trug entscheidend dazu bei, einen Kollaps des globalen Finanzsystems zu verhindern. Erstmals berichtet Ackermann, was hinter den Kulissen geschah und gewährt Einblicke in sein Privatleben, von den Kindheitstagen bis in die Welt der Hochfinanz.
Eine Lieferung an Minderjährige ist nicht möglich
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Entdecke weitere interessante Produkte
Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote