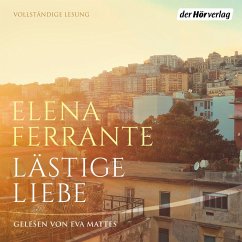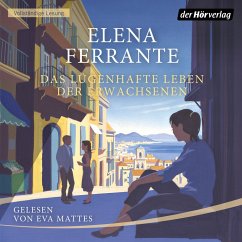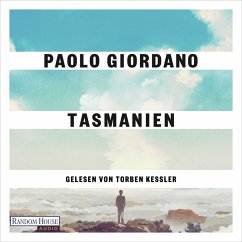Elena Ferrante
Hörbuch-Download MP3
Meine geniale Freundin / Neapolitanische Saga Bd.1 (MP3-Download)
Band 1 der Neapolitanischen Saga: Kindheit und frühe Jugend Ungekürzte Lesung. 703 Min.
Sprecher: Mattes, Eva / Übersetzer: Krieger, Karin

PAYBACK Punkte
4 °P sammeln!





Eine Freundschaft als Spiegel einer Stadt, einer Nation, einer ganzen Generation Im Alter von 66 Jahren erfüllt sich Lila einen Traum: Sie verschwindet von einem Tag auf den anderen. Zurück bleibt ihre beste Freundin Elena und schreibt ihre gemeinsame Geschichte nieder: In den 1950er Jahren wachsen sie am Rande Neapels auf. Elena erzählt vom Alltag der kleinen Leute, vom Zugschaffner Donato, der Gedichte schreibt, vom tyrannischen Don Achille, von den Solara-Brüdern, die sonntags mit ihrem Auto den Corso abfahren. Von Mädchenträumen und erster Liebe. Doch auch wenn ihre Lebenswege nicht ...
Eine Freundschaft als Spiegel einer Stadt, einer Nation, einer ganzen Generation Im Alter von 66 Jahren erfüllt sich Lila einen Traum: Sie verschwindet von einem Tag auf den anderen. Zurück bleibt ihre beste Freundin Elena und schreibt ihre gemeinsame Geschichte nieder: In den 1950er Jahren wachsen sie am Rande Neapels auf. Elena erzählt vom Alltag der kleinen Leute, vom Zugschaffner Donato, der Gedichte schreibt, vom tyrannischen Don Achille, von den Solara-Brüdern, die sonntags mit ihrem Auto den Corso abfahren. Von Mädchenträumen und erster Liebe. Doch auch wenn ihre Lebenswege nicht parallel verlaufen, da Elena das Gymnasium besuchen darf, als Lila schon auf ihre Hochzeit zusteuert, bleibt eines unverbrüchlich: ihre Freundschaft. Theater- und Filmschauspielerin Eva Mattes leiht Elena in dieser ungekürzten Lesung ihre Stimme. (Laufzeit: 11h 43)
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Elena Ferrante hat sich mit dem Erscheinen ihres Debütromans »Lästige Liebe« 1992 für die Anonymität entschieden. Später veröffentlichte sie »Tage des Verlassenwerdens« und »Die Frau im Dunkeln«. Ihre »Neapolitanische Saga« umfasst »Meine geniale Freundin«, »Die Geschichte eines neuen Namens«, »Die Geschichte der getrennten Wege« sowie »Die Geschichte des verlorenen Kindes«. Für den vierten und letzten Band der Reihe stand sie auf der Shortlist für den Man Booker International Prize. 2020 erschien ihr Roman »Das lügenhafte Leben der Erwachsenen«.

Produktdetails
- Verlag: Der Hörverlag
- Gesamtlaufzeit: 703 Min.
- Erscheinungstermin: 1. September 2016
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783844524062
- Artikelnr.: 47723778
 buecher-magazin.deIn der Erscheinungswoche erstürmte sie die Bestsellerlisten, das Literarische Quartett attestierte ein mediales Strohfeuer, um die Neapolitanische Saga dann einmütig zu verreißen. Was ist also dran an dem Auftakt zu dem vierbändigen Epos, das unter dem Pseudonym Elena Ferrante erscheint und in Italien und den USA ein wahres Ferrante-Fieber entfachte? Erzählt wird von Lila und Elena, zwei ungleichen Freundinnen. Es ist die 66-jährige Elena, die diese Geschichte aufschreibt - um die verschwundene Lila durch ihre Erinnerung zurückzuholen. Diese Erinnerungen entführen in ein von dunkler Armut, familiärer Gewalt und mafiösen Strukturen dominiertes Arbeiterviertel im Neapel der Nachkriegszeit. Hier finden sich die beiden Mädchen und spornen sich in ihren Träumen gegenseitig an, dieser kleingeistigen Welt zu entfliehen. Sie verschlingen Romanwelten, kämpfen um die Bestnoten - und doch wird nur einer von beiden der Weg zu einer höheren Bildung ermöglicht. Die klare und bildhafte Sprache von Elena lässt diese archaisch anmutende, enge Welt auferstehen und durch die inneren Zwiegespräche und Reflexionen wird die Freundschaft zum Spiegel ihrer Identität. Denn es ist diese explizit weibliche Perspektive, jenseits von patriarchalischer Mafia-Nostalgie, die dieses Buch so reizvoll macht.
buecher-magazin.deIn der Erscheinungswoche erstürmte sie die Bestsellerlisten, das Literarische Quartett attestierte ein mediales Strohfeuer, um die Neapolitanische Saga dann einmütig zu verreißen. Was ist also dran an dem Auftakt zu dem vierbändigen Epos, das unter dem Pseudonym Elena Ferrante erscheint und in Italien und den USA ein wahres Ferrante-Fieber entfachte? Erzählt wird von Lila und Elena, zwei ungleichen Freundinnen. Es ist die 66-jährige Elena, die diese Geschichte aufschreibt - um die verschwundene Lila durch ihre Erinnerung zurückzuholen. Diese Erinnerungen entführen in ein von dunkler Armut, familiärer Gewalt und mafiösen Strukturen dominiertes Arbeiterviertel im Neapel der Nachkriegszeit. Hier finden sich die beiden Mädchen und spornen sich in ihren Träumen gegenseitig an, dieser kleingeistigen Welt zu entfliehen. Sie verschlingen Romanwelten, kämpfen um die Bestnoten - und doch wird nur einer von beiden der Weg zu einer höheren Bildung ermöglicht. Die klare und bildhafte Sprache von Elena lässt diese archaisch anmutende, enge Welt auferstehen und durch die inneren Zwiegespräche und Reflexionen wird die Freundschaft zum Spiegel ihrer Identität. Denn es ist diese explizit weibliche Perspektive, jenseits von patriarchalischer Mafia-Nostalgie, die dieses Buch so reizvoll macht.© BÜCHERmagazin, Tina Schraml (ts)
"Eine Lesung, bestens geeignet für eine Autofahrt in die geschundene, schöne Stadt Neapel."
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Für Iris Radisch ist "Meine geniale Freundin", der erste Teil von Elena Ferrantes neapolitanischer Saga schlicht ein "epochales literaturgeschichtliches Ereignis". Wie Ferrante hier anhand von zahlreichen Figuren und über sechs Jahrzehnte hinweg europäische Geschichte als "weibliche Nahgeschichte" erzählt, ringt der Rezensentin höchste Anerkennung ab und lässt sie Vergleiche zu Ingeborg Bachmann, Elfriede Jelinek oder Herta Müller ziehen. Insbesondere aber bewundert die Kritikerin, wie die unbekannte, im "Schreib-Schneckenhaus" zurückgezogene Autorin anhand zweier Freundinnen von den Auswegen aus dem Drama eines traditionellen Frauenlebens und der Zerbrechlichkeit weiblicher Selbstentwürfe in einer vom archaischen Geschlechterverhältnis geprägten Umgebung erzählt. Ein Buch, das unter dem geschmeidigen Netz "makelloser Sätze" pulsiert und lange nachhallt, urteilt die Rezensentin.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»In welcher Sprache man den Zyklus auch liest, bestechend an Ferrante ist die Dramaturgie ihres weit ausschweifenden Erzählens, ihr rasanter Rhythmus, das Personal mit seinen ambivalenten Heldinnen und den scharf gezeichneten Nebenfiguren, das sie über 1700 Seiten durch die italienische Zeitgeschichte dirigiert.« Maike Albath Süddeutsche Zeitung 20160909
Gebundenes Buch
Ich gestehe, ich bin drauf reingefallen. Das Ferrante-Fieber geht um, aber ich habe mich nicht infiziert. Selten habe ich mich beim Lesen eines Buches so gelangweilt, wie bei diesem. Endlose Wiederholungen und keinerlei Spannung. Die ersten Seiten machen noch neugierig. Da verschwindet Elenas beste …
Mehr
Ich gestehe, ich bin drauf reingefallen. Das Ferrante-Fieber geht um, aber ich habe mich nicht infiziert. Selten habe ich mich beim Lesen eines Buches so gelangweilt, wie bei diesem. Endlose Wiederholungen und keinerlei Spannung. Die ersten Seiten machen noch neugierig. Da verschwindet Elenas beste Freundin im Alter von 66 Jahren. Sie verwischt alle Spuren als hätte es sie nie gegeben. Zugegeben, ein toller Einstieg. Aber wohin ist die Freundin entschwunden? Das hätte mich brennend interessiert und hätte Stoff für ein spannendes Buch sein können. Bis zu dieser Enthüllung bedarf es aber noch drei Bücher, die ich aber mit Sicherheit nicht auch noch lesen werde. Haarklein erzählt Elena in diesem ersten Band von ihrer Kindheit und Schulzeit und dem Kennenlernen von Lina. Dabei kann nicht unbedingt von einer genialen Freundschaft die Rede sein, die beiden sind eher Rivalinnen im Wettstreit um besondere Leistungen. Beide wissen, daß sie nur mit Bildung ihren ärmlichen, kleinbürgerlichen Verhältnissen entkommen können. Schade, daß es der Autorin nicht gelungen ist, hieraus eine interessante und spannende Geschichte zu machen mit einer Auflösung des Rätsels zum Schluß. Hierzu wäre ein Buch sicher ausreichend gewesen, es sei denn, es geht nur um eine Steigerung der Verkaufszahlen. Das würde die Werbekampagne verständlich machen.
Weniger
Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Elena Greco bekommt von Rino dem Sohn von Raffaella Cerullo (genannt Lila) einen Anruf. Lila ist verschwunden, aber warum wunderte das Elena nicht, Lila wollte doch schon immer eines Tages verschwinden.
Wir blenden zurück in die 50 er Jahre: Italien Rione bei Neapel, der Krieg ist ein paar …
Mehr
Elena Greco bekommt von Rino dem Sohn von Raffaella Cerullo (genannt Lila) einen Anruf. Lila ist verschwunden, aber warum wunderte das Elena nicht, Lila wollte doch schon immer eines Tages verschwinden.
Wir blenden zurück in die 50 er Jahre: Italien Rione bei Neapel, der Krieg ist ein paar Jahre zu Ende, in vielen Familien herrscht immer noch Armut. In dieser Zeit freunden sich Lila die Tochter des Schusters und Elena die Tochter des Pförtners miteinander an. Elena ist fasziniert von Lila, den Lila ist hübsch, intelligent und alle lieben sie. Aber besonders ist Elena von Lila fasziniert, ist sie doch die Klassenbeste, was Elena sofort motiviert ebenfalls besser als sie zu werden. Doch dann verlässt Lila die Schule und soll bei ihrem Vater in der Werkstatt mitarbeiten. Elena die durch die Motivation eine gute Schülerin wurde, macht die Mittelschule und später das Gymnasium. Und nun ist es Lila die besser sein will als Elena, dazu besorgt sie sich Bücher in der Bibliothek und hilft aber somit Elenas Lerneifer weiter anzuspornen. Und der Kontakt der beiden reißt nie auseinander, selbst als Elena ein paar Wochen sich auf Ischia erholt. Aber Lila ist immer einen Schritt weiter wie Elena und so sind auch viele Jungs aus Rione hinter ihr her, weil sie so hübsch ist. Mit 16 heiratet dann Lila ihren Verlobten Stefano und Elena muss nun ebenfalls versuchen einen Mann zu finden.
Meine Meinung:
Erkennbar ist nicht ob diese Saga auf einem realen Hintergrund basiert. Elena Ferrante hat mit diesem Buch den Start einer Familiensaga in vier Teilen begonnen. Kein Wunder benötigt die Autorin vier Bücher, wenn man in einem Band gerade mal nur 20 Jahr abdeckt. Auf über 400 Seiten erzählt sie uns die Freundschaft der beiden, ihre Familiengeschichten aber auch das Leben in Rione. Der Schreibstil ist sehr gut und flüssig, kann einen aber im Lauf des Buches schon mal ermüden. Zwar passieren mal so die einen oder anderen Unfälle, Schlägereien, fast einen Missbrauch, aber im großen ganzen war mir das zu wenig. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht warum um diese Saga so einen Medienrummel gemacht wird. Natürlich ist die Geschichte nett zu lesen, allerdings weiß ich nicht ob ich den zweiten Band lesen werde. Literarisches Meisterwerk ist es meiner Meinung nach nicht, aber ein guter Roman und wer auf solche Familiengeschichten steht, für den mag es das richtige sein. Das Cover ist recht einfach gehalten, passt aber zum Buch, von daher 3 von 5 Sterne.
Weniger
Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Lila und Elena sind schon als junge Mädchen beste Freundinnen. Sie werden es über sechs Jahrzehnte bleiben, bis die eine spurlos verschwindet und die andere auf alles Gemeinsame zurückblickt, um hinter das Rätsel dieses Verschwindens zu kommen.
Soweit der Klappentext, der sich …
Mehr
Lila und Elena sind schon als junge Mädchen beste Freundinnen. Sie werden es über sechs Jahrzehnte bleiben, bis die eine spurlos verschwindet und die andere auf alles Gemeinsame zurückblickt, um hinter das Rätsel dieses Verschwindens zu kommen.
Soweit der Klappentext, der sich nach einer interessanten Erzählung anhört. Leider bin ich von dem hochgelobten Buch enttäuscht. Ein literarisches Meisterwerk soll das sein??? Wäre ich Elena gewesen, hätte ich ihr schon als Kind die Freundschaft gekündigt. Lila trägt die Nase ziemlich weit oben und immer kann sich ja doch alles besser als Elena, das sie ihr natürlich auch unter die Nase reibt. So eine Freundin braucht niemand. Ich fand Lila als Charakter ziemlich abstoßend. Warum muss man aus dieser Erzählung 4 Bände machen? Dieser 1. Band beschreibt die belanglose Kindheit und Jugend der Mädchen. Was hat das mit dem Verschwinden von Lila zu tun? Ich vermute mal fast, dass es reichen wird, den 4. Band zu lesen und dann weiß man warum Lila verschwunden ist. Die Erzählweise der Autorin ist total langweilig und langatmig. Bei mir kamen keinerlei Emotionen an. Vielleicht sollte sich die "Autorin" mal ein Beispiel an dem Buch "Die langen Tage von Castellamare" nehmen, da passiert wenigstens was und vor allem hat es diese Autorin geschafft, ihre Geschichte in einem Buch zu erzählen. Alles andere ist nämlich Geldmacherei!
Weniger
Antworten 4 von 6 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 4 von 6 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Geniales Marketing
Der Hype um die unter Pseudonym schreibende italienische Schriftstellerin Elena Ferrante hat nun auch Deutschland erreicht, als erster Band in ihrem vierteiligen Romanzyklus erschien jüngst der Titel «Meine geniale Freundin». Die wilden Spekulationen der Medien …
Mehr
Geniales Marketing
Der Hype um die unter Pseudonym schreibende italienische Schriftstellerin Elena Ferrante hat nun auch Deutschland erreicht, als erster Band in ihrem vierteiligen Romanzyklus erschien jüngst der Titel «Meine geniale Freundin». Die wilden Spekulationen der Medien über die Identität der Autorin sind für die Auflage mindestens ebenso förderlich wie die Verbindung der einzelnen Bände dieser Tetralogie durch Cliffhanger. Die in den USA besonders durch Kritikerpapst James Wood hochgepushte Rezeption ist in Deutschland zwar weniger euphorisch, Bestsellerstatus aber hat der Roman mühelos auch hier erreicht. Ein literarisches Meisterwerk, wie der Buchumschlag dem Leser verheißt, ein Literaturwunder gar?
Dieses neapolitanische Epos zweier Freundinnen wird von einer der beiden, Elena (sic!) genannt Lenù, aus einem Abstand von etwa sechzig Jahren erzählt. In einem kurzen Prolog erfahren wir, dass ihre Freundin aus Kindertagen, Lila, spurlos verschwunden ist, der Sohn sucht nach ihr. Spontan setzt sie sich an den Computer und beginnt ihre Geschichte aufzuschreiben «mit allen Einzelheiten, mit allem, was mir in Erinnerung geblieben ist». In zwei Kapiteln erzählt die Ich-Erzählerin aus dem Leben der Mädchen in einem der ärmsten Vierteln Neapels, sie beide eint der Wunsch, diesem prekären Milieu zu entfliehen. Was ihnen auch gelingt, bei jeder auf unterschiedliche Art allerdings. Sie entkommen nämlich ganz klassisch, durch Bildung und Heirat, dem Albtraum eines ihnen vorgezeichneten, archaischen Frauenlebens in den Slums von Neapel. Ein Entwicklungsroman mithin, beginnend bei der frühesten Kindheit und endend mit der alle Klischees bedienenden, pompösen und turbulenten Hochzeit der sechzehnjährigen Lila. Von Herkunft gleich, unterscheiden sich die beiden Busenfreundinnen grundlegend in ihrem Wesen. Während Lenù von einer Karriere als Autorin träumt, fleißig und brav in der Schule durch Leistungen glänzt, entsprechend gefördert wird und sogar aufs Gymnasium kommt, ist Lila hochintelligent, ein Wunderkind, Lenù geistig weit überlegen, aber so unangepasst und sprunghaft, dass sie scheitern muss, als unbezahlte Arbeitskraft in der Schumacherwerkstatt ihres Vaters landet und zuletzt, ganz konventionell und gegen ihre Art, den reichen Sohn des Lebensmittelhändlers heiratet.
Konventionell wird auch diese Geschichte erzählt, geradezu brav einsträngig, chronologisch, in einer klaren, leicht lesbaren Sprache, und zwar aus einer strikt feministischen Perspektive, - die Frauen dominieren in diesem breit angelegten Sittengemälde, alle Männer sind nur Randpersonen. Das Figurenensemble des Romans ist ziemlich üppig ausgefallen, was trotz vorangestellter Personenliste die volle Aufmerksamkeit des Lesers fordert. All diese vielen Charaktere sind stimmig beschrieben, die beiden in ständiger Konkurrenz zueinander stehenden Protagonistinnen werden psychisch geradezu durchleuchtet bei ihrem pubertären Selbstfindungsprozess, sympathisch allerdings werden sie dem Leser leider nicht.
Zweifellos ist dieser Roman gekonnt aufgebaut, man hat aber das Problem, dass er Fragment bleibt. Als Cliffhanger dient hier das Entsetzen Lilas, als ihr verhasster Ex uneingeladen auf ihrer Hochzeit auftaucht und dabei auch noch die Schuhe trägt, die sie mit ihrem Bruder mühsam von Hand gefertigt hat, ein unglaublicher Affront, der bei Lilas Naturell nicht ungesühnt bleiben wird, - aber bis zum Band vier fehlen noch etwa 1300 Seiten, man muss Geduld haben. Das wortreiche Geplapper der Autorin über Belangloses, Unwichtiges, verschärft durch viele Wiederholungen, löst schnell Langweile aus, man erkennt nicht recht, wozu man all diese Banalitäten denn lesen muss. Besonders nervig fand ich die irgendwann unerträglich werdende Lobhudelei der Ich-Erzählerin über ihre schulischen Leistungen, man fragt sich, ob da nicht etwa eine echte Elena durchschimmert hinter der Romanfigur. Genial, so mein Fazit, ist nur das Marketing der Verlage, nicht dieser Roman.
Weniger
Antworten 3 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 3 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Lila und Elena, beste Freundinnen seit Kindheitstagen in einem weniger wohlsituierten Viertel Neapels. Die eine, Lila, Tochter eines Schusters, ohne große Zukunft vor sich, obwohl sie offenkundig mit hoher Intelligenz gesegnet ist und diese wohldosiert einzusetzen weiß. Die andere, …
Mehr
Lila und Elena, beste Freundinnen seit Kindheitstagen in einem weniger wohlsituierten Viertel Neapels. Die eine, Lila, Tochter eines Schusters, ohne große Zukunft vor sich, obwohl sie offenkundig mit hoher Intelligenz gesegnet ist und diese wohldosiert einzusetzen weiß. Die andere, genannt Lenù, ebenfalls recht klug, aber sie muss hart pauken, um die entsprechenden Schulleistungen zu erbringen. Für Lenù steht nach der kurzen obligatorischen Grundschule der Weg zur höheren Bildung offen, immer wieder angestachelt durch Lila führt dieser wider Erwarten in ungeahnte Höhen, bis hin zum Gymnasium, wo sie Latein und Griechisch lernt. Für Lila bleibt alles beim Alten: das bekannte Viertel, die Arbeit in der Schusterei, die bekannten Gesichter. Doch aus dem Mädchen wird eine attraktive junge Frau, die schon bald sehr viel Aufmerksamkeit erregt und zwischen alte Fehden gerät.
Wenn ein Roman mit einem solchen Marketingaufwand schon lange vor der Veröffentlichung in aller Munde ist, stellt sich unweigerlich Neugierde ein. Für mich hierbei besonders überraschend: dass Romane bejubelt werden, ist keine Seltenheit, aber dass sich das literarische Feuilleton und die eher massenorientierten Kanäle einig sind bzw. überhaupt über dasselbe Buch sprechen, erstaunt da schon eher. Beim Lesen jedoch hat sich dieser scheinbare Widerspruch schnell aufgelöst: ja, das Buch kann sowohl die einen wie auch die anderen bedienen und wer sich gleichermaßen lesend bewegt, kann sich doppelt freuen.
Band eins der Tetralogie erzählt die Kindheit und Jugend der beiden Frauen. Nuanciert werden Parallelen und Diskrepanzen zwischen den beiden Mädchen vorgestellt, immer wieder führt sie das unsichtbare Band jedoch wieder zusammen. Ohne Frage ist die Erzählerin Lenù sympathisch und lädt schnell ein, sie liebzugewinnen; faszinierender jedoch ist ihr Pendant, das in der Charakterzeichnung vielschichtiger und undurchschaubarer ist. Es braucht keine großen Beschreibungen, die Episoden ihres Lebens, das scheinbar widersprüchliche Handeln charakterisieren diese junge Frau in ausreichendem Maße und lassen Raum für psychologische Spekulationen – insbesondere darüber, was in den kommenden drei Bänden erzählt werden wird. Auch wenn die Erzählerin zurückblickt, wählt sie doch in dieser Passage den Blickwinkel des unwissenden Mädchens, was den Einblick in die neapolitanische Gesellschaft der 50er Jahre insbesondere spannend gestaltet, vieles bleibt vage und nicht begreifbar für die jungen Figuren – die Aussagen lassen jedoch wenig Raum für Interpretation. Die Rolle der Familienclans und mafiöse Strukturen werden mehr als deutlich kritisiert.
Blickt man weniger tief in den Roman, besticht die Sprachegewaltigkeit der Autorin. Ein Plauderton, fast wie von einer Freundin, der immer die richtige Note trifft, lässt den Text regelrecht dahingleiten, so dass die gut 400 Seiten im Nu vorbeifliegen. Wunderschön leicht erzählt sie von der Freundschaft und auch innigen Zuneigung zwei Mädchen – einem Thema, das insbesondere Leserinnen leicht ansprechen dürfte.
Ja, es gibt literarisch anspruchsvollere Bücher, aber wenige sind dabei so unterhaltsam und leicht. All dem Lob für Elena Ferrante – wer auch immer sie sein mag – kann ich mich sehr leicht anschließen.
Weniger
Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Aus der Sicht von Elena Greco erfahren wir, wie das Leben im Neapel in den 1950/60 Jahren stattgefunden hat. Sie wurde in ein ärmeres Viertel hineingeboren, erlebte familiäre Zusammenhalte aber auch Gewalt, besonders gegen Frauen und Kinder, jähzornig und betrunkene Männer, Rache …
Mehr
Aus der Sicht von Elena Greco erfahren wir, wie das Leben im Neapel in den 1950/60 Jahren stattgefunden hat. Sie wurde in ein ärmeres Viertel hineingeboren, erlebte familiäre Zusammenhalte aber auch Gewalt, besonders gegen Frauen und Kinder, jähzornig und betrunkene Männer, Rache unter Familienverbänden und ein besonderes "Aufpassen" der Männer gegenüber ihren Frauen und Töchtern. Die beste Freundin von Elena war Raffaella Cerullo, meist Lila genannt, die die gleichen Erlebnisse hatte wie Elena. Kurz nach der Einschulung war schnell klar, das Lila besonders schnell lernte, sich vieles selbst aneignete und allen Mitschülern weit im Voraus war. Dadurch wurde auch Elenas Lerneifer angestachelt. Durch hartnäckiges Durchsetzungsvermögen ihrer Lehrerin wurde zumindest Elena von ihren Eltern weiterhin zur Schule geschickt, Lila blieb dieses verwehrt, sie musste in der Schusterei und im Haushalt helfen. Trotz, dass sie die Schule nicht besuchte, war sie durch Eigeninitiative Elena im Lernstoff immer voraus, bis zu dem Zeitpunkt als sie erkannte, damit nicht reich zu werden. Das konnte man nur schaffen, indem man sich einen reichen Mann suchte.
Elena Ferrante erzählt höchst interessant über das Leben der beiden Mädchen, ihre Hoffnungen und Wünsche, der Kampf um ein besseres Leben, ihr Erwachsenwerden und die Verliebtheiten. Durch den Prolog, indem Lilas Sohn vom Verschwinden der inzwischen älteren Lila berichtet, möchte man am Liebsten gleich den nächsten Teil der Lebensgeschichte weiterlesen. Ich bin sehr gespannt auf die Fortsetzung.
Weniger
Antworten 3 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 3 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Elena und Lila verbindet eine besondere Freundschaft. Sie leben beide im Stadtteil Rione in Neapel in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Gemeinsam kommen sie in die Schule und beide sind sehr intelligent und setzen sich schnell als klügste Schülerinnen der Klasse durch. Doch …
Mehr
Elena und Lila verbindet eine besondere Freundschaft. Sie leben beide im Stadtteil Rione in Neapel in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Gemeinsam kommen sie in die Schule und beide sind sehr intelligent und setzen sich schnell als klügste Schülerinnen der Klasse durch. Doch während Lila, der das Lernen viel leichter fiel als Elena, nach der Grundschule die Schule beendet und im Schuhgeschäft ihrer Eltern helfen muss, geht Elena auf die weiterführende Schule, lernt Griechisch und Latein und lernt neue Menschen kennen. Dennoch blickt sie immer auf Lila und ihr Leben und schafft es nicht, sich unabhängig von ihr zu betrachten.
„Meine geniale Freundin“ von Elena Ferrante ist der erste von vier Bänden über die besondere Freundschaft von Elena und Lila. Mit der Geschichte der beiden erzählt die Autorin auch viel über das Leben in Süditalien zu der Zeit und nimmt einen so fast mit auf eine Reise. Besonders die Rolle der Gemeinschaft und der Frau in der Familie wird dabei sehr deutlich. Elena darf nur durch den Druck ihrer Lehrerin weiter zur Schule gehen, ihre Eltern verstehen nicht, welchen Sinn es haben soll, dass ein Mädchen so viel lernt. Ihr Weg ist eigentlich vorprogrammiert, sie sollte heiraten und Kinder bekommen. Lila folgt diesem vorgezeichneten Pfad, doch versucht sie gleichzeitig Träume zu haben und zu verwirklichen, z.B. durch den Entwurf von eigenen Schuhmodellen, die ihr Vater verkaufen soll. Sie träumt von einer großen Schuhfabrik, die ihrer Familie gehört. Die Armut ist auf den Straßen des Rione überall präsent und drückt sich auch dadurch aus, dass der örtliche Geldverleiher immer der gefürchtetste und gleichzeitig einflussreichste Mann im Viertel ist. Ihn sollte keiner verärgern, jeder steht in seiner Schuld.
Ferrante beschreibt all dies mit einem großen Abstand zu der Geschichte, Elena berichtet rückblickend als ältere Frau wie es scheint von Ihrer Freundschaft zu Lila. Dennoch nimmt sie einen als Leser mit in das Leben der Mädchen, man fühlt sich ihnen sehr nah und leidet und lacht mit ihnen, wenn sie langsam heranwachsen und sich dem harten Leben im Rione stellen. Die Autorin hat einen ganz besonderen Stil und vermittelt eine Stimmung, die einen beim Lesen gefangen nimmt. Daher kann man sich am Ende auch nur schwer von Elena und Lila trennen, deren Geschichte für uns deutsche Leser erst am 30. Januar 2017 mit dem zweiten Band „Die Geschichte eines neuen Namens“ weitergeht. Mir hat „Meine geniale Freundin“ von Elena Ferrante ausgesprochen gut gefallen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Nach sooo vielen tollen Kritiken, die das Buch bekommen hat (bei Amazon braucht man fast eine halbe Stunde nur um die Empfehlungen zu lesen) dachte ich, das Buch kann gar nicht schlecht sein. Und ich hatte recht und stimme allen begeisterten Lesern der Ferrante Saga zu. Lila und Elena sind schon …
Mehr
Nach sooo vielen tollen Kritiken, die das Buch bekommen hat (bei Amazon braucht man fast eine halbe Stunde nur um die Empfehlungen zu lesen) dachte ich, das Buch kann gar nicht schlecht sein. Und ich hatte recht und stimme allen begeisterten Lesern der Ferrante Saga zu. Lila und Elena sind schon seit ihrer Kindheit Freundinnen, obwohl sie grundverschieden sind und manchmal sogar in Streitigkeiten gelangen. Die erste ist dynamisch und kann sich dem konservartiven, strengen Lebenstil eines ärmlichen Viertels im Neapel der 50er Jahre nicht leicht unterwerfen und anpassen. Elena hingegen ist schüchterner und introvertierter. Beide wollen jedoch insgeheim diesem Leben entfliehen und suchen schon als junge Mädchen Auswege.
So begleiten wir die beiden bis zu ihrem jungen Erwachsenenalter und werden eins mit ihnen durch diese bildreiche und poetische Schriftweise der Autorin. Gleichzeitig aber werden wir auch mit der Aggresivität und oftmals Brutalität der Männerwelt zur damaligen Zeit konfrontiert, die mir manchmal schier unglaublich vorkam. Und doch gelingt es Ferrante diese Situationen als ein alltägliches Ereignis so zu beschrieben, dass man sich dem Zeitstil kurz nach dem ersten Schock einfach lesend anpasst.
Alles in allem ein wirklich bewundernswertes Buch über die Freundschaft zweier Frauen, das gleichzeitig das Leben in Italien zur damaligen Zeit wiederspiegelt.
Ich kann es kaum abwarten in ein paar Monaten den zweiten Band lesen zu können.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Elena und Lila wachsen in Rione, einem ärmlichen Vorort von Neapel, in den 50er und 60er Jahren auf. Beide verbindet eine in meinen Augen etwas eigentümliche Freundschaft, die gut 6 Jahrzehnte halten wird. Dann verschwindet Lila plötzlich so, als hätte es sie nie gegeben. Elena …
Mehr
Elena und Lila wachsen in Rione, einem ärmlichen Vorort von Neapel, in den 50er und 60er Jahren auf. Beide verbindet eine in meinen Augen etwas eigentümliche Freundschaft, die gut 6 Jahrzehnte halten wird. Dann verschwindet Lila plötzlich so, als hätte es sie nie gegeben. Elena will dieses Verschwinden nicht akzeptieren und entschließt sich daher dieses Buch über ihr Leben und ihre Freundin zu schreiben.
So viel zum Thema des Buches... Bleiben wir zunächst bei den positiven Aspekten: dem Schreibstil. Den habe ich durchweg als sehr angenehm und leicht zu lesen empfunden. Ich war sofort in der Geschichte und konnte mich auch längere Zeit darauf einlassen. Aber....
Es ändert nichts an der Tatsache, dass die Story gut gedacht ist, jedoch einfach unnötig in die Länge gezogen wird wie Gummi. 422 Seiten, in denen knapp 10 Jahre abgehandelt werden. Kleinigkeiten werden erzählt, als wären sie weltbewegend. Gut - vielleicht waren sie für eine 8 oder 9jährige weltbewegend, aber diesem Alter sind die meisten Leser leider entwachsen.
Die Autorin verzettelt sich m. E. in überflüssigen Einzelheiten, die die Geschichte nur künstlich in die Länge ziehen. Auf eine - ich kann es nicht anders sagen - regelrecht geschwätzige Art und Weise. Es erinnert an Menschen, die beim Erzählen vom Hölzchen auf Stöckchen kommen und nach 1 Std. weiß man immer noch nicht, was derjenige eigentlich erzählen wollte.
Dazu kommt, dass die von vielen so hoch gepriesene "lebenslange Freundschaft" für mich nur sehr schwer nachvollziehbar ist.
Gerade Lena geht mir ziemlich auf den Nerv, weil sie bei allem und jedem zwar immer nur an Lila denkt - aber leider nicht, weil sie sich um sie sorgt oder sie sie einfach vermisst, sondern eher als Dauer-Konkurrentin. Beständig fühlt sie sich ihr gegenüber benachteiligt, weil Lila klüger, stärker, selbstbewusster, raffinierter und als Jugendliche dann auch noch schöner ist als sie. Dieses ganze Buch lang ist sie ausschließlich bestrebt, es ihr zumindest gleichzutun oder sogar noch besser zu werden. Es quält sie regelrecht, dass Lila nicht einmal eine weiterführende Schule besuchen muss, um genausogut oder sogar noch besser Latein zu lernen als sie. Weil sie es sich selbst erarbeiten kann mit Büchern aus der Bibliothek und nicht die Schulbank dafür drücken muss. Und es ärgert sie beständig, dass Lila sie nicht beneiden will. Das wäre das, was Elena am meisten ersehnt. Dass ihre Freundin sie so beneidet, wie es umgekehrt der Fall ist.
An kaum einer Stelle fand ich wirkliche Empathie mit Lila, keine Freude über deren Erfolge, sondern als sie feststellt, dass diese durch die Verlobung in die bessere Gesellschaft aufsteigt, wo sie nicht hingehört, geht sie sogar eher auf Abstand. Angeblich, weil Lila nicht mehr sie selbst ist. M. E. aber eher, weil sie nicht mehr mithalten kann, da Lila sie überholt hat, obwohl sie nicht weiter zur Schule gegangen ist.
Was für ein Hype wurde und wird um dieses Buch (bzw. die 4 Bücher) gemacht! Ich kann es beim besten Willen nicht nachvollziehen. Es ist ein gut lesbares und auch durchaus unterhaltsames Buch, vor allem für Menschen, die gerne dahinziehende Familien-Epen lesen mögen. Aber mehr auch nicht! "Ein literarisches Meisterwerk von unermesslicher Strahlkraft..."? Also wirklich...
Regelrecht sauer bin ich jedoch über das Ende des Buches - falls man es denn überhaupt so nennen kann. So etwas von Cliffhanger habe ich noch nicht erlebt! Zumindest hätte man das Buch einigermaßen abschließen können. Stattdessen hört es mitten in einer Szene auf und hinterlässt in mir nur noch das fade Gefühl, hier total ausgenommen und veräppelt zu werden.
Das hat einen von den beiden Sternen gekostet, die ich ansonsten vergeben hätte. Mag sein, dass italienische Leser so etwas akzeptieren oder sogar noch spannend finden. Ich finde es unmöglich!
Insgesamt betrachtet war dieses Buch demnach ein Reinfall. Dass eine so interessante Leseprobe so enttäuschend endet, hätte ich mir zuvor nicht denken können.
Weniger
Antworten 2 von 4 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 4 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Obwohl die Ferrante Saga ja schon an großen Ruhm gewonnen hat, muss ich leider gestehen, dass ich sie bisher nicht kannte. Umso gespannter ist man da natürlich auf so ein Buch, das Millionen Leser begeistert hat und die Latte ist hoch gelegt.
Das Buch beginnt ganz geheimnissvoll mit dem …
Mehr
Obwohl die Ferrante Saga ja schon an großen Ruhm gewonnen hat, muss ich leider gestehen, dass ich sie bisher nicht kannte. Umso gespannter ist man da natürlich auf so ein Buch, das Millionen Leser begeistert hat und die Latte ist hoch gelegt.
Das Buch beginnt ganz geheimnissvoll mit dem Verschwinden, ganz und gar Erlöschen könnte man sagen, der nunmehr 66-jährigen Lila. Sie scheint wie von Erdboden verschluckt, und obwohl ihre beste Freundin Elena anfangs locker mit dieser Tatasache umgeht, da Lila immer anders war, fängt sie im Nachhinein doch sich Gedanken zu machen und lässt gleichzeitig ihre Freundschaft Revue passieren.
Kern des ersten Teils der vierbändigen Neapolitanischen Saga ist, meiner Meinung nach, die lebenslange Freundschaft der zwei Frauen aber auch die Verhältnisse, in denen sie aufwachsen. Die Autorin will nichts beschönigen und lässt uns bildreich erfahren wie die südländische, mittellose Familie der 50-er Jahre strukturiert war. Der Vater, beschrieben als absoluter Patriarch und meistens streng und erbamunglos sowie die meisten der Männer, die im Buch vorkommen und die Mutter/Frau, ohne Rechte, abhängig und degradiert. Aus diesem Alltagsleben wollen die beiden Freundinnen flüchten, jede auf ihre eigene Art. Elena wählt die Bildung und Lila, obwohl ebenfalls sehr intelligent, bevorzugt den schnellen Aufstieg durch eine Heirat mit einem wohlhabenden Kandidaten schon im blutjungen Alter von 16 Jahren.
Die Freundschaft der beiden wird oft auf die Probe gestellt, teils durch ihrem Umfeld, teils durch Lilas unkonventionellem, oftmals schwierigem Charakter.
Trotz der Umstände und obwohl sie verschiedene Lebenswege gehen, erhalten sie ihre Freundschaft aufrecht.
Elena Ferrante gelinkt es mit ihrer voluminösen Schreibweise den Leser in die Geschichte zu intergrieren und die 50-er Jahre, mit all ihrer gewaltgeladenen und rohen Strenge lebendig zu gestalten.
Jetzt muss man sich nur noch die Wartezeit um die Ohren schlagen, bis Teil zwei veröffentlicht wird, um der Spur ein wenig näher zu kommen, was denn vielleicht der Anlass für das spurlose Veschwinden Lilas sein könnte.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für
Entdecke weitere interessante Produkte
Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote