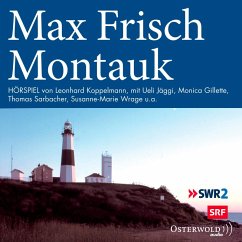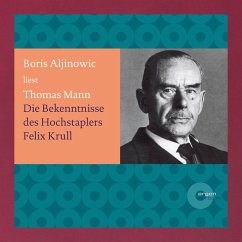Max Frisch
Hörbuch-Download MP3
Montauk (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 335 Min.
Sprecher: Manteuffel, Felix von

PAYBACK Punkte
8 °P sammeln!





Während einer Lesereise lernt Max Frisch in New York die halb so alte Verlagsangestellte Lynn kennen. Sie verbringen ein Wochenende in Montauk an der Nordspitze von Long Island, aber es ist von Anfang an klar, dass er zwei Tage später zurück nach Europa fliegen wird, um seinen 63. Geburtstag zu feiern. Sie vereinbaren, sich nach dem Abschied weder anzurufen noch zu schreiben. Max Frisch nimmt die Affäre zum Anlaß über sein grundsätzliches Verhältnis zu den Frauen in seinem Leben zu reflektieren: Die autobiographische Erzählung über diese Romanze im Mai 1974 teilt Max Frisch in viele ...
Während einer Lesereise lernt Max Frisch in New York die halb so alte Verlagsangestellte Lynn kennen. Sie verbringen ein Wochenende in Montauk an der Nordspitze von Long Island, aber es ist von Anfang an klar, dass er zwei Tage später zurück nach Europa fliegen wird, um seinen 63. Geburtstag zu feiern. Sie vereinbaren, sich nach dem Abschied weder anzurufen noch zu schreiben. Max Frisch nimmt die Affäre zum Anlaß über sein grundsätzliches Verhältnis zu den Frauen in seinem Leben zu reflektieren: Die autobiographische Erzählung über diese Romanze im Mai 1974 teilt Max Frisch in viele einzelne Teile auf, die er mit Erinnerungen, Tagebuchauszügen, Selbstreflexionen und anderem autobiografischen Material zu einer Collage montiert. Besonders interessant sind die Passagen, die aus dem Nähkästchen der Beziehung zu der kapriziösen Ingeborg Bachmann plaudern. (Laufzeit: 5h 38)
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Max Frisch (* 1911 in Zürich, † 1991 in Zürich) studierte zunächst Germanistik, anschließend Architektur. 1934 erschien, neben freier redaktioneller Arbeit für das Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung, sein erstes Buch "Jürg Reinhart". Der Erfolg seines Romans "Stiller" erlaubte ihm ein Leben als freier Schriftsteller. Zahlreiche bedeutende Romane und Erzählungen folgten, seine Dramen wurden im ganzen deutschsprachigen Raum zu großen Bühnenerfolgen. Frisch verbrachte den größten Teil seines Lebens in Zürich, lebte aber auch, zusammen mit Ingeborg Bachmann, in Rom, New York und zuletzt wieder in Zürich. Sein Werk wurde u. a. mit dem Georg-Büchner-Preis 1958 und dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1976 ausgezeichnet. Seine bekanntesten Werke sind die Romane "Stiller" (1945), "Homo faber" (1957), "Mein Name sei Gantenbein" (1964), die Dramen "Biedermann und die Brandstifter" (1958), "Andorra" (1961), die Erzählungen "Montauk" (1975), "Der Mensch erscheint im Holozän" (1979), "Blaubart" (1982) sowie seine literarischen Tagebücher.
andrejr.jpg)
© Andrej Reiser / Suhrkamp Verlag
Produktdetails
- Verlag: Der Hörverlag
- Gesamtlaufzeit: 336 Min.
- Erscheinungstermin: 9. Oktober 2008
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783844503098
- Artikelnr.: 33593317
"Felix von Manteuffel als Sprecher dieses Textes ist ein Glücksfall: Durch seine Sprech-Kunst wird das Werk zum Sprecherlebnis."
»Zu der Zeit der Erstveröffentlichung 1975 war sich die Kritik einig, dass das Verhältnis von Mann und Frau von keinem deutschsprachigen Schriftsteller mit diesem Maß an Offenheit beschrieben wurde. Doch warum soll man Montauk heute wieder lesen? Es ist ein Schlüssel zu Frischs Werk - so einfach ist es mit diesem schmalen Band.« Wolfgang Schäuble DIE WELT 20090922
»Ein egoistisches Buch? Gewiss. Aber auch eines, das den Mut aufbringt, grenzenlos persönlich zu werden. … Diesmal ist das Schreiben der Versuch, das Glück ewig zu erleben, das Glück der letzten, rauschhaften Liebe.«
Frischs Erzählung berichtet von einer Liebe auf Zeit des Autors zu einer über dreißig Jahre jüngeren Frau. Sie wird Anlass, das Leben, seine Beziehungen zu Frauen, seinen Beruf, seine Angst vor dem Alter zu erinnern. Mit Montaigne zu sprechen, von dem das Motto zu …
Mehr
Frischs Erzählung berichtet von einer Liebe auf Zeit des Autors zu einer über dreißig Jahre jüngeren Frau. Sie wird Anlass, das Leben, seine Beziehungen zu Frauen, seinen Beruf, seine Angst vor dem Alter zu erinnern. Mit Montaigne zu sprechen, von dem das Motto zu "Montauk" stammt, ein "aufrichtiges Buch" für Frisch-Kenner und Leser, die nicht nur das Werk, sondern auch den Autor kennenlernen wollen.
Weniger
Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Mein Name sei Frisch
Das epische Werk des Schweizer Schriftstellers Max Frisch ist autobiografisch geprägt, so auch die 1975 erschienene Erzählung «Montauk», die jedoch nicht fiktiv, sondern authentisch sei. Vorbild für diese Erzählhaltung ist Michel de Montaigne, …
Mehr
Mein Name sei Frisch
Das epische Werk des Schweizer Schriftstellers Max Frisch ist autobiografisch geprägt, so auch die 1975 erschienene Erzählung «Montauk», die jedoch nicht fiktiv, sondern authentisch sei. Vorbild für diese Erzählhaltung ist Michel de Montaigne, aus dessen Einführung zu seinen weltberühmten «Essais» Frisch im vorangestellten Motto zitiert: «Denn ich bin es, den ich darstelle. Meine Fehler wird man hier finden, so wie sie sind, und mein unbefangenes Wesen, so weit es nur die örtliche Schicklichkeit erlaubt». Auf die Schicklichkeit komme ich noch zurück, Frisch selbst verdeutlich seine Absicht an einer der Stellen im Buch, an denen er die Entstehung des Textes von «Montauk» selbst thematisiert. «Ich möchte erzählen können, ohne irgendetwas dabei zu erfinden. Eine einfältige Erzähler-Position» merkt er dazu an.
Äußerer Rahmen der Erzählung ist ein Wochenendausflug zu dem titelgebenden Dorf Montauk an der Ostspitze von Long Island, mit dem eine Lesereise des Autors durch die USA endet. Der kurz vor seinem 63ten Geburtstag stehenden Frisch wurde durch eine 30jährige Angestellte des Verlages betreut und hatte mit Alice Locke-Carey, die im Buch Lynn heißt, eine Affäre. Beiden ist klar, dass ihr kurzes Techtelmechtel mit diesem gemeinsamen Ausflug enden wird. Geradezu dokumentarisch berichtet der Autor nun von den zwei zusammen verbrachten Tagen mit der jungen Amerikanerin, die keine Zeile von ihm gelesen hat. Mit scharfem Blick erfasst er die wenig spektakuläre Landschaft und die eher trostlose dörfliche Atmosphäre auf ihrem Kurztrip, der wegen Unpässlichkeit und temporärer Impotenz auch in sexueller Hinsicht nicht gerade ein Highlight ist. In vielen eingeschobenen Rückblicken erzählt Frisch von seinen Frauen, von den beiden gescheiterten Ehen ebenso wie von diversen Liebschaften. Wesentlich jedoch ist die Rückschau auf sein Leben, die Fragen des Alters und den Tod ebenso einschließt wie seinen berufliche Werdegang vom Architekten zum freien Schriftsteller oder seine anfangs prekäre finanzielle Situation. Eine lange Episode widmet er der besonderen Beziehung zu seinem langjährigen, als dominant empfundenen Mäzen und Jugendfreund, außerdem thematisiert er wiederholt auch seine literarische Arbeit als Dramatiker und Epiker. Dabei treibt ihn permanent die Sorge um, dass er mit seinen Texten dem realen Leben nicht wirklich gerecht wird, keine zureichend erscheinende Erzählform dafür gefunden hat.
Eine solch rigorose Selbstentblößung kann natürlich auch peinlich wirken auf die Leserschaft oder die realen Personen ziemlich verärgern; Abtreibungen zum Beispiel sind vermutlich eher ein allseits beachtetes Tabu als ein gern goutiertes literarisches Thema. Aber auch wenn sie die «Schicklichkeit» verletzen in Montaignes Sinne, sind die ungeschönten Geständnisse, bedrängenden Selbstzweifel und grenzenlosen Reflexionen von Max Frisch ein ebenso neuartiger wie bereichernder Erzählansatz abseits üblicher, aber unverbindlicher Fiktionalität.
Mit einer Fülle von trefflich beschriebenen Figuren gliedert sich diese collageartige Erzählung in fast zweihundert assoziationsreiche Einzelszenen unterschiedlichen Umfangs, die ohne kausalen Zusammenhang abrupt vom Gegenwärtigen zum Erinnerten springen. Das erfordert vom Leser viel Aufmerksamkeit, zum vollen Verständnis aber auch Kenntnisse der Vita des Autors. Die Erzählperspektive wechselt mit dem Erzählgegenstand, in den direkt erzählten Szenen wird in der dritten Person erzählt, in der Rückschau berichtet ein Ich-Erzähler. Was allerdings die apostrophierte Wahrhaftigkeit dieser Erzählung anbelangt, so wird man enttäuscht, es stimmt so gut wie nichts! «Mein Name sei Frisch» hat er selbst in Anspielung auf den vorhergehenden Roman geschrieben, seine Bewältigungsarbeit erweist sich also als gescheiterter Versuch zur Authentizität. Die literarische Bedeutung all dessen aber ist unbestritten, man sollte dieses Buch lesen, meine ich, es ist heute schon ein Klassiker!
Weniger
Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Vom 11. Bis 12. Mai 1974 unternimmt der Erzähler, der/ein Autor, eine Lesereise nach NY. Der 63. Jahre alte Herr verguckt sich in die 31 Jahre alte Verlagsangestellte Lynn, die ihn betreuen soll, aber keines seiner Bücher gelesen hat. Die beiden unternehmen einen Wochenendausflug nach Long …
Mehr
Vom 11. Bis 12. Mai 1974 unternimmt der Erzähler, der/ein Autor, eine Lesereise nach NY. Der 63. Jahre alte Herr verguckt sich in die 31 Jahre alte Verlagsangestellte Lynn, die ihn betreuen soll, aber keines seiner Bücher gelesen hat. Die beiden unternehmen einen Wochenendausflug nach Long Island nach Montauk und haben eine kurze Affäre.
Das könnte eine nette Geschichte sein, aber nicht ohne Grund leiden Schüler seit Jahrzehnten unter den Erzählungen von Max Frisch, ich bin da keine Ausnahme. Ich fand als Schüler Homo Faber unsäglich langweilig und die Geschichten werden auch mit dem eigenen Alter nicht besser. Kurzum, es geht in dieser autobiographischen Geschichte darum, dass ein alternder, zweimal geschiedener Mann über sich, die Welt, die Vergangenheit reflektiert und sich in eine Frau verguckt, die seine Tochter sein könnte. Nichts Neues, nicht spannend und nicht neu. Passiert jeden Tag aufs Neue und die Männer fragen sich dann, warum die junge Frau nichts von ihm will. OK, Frisch hat Glück, Lynn lässt sich auf ein Wochenende mit ihm ein und natürlich veröffentlicht er diese Affäre brühwarm mit wahrscheinlich aus datenschutztechnischen Gründen geänderten Namen, was seine Ex natürlich alles andere als begeistert. Die nennt es Literaturkritik, die Figur der Lynn sei nicht plastisch genug, die Geschichte trägt nicht. Stimmt, die Geschichte trägt nicht, aber sie scheint mit dieser Meinung allein zu stehen.
Es mag ja sein, dass man zu der Zeit, als das Buch 1975 erschien, noch darüber diskutierte wie viel aus seinem Privatleben man preisgeben darf, dass diese Nabelschau eines alternden Schriftstellers die Gemüter erregte. In Zeiten des Internets, von Blogs und Facebook ist diese Geschichte mehr als überholt und eine von vielen Nabelschauen alter Schriftsteller, die über ihre Vergangenheit sinnieren, das Alter, ihren Erfolg und dessen Wirkung auf Neider. Frisch gibt Details aus seinem Leben preis, so. z. Bsp. über den Tod und das Sterben seiner Mutter, seine Impotenz und vier Schwangerschaftsabbrüche bei drei Frauen. Ja und?! Wen interessiert das? Seit wann ist das hohe Literatur oder hat der Zeitgeist dieses Buch einfach nur überholt? War Frisch einfach nur ein Vorreiter und ist diese Geschichte daher ein Meisterwerk, nur weil er 30 Jahre seiner Zeit vorraus war und selber gebeichtet hat, bevor es in einem Bouevardblatt landete?
Zum 100. Geburtstag von Max Frisch sah sich der SWR dazu bemüßigt, aus diesem unsäglich langweiligen blogartigen Buch der 70er ein zweiteiliges Hörspiel zu machen, das am 8. und 15. Mai 2012 im SWR2 gesendet wurde.
Als wäre diese Erzählung nicht schon nervig genug, mit ihren Zeitsprüngen und unzusammenhängenden Erzählweise und so gut wie nicht vorhandener Handlung außer dem Selbstmittleid eines alten Mannes, nein, hier wurden noch Briefe der Ex (Marianne Frisch) und eines Kollegen (Uwe Johnson) mit eingewoben, die sich in geschwollenen pseudointellektuellen Ergüssen über dieses Werk in brieflicher Form austauschen, nach dem Motto, je geschraubter desto besser. Hautsächlich geht es darum, wie privat darf eine Veröffentlichung sein? Ein heutzutage mehr als überholtes Thema, wo bei Facebook gepostet wird, wenn man mal aufs Klo muss.
Angeblich ist diese Erzählung der Höhepunkt des Prosawerkes von Max Frisch, eine "Buch über die Liebe“, ein "radikal subjektives Stück Literatur", das bis heute Maßstäbe setzt. Ich fand es nur unsäglich platt, langweilig und überflüssig, so mancher aktueller Blog ist fesselnder.
Ich dachte, dass es einen Grund haben muss, warum man in der Schule mit Max Frisch gequält wird. Ich dachte, ich war einfach zu jung, ich hätte die Schullektüren nicht verstanden. Ich dachte, wenn man älter ist, sind das bestimmt hochgeistige Bücher. Ich musste leider feststellen, nicht alles was gelobt wird ist auch wirklich gut. Montauk reiht sich mit Dojczland in die Reihe unnötige Ergüsse alternder Schriftsteller, die eine Nabelschau veröffentlichen, ein.
Weniger
Antworten 1 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für