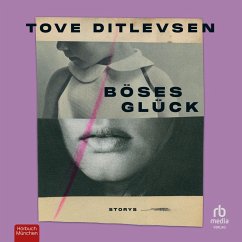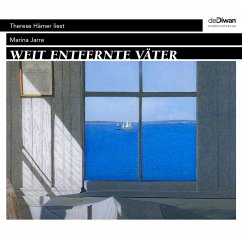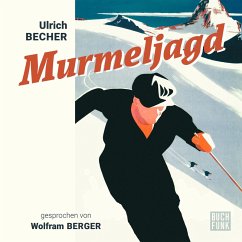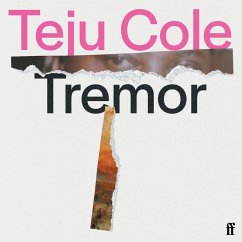Diane Oliver
Hörbuch-Download MP3
Nachbarn (MP3-Download)
Storys Ungekürzte Lesung. 507 Min.
Sprecher: Alban-Zapata, Maya / Übersetzer: Jakobeit, Brigitte; Oldenburg, Volker

PAYBACK Punkte
8 °P sammeln!





Ein Buch, auf das die Welt 60 Jahre warten musste: große Literatur, in der Aktivismus und Poesie in explosiver Weise aufeinandertreffen "Nachbarn" ist eines jener seltenen Werke in der Literatur, die ihre Zeit einfangen und ihr doch weit voraus sind. Diane Oliver erkundet darin die sich wandelnden sozialen Umstände: Beäugt von den Nachbarn, fragen sich Ellie und ihre Familie, ob es richtig ist, den kleinen Bruder morgen als einziges Kind auf die Schule der Weißen zu schicken. Ein Paar wird durch rassistische Übergriffe dazu getrieben, im Wald zu leben, und entwickelt eine mörderische Wut...
Ein Buch, auf das die Welt 60 Jahre warten musste: große Literatur, in der Aktivismus und Poesie in explosiver Weise aufeinandertreffen "Nachbarn" ist eines jener seltenen Werke in der Literatur, die ihre Zeit einfangen und ihr doch weit voraus sind. Diane Oliver erkundet darin die sich wandelnden sozialen Umstände: Beäugt von den Nachbarn, fragen sich Ellie und ihre Familie, ob es richtig ist, den kleinen Bruder morgen als einziges Kind auf die Schule der Weißen zu schicken. Ein Paar wird durch rassistische Übergriffe dazu getrieben, im Wald zu leben, und entwickelt eine mörderische Wut. Meg heiratet einen Schwarzen, doch die Liebe fordert über die Grenzen der Hautfarbe ihren Preis. Über allem könnte die Frage stehen: Gibt es einen Unterschied zwischen dem, was für die Gesellschaft am besten ist, und dem, was das Individuum braucht? Oliver geht es immer um beides, um das Politische und das Persönliche, und damit um allgemeingültige Fragen unserer Existenz und unseres Miteinanders. "Diane Oliver ist die größte amerikanische Autorin des 20. Jahrhunderts. Mit ihr reise ich in die Zeit der Bürgerrechtsbewegung und in die Seele der Menschen. Wenn Nina Simone die High Priestess of Soul war, ist Diane Oliver die High Priestess of Literature." Julia Franck "Diane Olivers überwältigende Geschichten tauchen in einer Zeit wieder auf, in der uns die Brutalität des Rassismus immer wieder vor Augen geführt werden muss. Oliver ist weder an Raum noch an Zeit gebunden und gibt uns ergreifende Einblicke in das Leben derjenigen, deren Menschlichkeit ständig verleugnet wird." Emilia Roig
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Diane Oliver wurde 1943 in Charlotte, North Carolina, geboren und besuchte nach dem Highschool-Abschluss das Women's College, die spätere University of North Carolina. Sie war Chefredakteurin der Unizeitung und veröffentlichte zu ihren Lebzeiten vier Kurzgeschichten, darunter die Story 'Nachbarn', die mit dem O. Henry Award ausgezeichnet wurde. An der University of Iowa nahm sie am Writers' Workshop teil und erhielt den Master-Abschluss postum, wenige Tage nachdem sie 1966 im Alter von 22 Jahren bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen war.
Produktdetails
- Verlag: Aufbau Audio
- Altersempfehlung: 16 bis 99 Jahre
- Erscheinungstermin: 7. Februar 2024
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783757012397
- Artikelnr.: 69831555
Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension
Wie kann man mit 22 Jahren schon so souverän schreiben, fragt sich Rezensentin Nora Karches nach der Lektüre von Diane Olivers Kurzgeschichten. Oliver starb zwar sehr früh, hinterließ aber viele Kurzgeschichten, die sich vor allem mit der "psychischen Dimension von Rassismus" beschäftigen, erfahren wir. Dabei sei nicht jede Geschichte, Oliver wechselt oft das Genre, gelungen, aber die meisten überzeugten durch eine hohe Qualität, findet die Kritikerin. Die Autorin erzählt sehr plastisch, so Karches, beispielsweise von einer Mutter von fünf Kindern, die sich eigentlich nur ein ruhiges Leben wünscht oder von dem schwarzen Jungen Tommy, dessen Eltern sich unsicher sind, ob sie ihn auf eine weiße Schule gehen lassen sollten. Oliver macht all diese Dilemmata erfahrbar und zeigt die gesellschaftspolitischen Verwerfungen jener Jahre, in denen Rassentrennung verboten, aber gelebte Praxis war, lobt die Kritikerin schließlich.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Ein sensationeller Fund.« Süddeutsche Zeitung 20240131
Zum Inhalt:
Kann man es wagen das eigene Kind als einziges Kind auf eine Schule der Weißen zu schicken? Ein anderes Paar fühlt sich durch rassistische Übergriffe genötigt im Wald zu leben und entwickelt eine ungeheure Wut. Und eine Heirat mit einem Schwarzen fordert ihren …
Mehr
Zum Inhalt:
Kann man es wagen das eigene Kind als einziges Kind auf eine Schule der Weißen zu schicken? Ein anderes Paar fühlt sich durch rassistische Übergriffe genötigt im Wald zu leben und entwickelt eine ungeheure Wut. Und eine Heirat mit einem Schwarzen fordert ihren Preis.
Meine Meinung:
Ich hatte die Gelegenheit sowohl das Buch zu lesen als auch das Hörbuch zu hören und beide haben ihre eigenen Qualitäten. Was aber natürlich bei beiden gleich ist, ist das überragend gut umgesetzte Thema des Rassismus. Wer selbst nicht damit konfrontiert ist, kann im wahren Leben kaum die Probleme nachvollziehen. Hier wird einem aber sehr deutlich gemacht, was Betroffene durchleiden müssen und das nur durch eine andere Hautfarbe. Ich fand sowohl den Schreibstil als auch die Art des Vortrags sehr gut. Trotz des schwierigen Themas fühlte ich mich gut unterhalten.
Fazit:
Tolles Thema
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Zeitlose Kurzgeschichten
„Nachbarn“ beinhaltet 14 Kurzgeschichten, die alltägliche Ereignisse unter Einfluss rassistischer Prägungen der 1960er Jahre in den Südstaaten Amerikas darstellen. Aus den Geschichten gehen Gefühle wie Angst oder Hoffnungslosigkeit der …
Mehr
Zeitlose Kurzgeschichten
„Nachbarn“ beinhaltet 14 Kurzgeschichten, die alltägliche Ereignisse unter Einfluss rassistischer Prägungen der 1960er Jahre in den Südstaaten Amerikas darstellen. Aus den Geschichten gehen Gefühle wie Angst oder Hoffnungslosigkeit der Betroffenen hervor und jede Biographie ist für sich sehr berührend und lebensecht. Sie werden durch äußere Umstände in ihrer Selbstbestimmtheit eingeschränkt und das wirkt sich in ganz unterschiedliche Bereiche des Lebens aus, von der medizinischen Behandlung bis hin zu akademischen Beziehungen.
Die Autorin Diane Oliver ist leider sehr jung verstorben und es ist umso bemerkenswerter, wie prägnant und realistisch sie Themen des Rassismus, der Armut und Gewalt schildert.
Die Zusammenstellung dieser zu ihren Lebzeiten unveröffentlichten Kurzgeschichten ist nur zu empfehlen und eine große Bereicherung!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Sehr wichtiges Thema
"Nachbarn" von Diane Oliver habe ich in der ungekürzten Version gehört und vielleicht habe ich durch dieses Medium ein wenig den Faden verloren.
Beim hören sind mir manchmal die Übergänge zwischen den Geschichten etwas verloren gegangen.
Das …
Mehr
Sehr wichtiges Thema
"Nachbarn" von Diane Oliver habe ich in der ungekürzten Version gehört und vielleicht habe ich durch dieses Medium ein wenig den Faden verloren.
Beim hören sind mir manchmal die Übergänge zwischen den Geschichten etwas verloren gegangen.
Das Buch hat eine sehr eindringliche Sprache, die Protagonisten werden sehr gut vorgestellt, nicht alle sind sympathisch, gerade das macht hier für mich aber das echte und ehrliche aus.
Unvorstellbar, was sie erleben und erdulden müssen, einzig aufgrund Herkunft und Hautfarbe. Die Geschichten kommen aus ganz verschiedenen Situationen und natürlich geht auch jeder anders damit um.
Manchen der Geschichten merkt man ihr Alter an, andere könnten genauso auch jetzt entstanden sein.
Die Qualität ist sehr unterschiedlich, nicht jede Erzählung konnte mich mitnehmen, war für mich wichtig, aber zu sagen hatten mir alle etwas. Auch dass wir immer noch achten müssen, auf jeden einzelnen Menschen, damit niemand verloren geht.
Eine gute Sammlung kurzer Erzählungen, gut und verständlich gesprochen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Das Buch "Nachbarn" der leider viel zu früh verstorbenen Schriftstellerin Diane Oliver wird zu Recht als literarische Perle beworben.
Es handelt sich hier um Kurzgescchichten, die in den 50-60 iger Jahren in den Südstaaten spielen. Als Leser habe ich hier ein detailiertes Bild …
Mehr
Das Buch "Nachbarn" der leider viel zu früh verstorbenen Schriftstellerin Diane Oliver wird zu Recht als literarische Perle beworben.
Es handelt sich hier um Kurzgescchichten, die in den 50-60 iger Jahren in den Südstaaten spielen. Als Leser habe ich hier ein detailiertes Bild von dem Leben der Schwarzen zu dieser Zeit bekommen. Die einzelnen Geschichten sind bedrückend, traurig und an einigen Stellen auch hoffnungsvoll. Einiges hat sich für die schwarzen Menschen bis heute geändert, doch an vielen Stellen ist der in den Geschichten behandelte Rassismus heute auch noch weltweit Allgegenwärtig.
Die Autorin beleuchtet darin die unterschiedlichsten Menschen mit ihren Ängsten und Träumen. Mütter, die weiße Kinder betreuen, den Haushalt machen, während zu Hause ihre eigenen Kinder von der großen Schwester betreut werden. Aber auch scchwarze Ärzte, die ein relativ gutes Leben führen konnten. Die Jugend fand sich zusammen, um gegen die Diskriminierungen gegen sie auf die Straße zu gehen. Zu einem teilweise sehr hohen Preis.
Es ist kaum zu glauben, dass die Autorin gerade mal 23 Jahre alt war, als sie dieses Meisterwerk zu Papier gebracht hat. Ein beeindruckendes Buch in jeglicher Hinsicht.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
„Nachbarn“ von Diane Oliver (1943-1966) ist eine Sammlung unterschiedlicher Geschichten aus den 50er und 60er Jahren über die Bürgerrechtsbewegung in Amerika und deren unterschiedliche Formen von Diskriminierung und Rassismus.
Nachbarn erzählt von dem kleinen Tommy, …
Mehr
„Nachbarn“ von Diane Oliver (1943-1966) ist eine Sammlung unterschiedlicher Geschichten aus den 50er und 60er Jahren über die Bürgerrechtsbewegung in Amerika und deren unterschiedliche Formen von Diskriminierung und Rassismus.
Nachbarn erzählt von dem kleinen Tommy, der als einziges farbiges Kind eine Schule der Weißen besuchen soll. Ellie, seine Schwester trifft auf dem Nachhauseweg den alten Mr. Paul und dieser murmelt: Ich glaube nicht, dass sie ihm was tun“.
Auch ein unbekanntes Paar aus einem Auto spricht Ellie an: Hör mal Mädchen, du kennst mich nicht, aber dein Vater kennt mich. Sag ihm, wenn seinem Jungen morgen was passiert, bringen wir die Sache in Ordnung“.
Die Weißen bedrohten die Familie seit Wochen, Drohbriefe wurden an den kleinen Tommy geschickt. Polizeifahrzeuge vor dem Haus sollen der Familie ein Gefühl der Sicherheit geben.
Der Junge ist still und verängstigt. Bis eine Bombe am Vorabend des Schulstart alles auf den Kopf stellt und die Angst allgegenwärtig ist. Das Leben ihres Kindes liegt in der Verantwortung der Eltern und doch hadern diese mit sich: Wie sollen sie ihren Kindern klarmachen, dass sie Angst vor den Weißen haben?
Unglaublich intensiv zeichnet die Autorin ein Bild der Angst, des Unbehagen und die Bösartigkeit der Weißen. Die Hautfarbe zeigt die Unterschiede auf und trotz der Bürgerrechtsbewegung ist der Hass deutlich spürbar.
Ein Mädchen wird von ihren Eltern auf die Green-Hill-Universität geschickt in der Hoffnung, dass sie die erste farbige Absolventin wird. Ihr Vater hat alles dafür getan, Bittbriefe geschrieben und mit einer Klage gedroht. Alle Mädchen außer Winifred waren in einer Studentinnenverbindung. Ihre Mitbewohnerin redete über sie, ihre Eigenarten, Gewohnheiten und ihre Kleidung. Das Mädchen wird zur Außenseiterin, bis sie nicht mehr am Unterricht teilnimmt, alleine ein Zimmer bewohnt und nur noch eine fensterlose Kammer zum lernen nutzt. Die Hausmutter macht sich Gedanken und ein Arzt fragt, ob es ihr etwas ausmacht, die einzige Schwarze am College zu sein.
Winifred verlässt das College und ihr Vater meint: Sie haben sich aufgeführt, als wärst du nicht gut genug für ihr College.“
Wer oder was macht das Mädchen krank?
Junge Farbige gehen in den Tea Room und wollen viermal das Tagesgericht bestellen; alle Weißen verlassen fluchtartig das Restaurant und die Polizei nimmt die jungen Menschen mit auf das Revier. Aus der schaulustigen Menge hörten die jungen Menschen wie jemand laut >Ni****< rief. Die beiden Männer und Frauen wurden stundenlang verhört, eingesperrt und zuletzt die Männer nochmal befragt und dabei misshandelt.
In den weiteren Kurzgeschichten geht es um Rassenintegration und die Storys werden tiefgründig, emotional und intensiv beschrieben.
Geht es um die Integration oder um das eigene Schicksal? Welcher Weg ist richtig, der private oder politische?
Nicht nur Schwarze, auch Weiße sind Leidtragende der Minderheitenrechte auch wenn die Gesetze bereits in den 60er Jahren aufgehoben wurden.
Die junge Autorin zeigt unglaublich gut mit ihren Kurzgeschichten die verschiedenen Lebensweisen von Schwarz und Weiß, die unterschiedlichen Wahrnehmungen und was eine Hautfarbe für Auswirkungen auf das Leben und das Umfeld haben kann.
Hoch emotional und zugleich schlicht und ergreifend zieht uns Diane Oliver in ihre Storys.
Fesselnd und ergreifend öffnen wir nach jeder Geschichte mehr und mehr unser Herz. Als Leser fasziniert der Schreibstil und eröffnet uns andere Sichtweisen.
Ein Kampf für die gleichen Rechte, Hoffnung verbunden mit Angst.
Ein Spagat zwischen Liebe und Hass, Freundschaft und Angst, Schwarz und Weiß ….
Diane Oliver hat ein großartiges literarisches Werk erschaffen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Die vielen lobenden Rezensionen über dieses Buch, sind nicht übertrieben, denn diese Kurzgeschichten, die in den 1960er Jahren von Diane Oliver geschrieben wurden, sind nicht nur literarisch ganz wunderbar, sondern obendrein auch noch geschichtlich extrem relevant.
Diane Oliver starb …
Mehr
Die vielen lobenden Rezensionen über dieses Buch, sind nicht übertrieben, denn diese Kurzgeschichten, die in den 1960er Jahren von Diane Oliver geschrieben wurden, sind nicht nur literarisch ganz wunderbar, sondern obendrein auch noch geschichtlich extrem relevant.
Diane Oliver starb 1966 mit bloß 22 Jahren bei einem Motorradunfall, was mich sehr traurig stimmt, denn sie hätte uns noch viele Geschichten schenken können. Ihre Kurzgeschichten wurden erst vor kurzem wieder entdeckt und sind vielseitig, auch wenn es in allen um die Thematik "Schwarzes Leben" geht.
Eigentlich bin ich keine Freundin von Kurzgeschichten, ich lese lieber dicke Bücher, aber diese wertvolle Sammlung hat mich sehr neugierig gemacht. Natürlich hätte ich jede einzelne Geschichte lieber als 380 Seiten Buch gelesen, aber das soll keine Wertung sein - es ist einfach eine persönliche Geschmacksache.
Ich habe alle Geschichten gemocht, manche vielleicht ein wenig mehr als andere - berührt hat mich jede. Dankbar war ich für das Nachwort von Tayari Jones, denn es hat mir Hilfestellung bei der einen oder anderen Geschichte gegeben, die ich dann besser einordnen konnte. Ich empfinde es ebenso wie sie: diese Geschichtensammlung ist wie eine Zeitkapsel und Diane Oliver bietet uns einen unverfälschten Blick in die Stimmung der Bürgerrechtsbewegung.
Ich denke, dieses Buch gehört ganz oben auf die Liste der wichtigsten Bücher aller Zeiten. Ein Muss!
Übersetzt von Brigitte Jakobeit und Volker Oldenburg.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Das Buch Nachbarn von Diane Oliver enthält 14 Geschichten, die sie in jungen Jahren geschrieben hat. Sie starb bereits 1966 mit 22 Jahren und die Geschichten wurden erst jetzt entdeckt und veröffentlicht. Die Storys thematisieren überwiegend die schwierige Stellung der Farbigen in …
Mehr
Das Buch Nachbarn von Diane Oliver enthält 14 Geschichten, die sie in jungen Jahren geschrieben hat. Sie starb bereits 1966 mit 22 Jahren und die Geschichten wurden erst jetzt entdeckt und veröffentlicht. Die Storys thematisieren überwiegend die schwierige Stellung der Farbigen in verschiedensten Ausprägungen, sei es, dass es ihnen untersagt war in Lokale zu gehen, die von Weißen besucht wurden, ebenso wie eine Eheschließung zwischen Schwarz und Weiß. Beim Lesen wird einem bedrückend bewusst , dass diese 60 Jahre alten Erzählungen zum Teil auch heute noch aktuell sind. Wer in so jungen Jahren schon solche Texte verfassen kann, was hätte sie noch alles schreiben können, wenn ihr ein bisschen mehr Lebenszeit vergönnt gewesen wäre. Obwohl Kurzgeschichten nicht unbedingt mein Fall sind, sind diese sprachlich und inhaltlich unbedingt lesenswert.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Diane Oliver ist schon 1966 verstorben, da war sie gerade 22 Jahre alt. Das Buch enthält eine lesenswerte Vielzahl an Kurzgeschichten, die in den amerikanischen Südstaaten in den 60iger Jahren spielen. Die Geschichten sind vielfältig, mal steht ein Kind im Mittelpunkt des Geschehens, …
Mehr
Diane Oliver ist schon 1966 verstorben, da war sie gerade 22 Jahre alt. Das Buch enthält eine lesenswerte Vielzahl an Kurzgeschichten, die in den amerikanischen Südstaaten in den 60iger Jahren spielen. Die Geschichten sind vielfältig, mal steht ein Kind im Mittelpunkt des Geschehens, mal eine alleinerziehende Frau. Allen Geschichten ist aber ein Thema zueigen, es handelt sich um Beziehungen zwischen schwarzen und weißen Menschen. Die Autorin trifft jeweils die damals herrschenden sozialen Missstände sehr genau, da bereitet eine schwarze Haushaltshilfe das Frühstück für eine Familie vor, während ihr eigenes jüngstes Kind auf der Terrasse einer Nachbarin darauf wartet, aufgenommenen und umsorgt zu werden. Manche Geschichten sind einfach hart zu lesen, da braucht es Abstand, um die nächste zuzulassen, andere scheinen wiederum abrupt zu enden und hätten für mich einer Überarbeitung bedurft. Insgesamt finde ich die Kurzgeschichten sehr bewegend, sie zeigen , wie starr und unüberbrückbar die Grenzen in den Köpfen verliefen. Es ist wirklich sehr tragisch, dass die Autorin so jung verstorben ist. Ich hätte gern ein Interview mit ihr zur heutigen Situation farbiger Menschen gelesen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Diane Olivers Kurzgeschichtenband "Nachbarn" ist eine Sammlung von Geschichten, die nicht nur die sozialen Umstände ihrer Zeit einfangen, sondern auch zeitlose Fragen über Identität und Vorurteile aufwerfen. Mit einem einfühlsamen und empathischen Schreibstil zeigt …
Mehr
Diane Olivers Kurzgeschichtenband "Nachbarn" ist eine Sammlung von Geschichten, die nicht nur die sozialen Umstände ihrer Zeit einfangen, sondern auch zeitlose Fragen über Identität und Vorurteile aufwerfen. Mit einem einfühlsamen und empathischen Schreibstil zeigt Oliver die Welt verschiedener Charaktere, vor allem Frauen, die mit den Herausforderungen und Konflikten der amerikanischen Gesellschaft der 50er und 60er Jahre konfrontiert sind. Die Autorin zeigt eine bemerkenswerte Vielfalt an Perspektiven und schafft es dabei, die komplexen Dynamiken zwischen Rasse, Klasse und Geschlecht zu erkunden.
Jede Geschichte in "Nachbarn" zeichnet sich durch genaue und einfühlsame Beobachtungen aus, die Empathie für unterschiedlichste Situationen ermöglichen. Von der Entscheidung einer Familie, ihren Sohn auf eine weiße Schule zu schicken, bis hin zu einem Paar, das durch rassistische Übergriffe zur Flucht in den Wald getrieben wird, werden die Leserinnen und Leser mit einer Bandbreite von menschlichen Erfahrungen konfrontiert.
Besonders bemerkenswert ist, dass diese Sammlung von Geschichten von einer Autorin stammt, die erst Anfang 20 war. Diane Oliver zeigt eine reife Herangehensweise an ihre Themen, die weit über ihr Alter hinausgeht. "Nachbarn" ist nicht nur eine eindringliche Darstellung der amerikanischen Geschichte, sondern gewährt Einblicke in die menschliche Natur und unsere Beziehungen zueinander.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
"Nachbarn" ist eine Sammlung von Geschichten. Von Geschichten, die vom Leben Schwarzer Menschen in den 50ern und 60ern in Amerika erzählt. Es geht um Segregation, Rassismus, Sklaverei und soziale Ungleichheit. Diane Oliver schafft es, durch die verschiedenen Perspektiven der …
Mehr
"Nachbarn" ist eine Sammlung von Geschichten. Von Geschichten, die vom Leben Schwarzer Menschen in den 50ern und 60ern in Amerika erzählt. Es geht um Segregation, Rassismus, Sklaverei und soziale Ungleichheit. Diane Oliver schafft es, durch die verschiedenen Perspektiven der Protagonist*innen der Storys all diese Themen anschaulich zu vermitteln. Die Sprache der Übersetzung ist einfach und leicht zu lesen, aber schafft es dennoch die Nuancen der Lebensrealtitäten sehr gut abzubilden. Obwohl die einzelnen Geschichten teilweise vor mehreren Jahrzehnten veröffentlich wurden, sind einige der Themen traurigerweise immer noch aktuell und können in aktuelle Diskurse über Rassismus eingebettet werden. Diane Oliver wirft ein Spotlight auf Menschen, die mir vor der Lektüre des Buches wohl fremd geblieben wären. Eine große Empfehlung, die neben dem Aspekt, dass man eine Menge lernt auch unterhaltsam zu lesen ist.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für